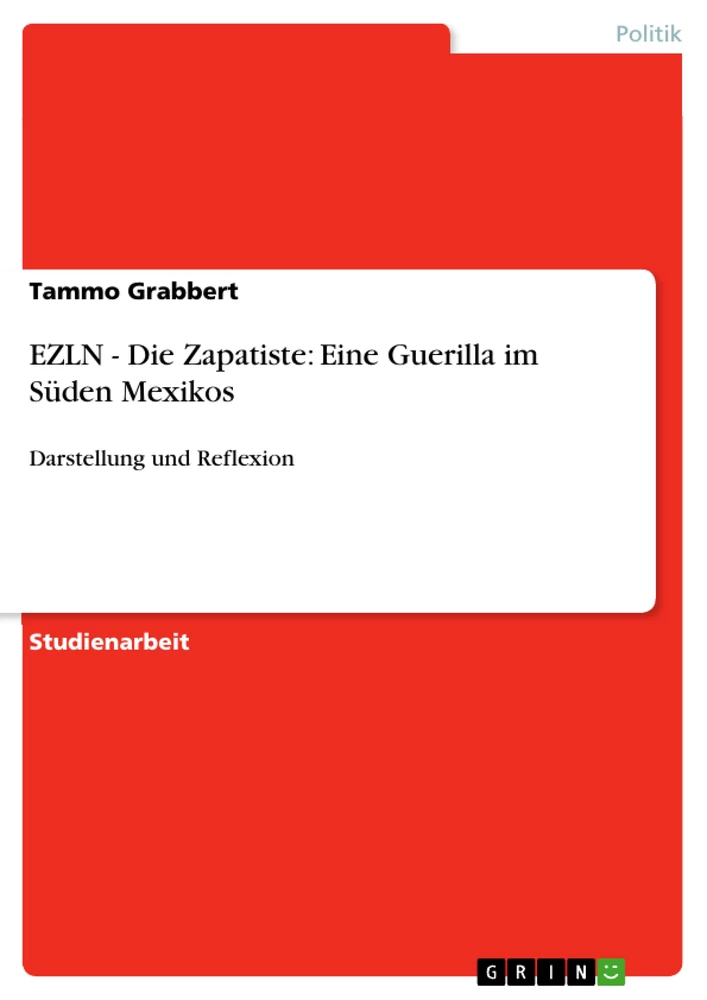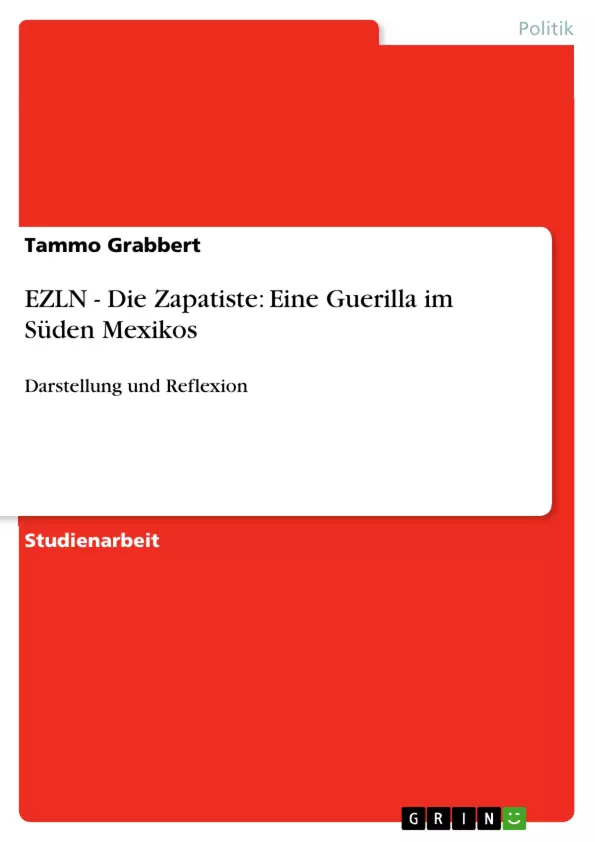Die Schüsse, die in der Neujahrsnacht des Jahres 1994 in San Cristóbal und anderen Ortschaften des mexikanischen Bundesstaates Chiapas fielen, hallten binnen kürzester Zeit bis in die Hauptstadt Mexiko City und lösten dort ein Erdbeben aus – ein politisches, versteht sich.
Der 1. Januar 1994 hatte eigentlich ein Freudenfest für Mexiko werden sollen, denn an diesem Tag trat das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (NAFTA) in Kraft. Damit hatte Mexiko als erstes Land Lateinamerikas den Sprung unter die größten Industrienationen der Welt getan und betrachtete sich bereits als Mitglied der „Ersten Welt“.
Doch eine kleine Guerillagruppe aus dem Süden des Landes sorgte dafür, dass die jubelnden Schlagzeilen in der Presse urplötzlich keine Bedeutung mehr hatten.
Der tiefe Schock, den dieser völlig unerwartet ausgebrochene Aufstand im ganzen Land auslöste, wich schnell einer großen Welle der Sympathie in der mexikanischen Öffentlichkeit für die Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), die Zapatistische Armee der Nationalen Befreiung, wie sich die Rebellen nannten. So kam es bereits in den ersten Tagen des Krieges zu prozapatistischen Massendemonstrationen in Mexiko City und auch die Weltöffentlichkeit blickte plötzlich nach Chiapas.
Diese Arbeit versucht, die Fragen zu beantworten, die sich einem unweigerlich stellen, wenn man sich mit den Zapatisten beschäftigt. Sie soll in erster Linie eine Darstellung der Bewegung, deren Ursprünge und ihres Politikverständnisses sein. Der Fokus der Betrachtung folgt dabei dem Blick des zunächst unwissenden Beobachters, der sich von Außen dem Phänomen annähert und dabei jedesmal, wie bei einer Zwiebel, eine neue Schale abträgt, nicht um bis zum vermeintlichen Kern vorzustoßen, sondern um die Zwiebel an sich besser zu verstehen. Nach einem kurzen Überblick über die Ereignisse nach dem Aufstand, zeigt die Arbeit zu Beginn die Faktoren auf, die letztendlich zur Rebellion in Chiapas geführt haben. Hierbei wird der historischen Entwicklung der Problemlage und der spezifischen Situation der Indígenas, die die soziale Basis der Zapatisten darstellen, besondere Aufmerksamkeit zuteil. Anschließend geht es um das Phänomen Marcos (den Sprecher der EZLN) und um die Organisation bzw. die Politik der zapatistischen Guerilla selbst. Schließlich wird die Frage nach den Auswirkungen des Aufstandes beantwortet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Ereignisse seit 1994
- Der Weg in die Rebellion
- Subcomandante Marcos — Der „Herr der Spiegel"
- Die EZLN — Entstehung, Organisation, Ziele und Politik
- Zum Schluss
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Zapatistischen Armee der Nationalen Befreiung (EZLN), einer Guerillagruppe im Süden Mexikos. Sie analysiert die Entstehung der Bewegung, ihre Organisation, Ziele und Politik sowie die Rolle des Subcomandante Marcos. Die Arbeit beleuchtet die Hintergründe und Ursachen der Rebellion, die im Kontext der sozialen und politischen Situation der Indigenas in Chiapas zu sehen sind.
- Die soziale und politische Situation der Indigenas in Chiapas
- Die Rolle des Subcomandante Marcos als Sprecher und Symbolfigur der EZLN
- Die Organisationsstruktur und das Politikverständnis der EZLN
- Die Ziele der EZLN, insbesondere die Anerkennung indigener Rechte und Kultur, die Landfrage und die Beendigung der Militarisierung von Chiapas
- Der Kampf gegen den Neoliberalismus und die globale Vereinnahmung
Zusammenfassung der Kapitel
-
Die Einleitung stellt die EZLN und den Hintergrund des Aufstands in Chiapas vor. Sie erklärt die Bedeutung des 1. Januar 1994, an dem die EZLN ihren Kampf begann, und die weltweite Aufmerksamkeit, die die Rebellion erregte.
-
Das zweite Kapitel gibt einen Überblick über die wichtigsten Ereignisse seit dem Aufstand in Chiapas. Es beschreibt die ersten Aktionen der EZLN, die Reaktion der mexikanischen Regierung und die internationale Reaktion auf den Konflikt. Es werden auch die Verhandlungen zwischen der EZLN und der Regierung und die verschiedenen Phasen des Konflikts skizziert.
-
Das dritte Kapitel beleuchtet die historischen und sozialen Faktoren, die zum Ausbruch der Rebellion in Chiapas führten. Es beschreibt die Geschichte Mexikos und die Situation der Indigenas, insbesondere in Chiapas, die durch Armut, Landverlust und Diskriminierung geprägt war. Es zeigt, wie die neoliberale Wirtschaftspolitik und die Vernachlässigung der indigenen Gemeinden zur Verzweiflung der Indigenas und letztlich zum Aufstand führten.
-
Das vierte Kapitel widmet sich der Person des Subcomandante Marcos, dem Sprecher und militärischen Führer der EZLN. Es beleuchtet seine Biografie, seine Rolle in der EZLN und seinen Einfluss auf die mexikanische und internationale Öffentlichkeit. Es analysiert seine Rhetorik, seine Kritik am politischen System und seine Bedeutung als Symbolfigur für den indigenen Widerstand.
-
Das fünfte Kapitel untersucht die EZLN als Organisation. Es beschreibt ihre Entstehung, ihre Organisationsstruktur, ihre Ziele und ihre politische Ideologie. Es beleuchtet die Rolle der indigenen Gemeinden und die Bedeutung der „Zivilgesellschaft" für die Bewegung. Es analysiert die Kritik der EZLN am Neoliberalismus und an der globalen Vereinnahmung und ihre Forderung nach einem gemeinsamen Kampf aller Ausgegrenzten der Welt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die EZLN, die Zapatisten, die Indigenas, Chiapas, Mexiko, der Neoliberalismus, die Globalisierung, die Landfrage, die indigenen Rechte, die Menschenrechte, der Subcomandante Marcos, die politische Repression, die soziale Ungleichheit und der Kampf gegen die globale Vereinnahmung.
Häufig gestellte Fragen
Wer sind die Zapatisten (EZLN)?
Die EZLN (Zapatistische Armee der Nationalen Befreiung) ist eine Guerillagruppe im mexikanischen Bundesstaat Chiapas, die sich primär für die Rechte der indigenen Bevölkerung einsetzt.
Warum begann der Aufstand am 1. Januar 1994?
An diesem Tag trat das NAFTA-Freihandelsabkommen in Kraft. Die Zapatisten sahen darin ein "Todesurteil" für die indigenen Bauern, da es den Schutz ihres Landes und ihrer Wirtschaft bedrohte.
Wer ist Subcomandante Marcos?
Marcos war der charismatische Sprecher und militärische Führer der EZLN. Er wurde durch seine Rhetorik und seine Maskierung zum weltweiten Symbol für den Widerstand gegen den Neoliberalismus.
Was sind die Hauptziele der EZLN?
Die Ziele umfassen die Anerkennung indigener Rechte und Kultur, eine gerechte Landreform, Demokratie, Freiheit und den Kampf gegen die neoliberale Globalisierung.
Wie reagierte die Weltöffentlichkeit auf den Konflikt?
Der Aufstand löste eine Welle der Sympathie aus. Besonders die geschickte Nutzung der Medien durch die Zapatisten führte dazu, dass Chiapas zum Fokus internationaler Menschenrechtsgruppen wurde.
- Arbeit zitieren
- Diplom Sozialwissenschaftler Tammo Grabbert (Autor:in), 2003, EZLN - Die Zapatiste: Eine Guerilla im Süden Mexikos, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/133825