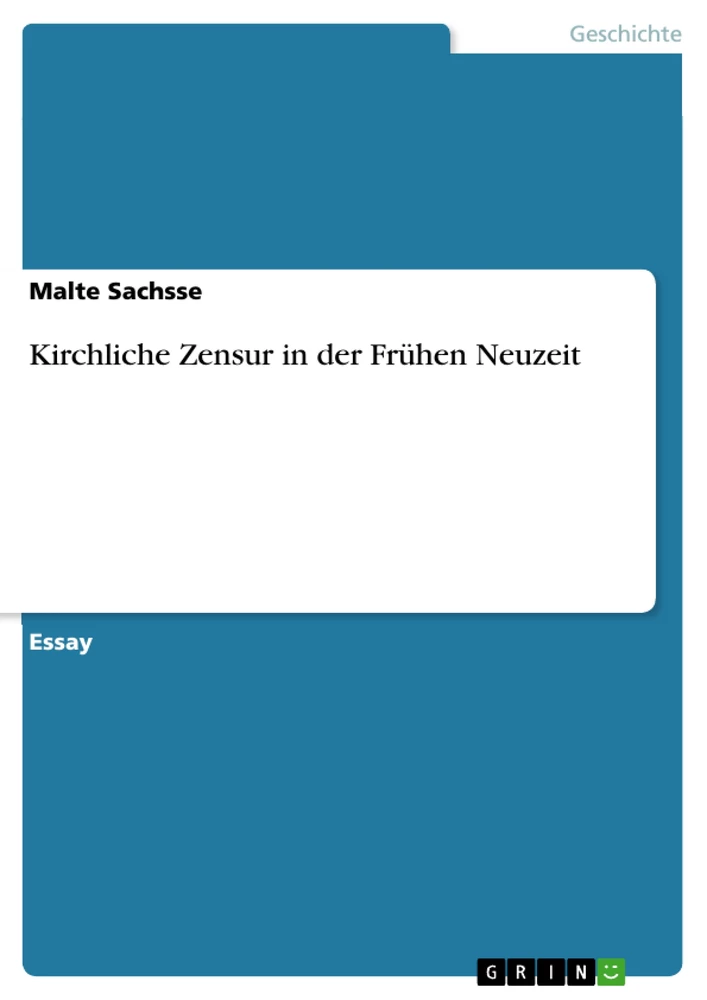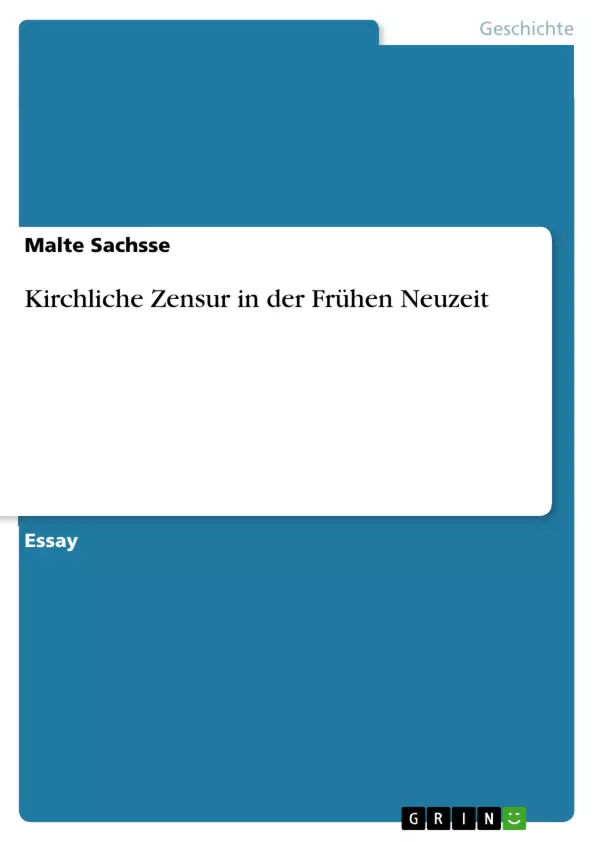Versuch eines kurzen historischen Überblicks über die Entwicklung des Römischen Index in der Frühen Neuzeit. Nach einer kurzen Darstellung der ideengeschichtlichen Vorraussetzungen der Buchzensur wird der Weg ihrer Institutionalisierung von der Inquisition über das Konzil von Trient bis zur Indexkongregation verfolgt.
Inhaltsverzeichnis
- I.) Einleitung
- II.) Die kirchliche Buchzensur bis zum Anfang des 17. Jh.
- 11.1. Voraussetzungen
- 11.2. Die Indices von Inquisition und Tridentinum
- 11.3. Die Indexkongregation
- III.) Die Arbeit der Kongregation bis zum Ende des 18. Jh.
- IV.) Schluss
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay bietet einen historischen Überblick über die Entwicklung des Römischen Index in der Frühen Neuzeit. Er verfolgt den Weg der Buchzensur von ihren ideengeschichtlichen Voraussetzungen über die Institutionalisierung durch die Inquisition und das Konzil von Trient bis zur Indexkongregation. Der Essay untersucht die Arbeit der Kongregation bis zum Ende des 18. Jahrhunderts und bewertet die Ergebnisse, bevor ein kurzer Ausblick auf das Ende des "Index Librorum Prohibitorum" gegeben wird.
- Die Entwicklung der Buchzensur von ihren Anfängen bis zur Indexkongregation
- Die Arbeit der Indexkongregation und ihre Rolle in der Kontrolle des Buchmarktes
- Die Auseinandersetzung der kirchlichen Zensur mit der weltlichen Souveränität
- Die Kritik an den kirchlichen Bücherverboten und ihre Auswirkungen
- Das Verhältnis von wissenschaftlicher Freiheit und kirchlichem Lehramt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Essay und seine Zielsetzung vor. Sie erläutert die ideengeschichtlichen Voraussetzungen der Buchzensur und skizziert den Weg ihrer Institutionalisierung. Die inhaltliche Schwerpunktsetzung auf das 16. Jahrhundert wird begründet, wobei die Bedeutung von Gegenreformation und Inquisition für die Zielvorstellungen der kirchlichen Zensur hervorgehoben wird.
Das zweite Kapitel behandelt die kirchliche Buchzensur bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts. Es beleuchtet die theologischen Grundlagen der Zensur, die Entwicklung von Verboten im Laufe der Geschichte und die Rolle der Inquisition und des Konzils von Trient bei der Institutionalisierung der Buchzensur.
Das dritte Kapitel widmet sich der Arbeit der Indexkongregation bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Es beschreibt die Gründung der Kongregation, ihre Verfahrensweise und die Herausforderungen, denen sie sich gegenüber sah. Die Entwicklung der Indices von Verbotslisten für protestantische und jüdische Schriften hin zu Listen vornehmlich katholischer Autoren wird beleuchtet. Die Diskussion um die Abgrenzung von Zuständigkeitsbereichen zwischen Inquisition und Indexkongregation sowie die Bedeutung der Reformversuche werden dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die kirchliche Buchzensur, den Römischen Index, die Indexkongregation, die Inquisition, das Konzil von Trient, die Gegenreformation, die Wissenskontrolle, die wissenschaftliche Freiheit und das kirchliche Lehramt. Der Text beleuchtet die Geschichte der Buchzensur in der Frühen Neuzeit und ihre Auswirkungen auf die Verbreitung von Wissen und die Entwicklung der Wissenschaften.
Häufig gestellte Fragen
Was war der "Index Librorum Prohibitorum"?
Es handelte sich um das offizielle Verzeichnis der für Katholiken verbotenen Bücher, das zur Kontrolle des Buchmarktes und der Wissensverbreitung diente.
Welche Rolle spielte die Indexkongregation?
Die Indexkongregation war die kirchliche Institution, die für die Prüfung von Schriften und die Aktualisierung des römischen Index verantwortlich war.
Wie entwickelte sich die Zensur von der Inquisition zum Konzil von Trient?
Der Text verfolgt den Weg der Institutionalisierung von frühen Verboten über die Inquisition bis hin zur systematischen Regelung durch das Tridentinum.
Ging es bei der Zensur nur um religiöse Schriften?
Nein, die Zensur weitete sich von protestantischen und jüdischen Schriften auch auf Werke katholischer Autoren und wissenschaftliche Texte aus.
Was thematisiert der Text bezüglich der wissenschaftlichen Freiheit?
Der Essay untersucht das Spannungsverhältnis zwischen der Kontrolle durch das kirchliche Lehramt und der aufkommenden Freiheit der Wissenschaften in der Frühen Neuzeit.
- Arbeit zitieren
- Malte Sachsse (Autor:in), 2006, Kirchliche Zensur in der Frühen Neuzeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/133850