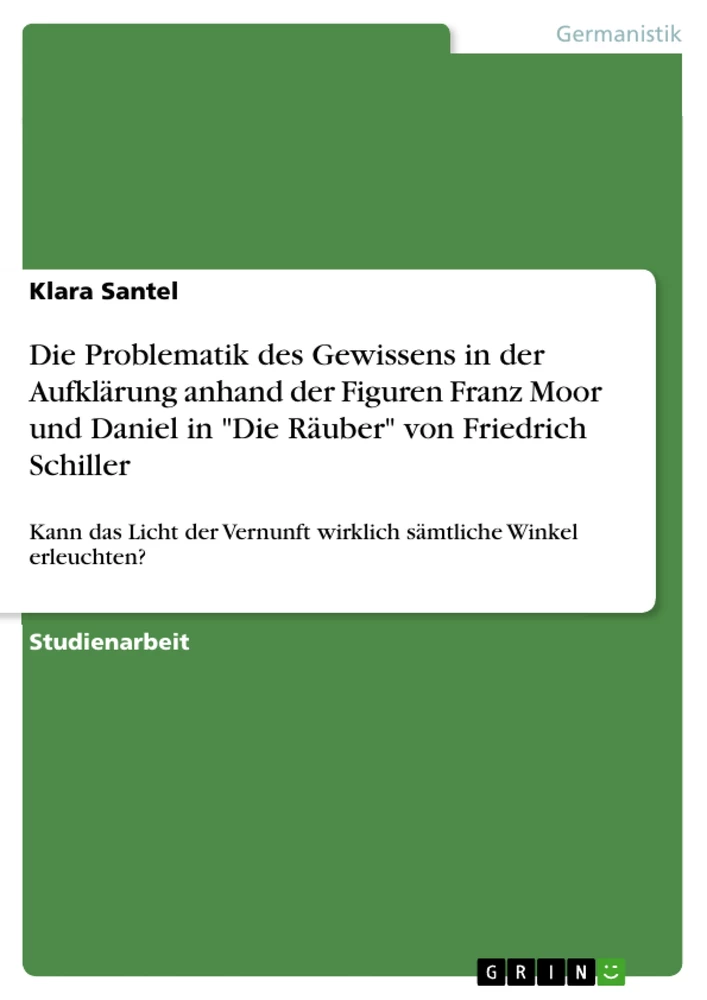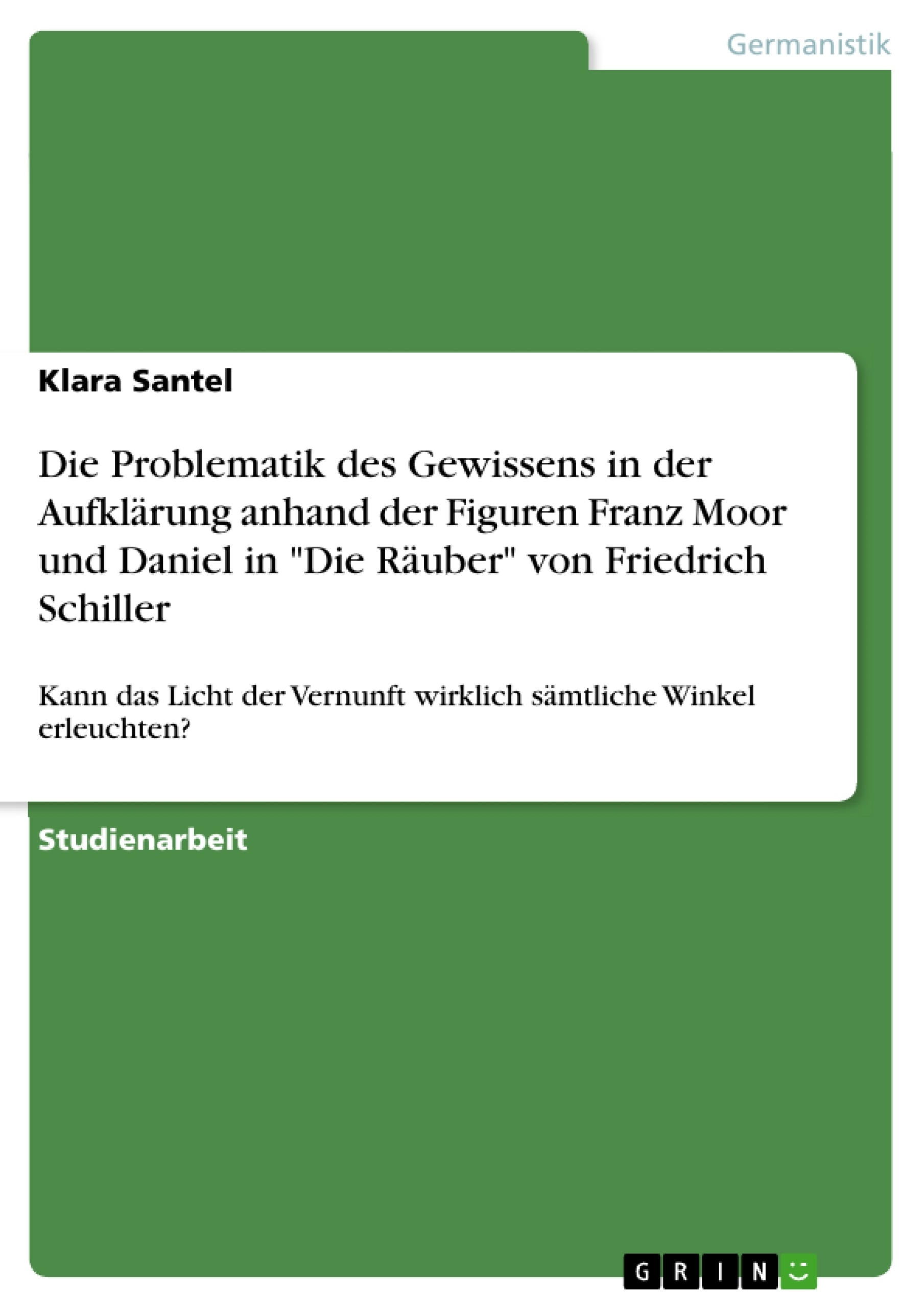Das Gewissen gilt bei Kant als „Flammenauge, das ins Innere blickt“. Das Innere des Menschen ist für die Aufklärer ein Raum, der durch das Licht der Vernunft ergründet werden kann. Der tugendhafte Mensch wägt seine Handlungen vorher nach eigenem Ermessen ab und ist auf keine zweite Person, wie auf seinen Vorgesetzten angewiesen. Überirdische Instanzen wie Gott und die Religion sind reiner Aberglauben und können das Leben in der Gesellschaft nicht weiter beeinflussen. Doch wie löst sich das Problem der unausweichlichen menschlichen Begrenztheit in Wissen und Erkenntnis sowie des Anspruchs der absoluten Willensfreiheit?
Vertreter des Sturm und Drangs halten dagegen, der Mensch handle nie nur vernünftig, sondern aufgrund seiner Gefühle, unbewusster Triebe oder auch Wünschen für die Zukunft. Was für eine Rolle spielt dabei das Gewissen und was geschieht, wenn man es auf reine Vernunft beschränkt? Friedrich Schiller greift diese Problematik in seinem ersten Drama Die Räuber auf und stattet dabei alle Figuren mit unterschiedlichen Gewissensvorstellungen aus. In diesem untersucht er die Folgen der Wechselwirkung von Seele und Körper, verweist auf die Ernsthaftigkeit der Religion und die Bedeutung des Unbewussten. Seiner idealisierten Vorstellung des Gewissens als ‚moralischer Sinn‘ und seiner Überzeugung der Liebesanthropologie stellt er den Bösewicht Franz Moor entgegen, welcher Gedanken der Aufklärung aufgreift und so verdreht, dass er am Ende zwei Morde rechtfertigen kann. Der fromme Diener Daniel hält trotz aufgeklärter Zeiten stark an Gott und seinem Glauben fest und richtet auch sein Gewissen danach aus – abergläubisch, würde ein aufgeklärter Bürger denken. Doch was bedeutet es, dass gerade und ausschließlich Figuren des unteren Standes mit diesem moralischen Sinn ausgestattet sind?
Diesbezüglich soll zunächst die generelle Veränderung des Gewissens in der Aufklärung dargelegt werden, bei der es besonders um Schillers eigene Auffassung und seine Philosophie im Allgemeinen geht. Diese wird in einem weiteren Schritt an seinen Räuberfiguren weiter analysiert und letztlich in Bezug auf seine Kritik an der Aufklärung vertieft. Wie inszeniert Schiller das Gewissen, wenn der langsamere Gang der Vernunft nicht hinterherkommt? Kann man wirklich von Schillers ‚Abrechnung mit der Aufklärung‘ sprechen?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Gewissen in der Aufklärung
- 3. Schiller und das Gewissen
- 4. Schillers Räuberfiguren im Gewissenskonflikt
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Problematik des Gewissens in der Aufklärung anhand der Figuren Franz Moor und Daniel in Friedrich Schillers "Die Räuber". Ziel ist es, Schillers Auseinandersetzung mit den Konzepten der Aufklärung und deren Auswirkungen auf das moralische Handeln zu analysieren.
- Das Gewissen in der Aufklärung und sein Wandel
- Schillers Philosophie und seine Auffassung des Gewissens
- Die Darstellung des Gewissenskonflikts bei den Räuberfiguren
- Schillers Kritik an der Aufklärung
- Die Rolle von Vernunft und Gefühl im moralischen Handeln
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Gewissens in der Aufklärung ein und stellt die zentrale Frage nach der Rolle der Vernunft und der Begrenztheit des menschlichen Wissens. Sie führt die Hauptfiguren Franz Moor und Daniel aus Schillers "Die Räuber" ein, deren gegensätzliche Gewissensvorstellungen im Mittelpunkt der Analyse stehen. Die Arbeit kündigt die folgenden Schritte an: die Darstellung des Wandels des Gewissensbegriffs in der Aufklärung, die Analyse von Schillers Philosophie des Gewissens und schließlich die Vertiefung der Analyse anhand der Figuren aus "Die Räuber".
2. Das Gewissen in der Aufklärung: Dieses Kapitel beschreibt den Wandel des Gewissensbegriffs während der Aufklärung. Es wird der Konflikt zwischen dem lustfeindlichen Gewissen, das sich an Normen orientiert, und den menschlichen Bedürfnissen und Gefühlen beleuchtet. Der Übergang vom religiös geprägten Gewissen, das göttliche Strafen fürchtet, hin zu einem Gewissen, das sich an gesellschaftlicher Verantwortung orientiert, wird detailliert dargestellt. Der Text erwähnt Kittsteiner's Konzept des "Gewissens als Gewitter" und dessen Transformation im Kontext der Aufklärung. Die Vorstellung der unendlichen Gnade Gottes wird mit der aufklärerischen Betonung von Tugend im Umgang mit moralischem Handeln verglichen.
3. Schiller und das Gewissen: Dieses Kapitel befasst sich mit Schillers Philosophie des Gewissens. Es thematisiert die Kritik an der einseitigen Betonung der Vernunft in der Aufklärung und hebt die Bedeutung von Gefühlen, Wünschen und dem Unbewussten im menschlichen Handeln hervor. Schillers anthropologischer Konflikt zwischen der idealen Willensfreiheit und den Grenzen des menschlichen Daseins wird als zentraler Aspekt seiner Gewissensphilosophie herausgestellt. Das Kapitel betont Schillers Fokus auf die „Gesamtheit aller Affekte“ des Menschen und die damit verbundenen Auswirkungen auf das Gewissen.
Schlüsselwörter
Gewissen, Aufklärung, Friedrich Schiller, Die Räuber, Franz Moor, Daniel, Vernunft, Gefühl, Moral, Anthropologie, Willensfreiheit, Sturm und Drang, Religion, Gesellschaftliche Verantwortung.
Häufig gestellte Fragen zu "Die Räuber" und das Gewissen in der Aufklärung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Problematik des Gewissens in der Aufklärung anhand der Figuren Franz Moor und Daniel in Friedrich Schillers Drama "Die Räuber". Im Mittelpunkt steht die Auseinandersetzung Schillers mit den Konzepten der Aufklärung und deren Auswirkungen auf das moralische Handeln der Figuren.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Wandel des Gewissensbegriffs in der Aufklärung, Schillers Philosophie des Gewissens, die Darstellung des Gewissenskonflikts bei den Räuberfiguren, Schillers Kritik an der Aufklärung und die Rolle von Vernunft und Gefühl im moralischen Handeln. Es wird der Konflikt zwischen einem lustfeindlichen, normorientierten Gewissen und menschlichen Bedürfnissen und Gefühlen beleuchtet, sowie der Übergang von einem religiös geprägten Gewissen zu einem, das sich an gesellschaftlicher Verantwortung orientiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, einem Kapitel über das Gewissen in der Aufklärung, einem Kapitel über Schillers Gewissensphilosophie, einem Kapitel über den Gewissenskonflikt bei den Räuberfiguren (Franz Moor und Daniel) und einem Fazit. Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Hauptfiguren vor. Das Kapitel zum Gewissen in der Aufklärung beschreibt dessen Wandel während dieser Epoche. Das Kapitel zu Schiller analysiert seine Philosophie des Gewissens, während das Kapitel zu den Räuberfiguren deren Gewissenskonflikte im Detail untersucht.
Wie wird Schillers Philosophie des Gewissens dargestellt?
Schillers Philosophie des Gewissens wird als kritische Auseinandersetzung mit der einseitigen Betonung der Vernunft in der Aufklärung dargestellt. Die Arbeit betont die Bedeutung von Gefühlen, Wünschen und dem Unbewussten im menschlichen Handeln und den anthropologischen Konflikt zwischen idealer Willensfreiheit und den Grenzen des menschlichen Daseins. Schillers Fokus auf die „Gesamtheit aller Affekte“ des Menschen und deren Auswirkungen auf das Gewissen wird hervorgehoben.
Welche Rolle spielen Vernunft und Gefühl?
Die Arbeit untersucht den Spannungsbogen zwischen Vernunft und Gefühl im moralischen Handeln. Sie analysiert, wie sich der Wandel des Gewissensbegriffs in der Aufklärung auf das Verhältnis von Vernunft und Gefühl auswirkt und wie Schiller diese Aspekte in seinen Figuren und deren Handlungsweisen darstellt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Gewissen, Aufklärung, Friedrich Schiller, Die Räuber, Franz Moor, Daniel, Vernunft, Gefühl, Moral, Anthropologie, Willensfreiheit, Sturm und Drang, Religion, Gesellschaftliche Verantwortung.
- Citation du texte
- Klara Santel (Auteur), 2020, Die Problematik des Gewissens in der Aufklärung anhand der Figuren Franz Moor und Daniel in "Die Räuber" von Friedrich Schiller, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1339300