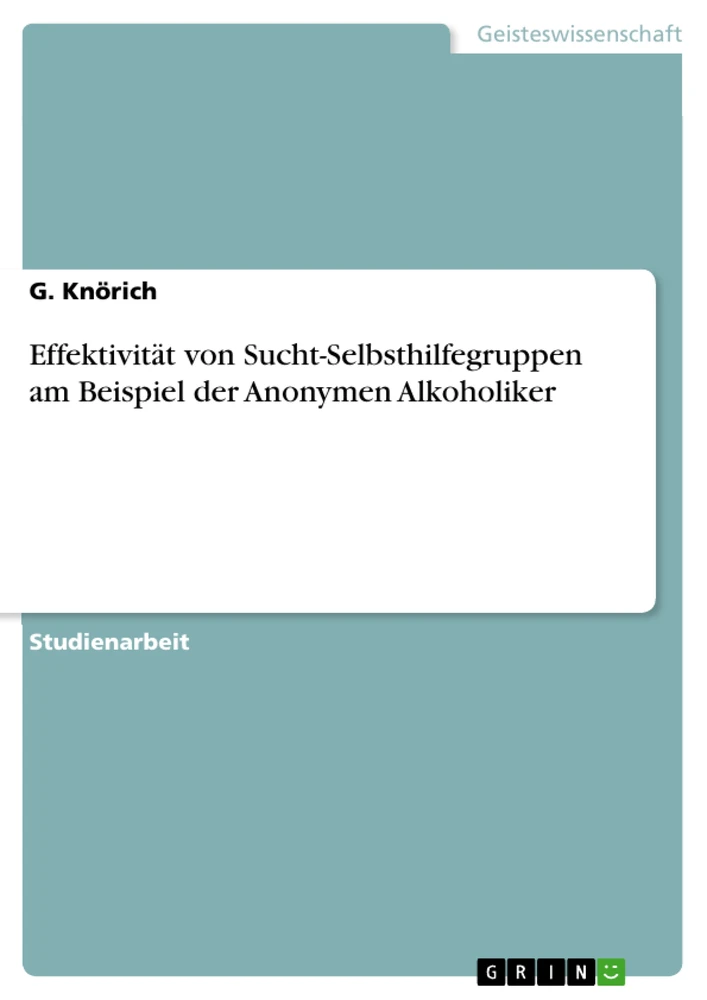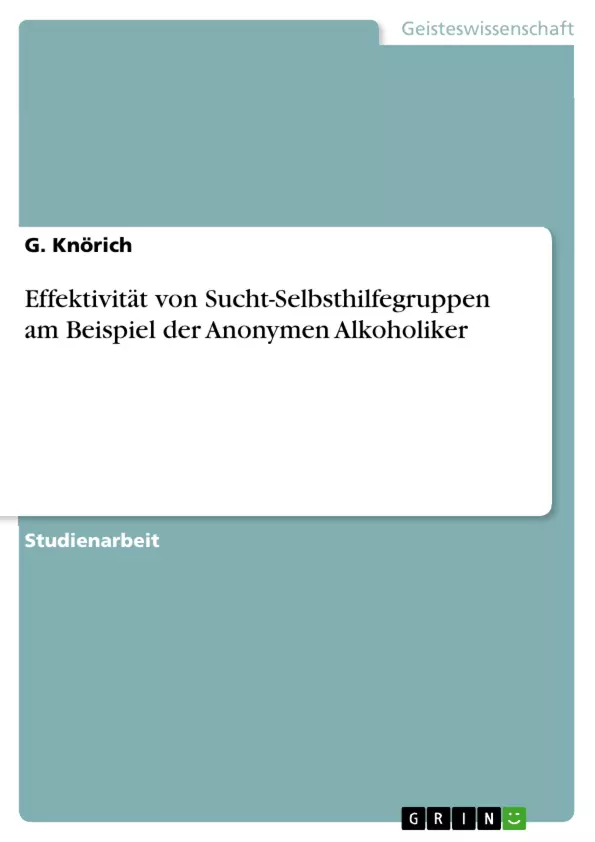Aufgrund der Unklarheit hinsichtlich der Effektivität von Selbsthilfegruppen, soll in der vorliegenden Arbeit die Effektivität von Sucht-Selbsthilfegruppen zur Besserung sucht-bezogener Probleme, anhand des Beispiels der Anonymen Alkoholiker (AA), untersucht werden. Im Verlauf der vorliegenden Arbeit wird zunächst der Begriff der Selbsthilfe erläutert und auf die verschiedenen Merkmale und Formen von Selbsthilfegruppen eingegangen. Im Anschluss folgt eine Beschreibung der AA sowie ihres Konzepts, wobei auf Charakteristiken der Meetings und das Zwölf-Schritte-Programm der AA eingegangen wird. Daraufhin werden aktuelle Studienergebnisse hinsichtlich der Effektivität und möglicher Wirkungsweisen der AA vorgestellt. Abschließend werden jene Studienergebnisse diskutiert und hinsichtlich ihrer Bedeutung für andere Selbsthilfegruppen und -bereiche bewertet sowie ein Ausblick auf zukünftige Forschung gegeben.
In Deutschland gibt es schätzungsweise 100.000 Selbsthilfegruppen für nahezu jeden gesundheitlichen und sozialen Bereich, mit insgesamt etwa 3,5 Millionen Mitgliedern. Diese Selbsthilfegruppen stellen dabei einen wichtigen Bestandteil der gesundheitlichen Versorgung in Deutschland dar. So gaben bei einer Befragung 9,1% der Befragten im Alter von 18 bis 79 Jahren an, bereits einmal an einer Selbsthilfegruppe teilgenommen zu haben. Empirische Studien zur Effektivität und Wirkungsweise gibt es sowohl im deutschsprachigen als auch internationalen Raum, jedoch nur sehr wenige. In bisherigen Studien zeigte sich zwar ein generell positives Bild zugunsten der Selbsthilfegruppen, jedoch sind viele Studienergebnisse aufgrund methodischer Schwächen von mangelnder Evidenz. Dieses Defizit an konkreten Forschungsergebnissen herrscht auch in dem Bereich sogenannter Sucht-Selbsthilfegruppen vor. Hierunter werden Selbsthilfegruppen verstanden, welche die Bewältigung von verschiedenen Abhängigkeiten und deren sucht-bezogener Probleme fokussieren und Betroffene unterstützen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Selbsthilfegruppen
- 2.1 Selbsthilfe
- 2.2 Merkmale und Formen von Selbsthilfegruppen
- 3 Anonyme Alkoholiker
- 3.1 Zentrale Aspekte der Anonymen Alkoholiker
- 3.1.1 Meetings
- 3.1.2 Das Zwölf-Schritte-Programm
- 3.2 Weitere Interaktionen und Aktivitäten
- 3.1 Zentrale Aspekte der Anonymen Alkoholiker
- 4 Effektivität und Wirkprinzip der AA
- 4.1 Wissenschaftliche Evidenz zur Effektivität
- 4.2 Mögliche Wirkprinzipien
- 5 Diskussion
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Effektivität von Sucht-Selbsthilfegruppen zur Besserung suchtbezogener Probleme am Beispiel der Anonymen Alkoholiker (AA). Die Arbeit analysiert die zentrale Rolle von Selbsthilfegruppen im deutschen Gesundheitswesen und beleuchtet die Herausforderungen, die sich aus der begrenzten wissenschaftlichen Evidenz für die Effektivität dieser Gruppen ergeben.
- Die Bedeutung von Selbsthilfegruppen in der Gesundheitsversorgung
- Die Herausforderungen der Effektivitätsforschung im Kontext von Selbsthilfegruppen
- Die Struktur und Funktionsweise der Anonymen Alkoholiker (AA)
- Wissenschaftliche Evidenz zur Effektivität der AA
- Mögliche Wirkprinzipien der AA
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung von Selbsthilfegruppen im deutschen Gesundheitswesen und hebt die Notwendigkeit einer wissenschaftlichen Untersuchung ihrer Effektivität hervor. Kapitel 2 führt in den Begriff der Selbsthilfe ein und beschreibt die verschiedenen Formen und Merkmale von Selbsthilfegruppen. Kapitel 3 präsentiert die Anonymen Alkoholiker (AA) und erläutert ihre zentralen Aspekte, wie Meetings und das Zwölf-Schritte-Programm. Kapitel 4 untersucht die wissenschaftliche Evidenz zur Effektivität der AA und diskutiert mögliche Wirkprinzipien.
Schlüsselwörter
Sucht-Selbsthilfegruppen, Anonyme Alkoholiker, Effektivität, Wirkprinzipien, Zwölf-Schritte-Programm, Wissenschaftliche Evidenz, Gesundheitsversorgung, Selbsthilfe, Selbsthilfeorganisationen.
- Citation du texte
- G. Knörich (Auteur), 2023, Effektivität von Sucht-Selbsthilfegruppen am Beispiel der Anonymen Alkoholiker, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1339731