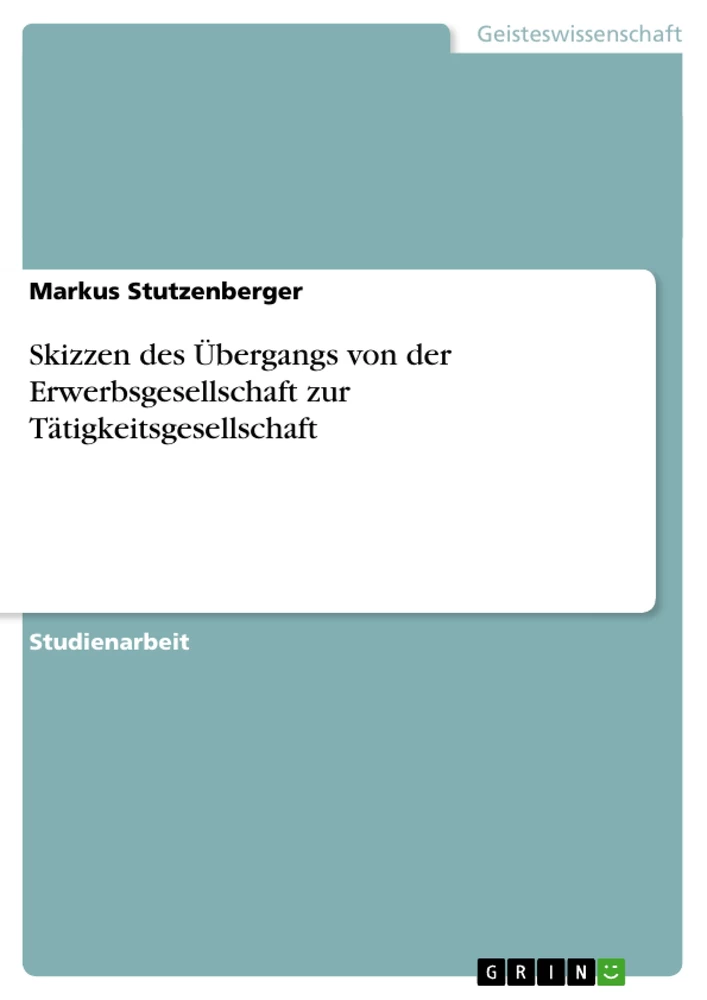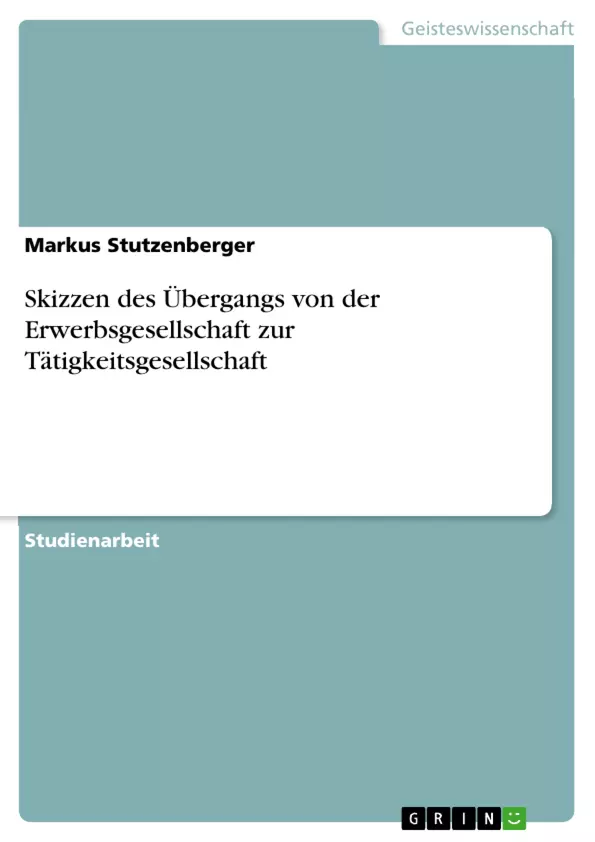"Visionen für die Arbeitsgesellschaft von morgen" - davon gibt es viele. Das gewaltige und in seiner sozialen Sprengkraft kaum überschätzbare Problem einer sich nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland seit 25 Jahren zunehmend verfestigten Sockelarbeitslosigkeit braucht aber mehr als Denkmodelle und Visionen. Diese waren notwendig und brauchten ihre Zeit, um von Menschen mit politischer und sozialer Phantasie entwickelt zu werden. Doch muß sich der am politisch-sozialen Diskurs Beteiligte verantworten vor einer nicht unbegrenzt zur Verfügung stehenden Zeit, vor Menschen, die unter nichts mehr leiden als unter der bekümmernden Realität, keine Arbeit (mehr) zu haben. „Alles hat seine Stunde, ... eine bestimmte Zeit“, wie uns der griechische Weisheitslehrer Kohelet zu ermahnen weiß. So können eine planvolle und zielgerichtete Evaluation der maßgeblichen Ausgangslage eines Problems und die entwickelten, theoretisch denkbaren Lösungsstrategien auch in ihrer Unvollständigkeit nicht davon dispensieren, allmählich in eine pragmatische Phase überzugehen. Dies gebietet zum einen die zunehmende Bedrängnis, in die der Sozialstaat durch steigende Erwerbslosenzahlen geraten ist, dann die Angst jedes Menschen, der abhängig beschäftigt ist, davor, arbeitslos zu werden und die generationsübergreifenden Folgen, die eine Gesellschaft unter dem bedrückenden Vorzeichen anhaltender Dauerarbeitslosigkeit zu erwarten hat. Aufbrüche in eine neue Arbeitswelt, die der wirtschaftlichen wie demographischen Realität näherkommen unter der Berücksichtigung dynamischer familiärer und familienähnlicher Lebensformen, sie wollen einerseits gut überlegt sein, andererseits wird erst die Konfrontation mit der Realität zeigen, wie nachhaltig sie dazu beitragen, Arbeitslosigkeit zu vermindern. Der Blick in andere europäische Länder, nach Dänemark, in die Niederlande oder auch nach Irland kann helfen, an Erfahrungen mit einzelnen Projekten zu partizipieren.
Inhaltsverzeichnis
- Exposition
- Armut und Arbeitslosigkeit: Die „verdeckte Armut\" der (wiedervereinigten) Bundesrepublik Deutschland 1983-1990 (1991 & 1995) 'working poor' in der
- Von Strukturmodellen zu konkreten Initiativen zur Abschmelzung von verfestigter Dauer- und Sockelarbeitslosigkeit in der BRD
- „Bürgergeld“ und „negative Einkommensteuer\" als grundlegendes Element einer pecuniären Grund(ab)sicherung und eines sozialstrukturellen Wandels
- Das sog. „Mainzer Modell- Wege aus dem Mißbrauch geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse
- Monetäre und nichtmonetäre Formen der Anerkennung von gemeinnütziger Arbeit
- Das „Sero-System\" der Abfallwirtschaft in der ehemaligen DDR: Nachhaltigkeit als Prinzip ökologisch- bewußter Zukunftsgestaltung und Quelle neuer Arbeitsplätze
- Die unverändert hohen Ressourcen gesellschaftlichen Engagements in der BRD: Eine gesellschaftlich unterschätzte und oft verkannte Größe
- Epilog
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema der Arbeitslosigkeit aus sozial- und ökonomischer Sicht und untersucht den Übergang von der Erwerbsgesellschaft zur Tätigkeitsgesellschaft. Sie analysiert ausgewählte Modelle zur Futurologie der Arbeit und befasst sich insbesondere mit der Frage, wie Arbeitslosigkeit dauerhaft und nachhaltig reduziert werden kann.
- Die Herausforderungen der verfestigten Sockelarbeitslosigkeit in der Bundesrepublik Deutschland
- Analyse verschiedener Modelle zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit, wie z.B. „Bürgergeld“ und „negative Einkommensteuer“
- Die Bedeutung von gemeinnütziger Arbeit und ökologischer Nachhaltigkeit für die Schaffung neuer Arbeitsplätze
- Die Rolle des christlichen Glaubens und der Verantwortung des Einzelnen im Kontext der Arbeitslosigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Exposition: Die Einleitung stellt das Problem der Arbeitslosigkeit in den Kontext der deutschen Sozial- und Wirtschaftspolitik und betont die Notwendigkeit, pragmatische Lösungen zu finden.
- Armut und Arbeitslosigkeit: Dieses Kapitel untersucht das Phänomen der „verdeckten Armut“ von Erwerbstätigen (working poor) in der Bundesrepublik Deutschland und beleuchtet die spezifischen Herausforderungen dieser Personengruppe.
- Von Strukturmodellen zu konkreten Initiativen: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Modelle und Initiativen zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit, z.B. „Bürgergeld“ und „negative Einkommensteuer“, sowie die Anerkennung von gemeinnütziger Arbeit.
- Die unverändert hohen Ressourcen gesellschaftlichen Engagements: Dieses Kapitel stellt die Bedeutung von gesellschaftlichem Engagement für die Bewältigung der Herausforderungen der Arbeitslosigkeit heraus.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind Arbeitslosigkeit, Sockelarbeitslosigkeit, Erwerbsgesellschaft, Tätigkeitsgesellschaft, Bürgergeld, negative Einkommensteuer, gemeinnützige Arbeit, Nachhaltigkeit, ökologische Steuerreform, Sozialethik, christlicher Glaube.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Erwerbs- und Tätigkeitsgesellschaft?
In der Erwerbsgesellschaft definiert sich der Mensch primär über bezahlte Arbeit. Die Tätigkeitsgesellschaft erkennt auch gemeinnützige, familiäre und ökologische Arbeit als wertvolle Beiträge an.
Was versteht man unter „verfestigter Sockelarbeitslosigkeit“?
Damit wird der Teil der Arbeitslosigkeit bezeichnet, der auch bei wirtschaftlichem Aufschwung nicht abgebaut wird und über Jahrzehnte hinweg konstant bleibt.
Wie funktioniert das Konzept der „negativen Einkommensteuer“?
Es ist ein Modell der Grundsicherung, bei dem Personen unterhalb einer Einkommensgrenze keine Steuern zahlen, sondern eine staatliche Transferzahlung erhalten.
Was war das „Sero-System“ der DDR?
Das Sekundärrohstoff-System war ein effektives Recyclingmodell, das heute als frühes Beispiel für ökologische Nachhaltigkeit und die Schaffung grüner Arbeitsplätze gilt.
Was bedeutet der Begriff „Working Poor“?
Es bezeichnet Erwerbstätige, deren Einkommen trotz Vollzeitarbeit unter der Armutsgrenze liegt, was oft als „verdeckte Armut“ bezeichnet wird.
- Quote paper
- Markus Stutzenberger (Author), 1999, Skizzen des Übergangs von der Erwerbsgesellschaft zur Tätigkeitsgesellschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13401