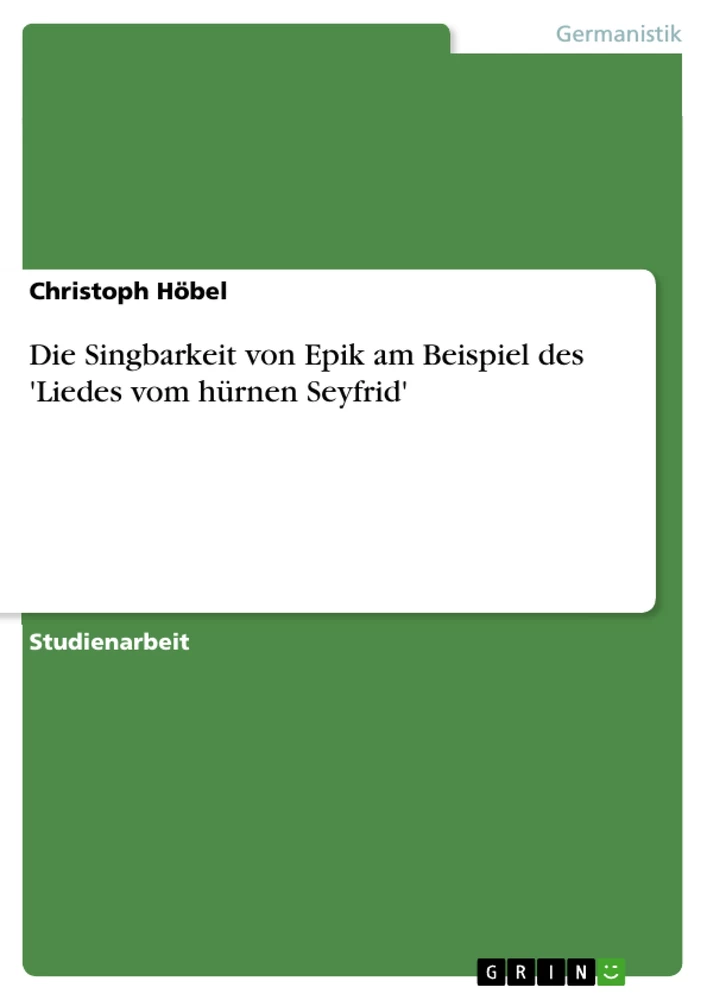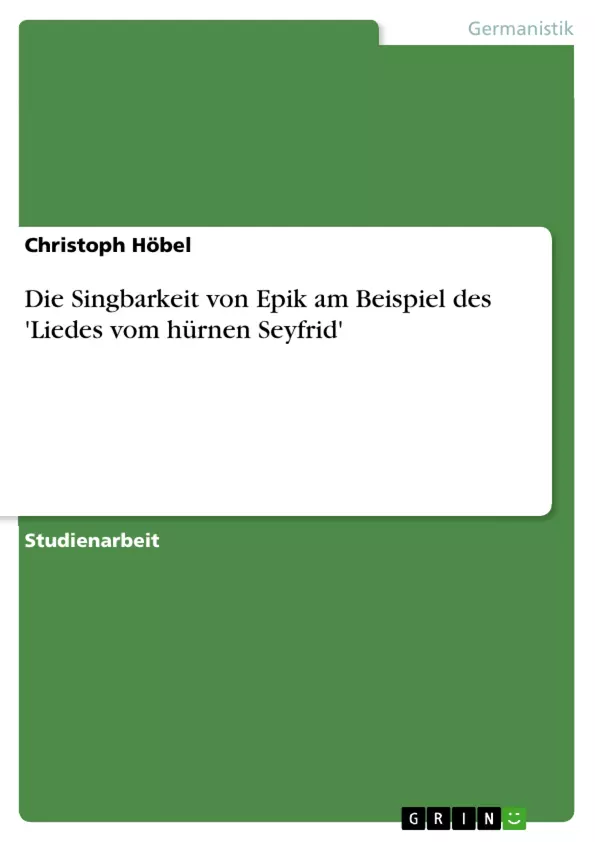„Hierinn findt jr ein schönes Lied“ , so lautet der erste Vers des Titels des Heldenepos‚ ‚Das Lied vom hürnen Seyfrid’. In meiner Freizeit beschäftige ich mich mit Musik, singe gerne und bin durch moderne Neufassungen von Stücken Walthers von der Vogelweide der Band ‚In Extremo’ auch mit mittelhochdeutscher Dichtung in Berührung gekommen. Auch sang ich bei einer Aufführung der Vertonung der ‚Carmina Burana’ von Carl Orff, aufgeführt vom Chor der Universität Trier, als Tenor mit. Auf anderem Weg kam ich mit mittelalterlicher Musik in Kontakt, als ich in der mündlichen Abiturprüfung in Musik die Buchmalereien zum Beispiel des Walthers von der Vogelweide oder des Tannhäusers in der Manessischen Liederhandschrift – dem Codex Manesse – als Prüfungsthema hatte. Deshalb finde ich das Thema der Epenmelodien im Rahmen des Proseminars ‚Einführung in die deutsche Literatur des Mittelalters’ interessant.
Die Verwendung des Begriffs ‚Lied’ im Titel zum ‚Lied des hürnen Seyfrid’ führt zu der Frage, ob Heldenepen des Mittelalters gesungen wurden – zur Frage nach der Singbarkeit von Epik. Walther Lipphardt schreibt hierzu: „um unser Wissen, ob epische Dichtungen des Mittelalters wirklich gesungen wurden, ist es noch schlecht bestellt“ . Diese Arbeit versucht anhand der Ausführungen mehrerer Autoren die These des gesungenen Vortrags der Heldenepen zu untermauern. Dabei stütze ich mich auf folgende Aufsätze: ‚Epenmelodien’ und ‚Strukturprobleme der Epenmelodien’ von Horst Brunner, ‚Zum sanglichen Vortrag mhd. strophischer Epen’ von Karl H. Bertau und Rudolf Stephan, ‚Das mittelalterliche Epos und die Musik’ von Ewald Jammers und ‚Epische Liedweisen des Mittelalters in schriftlicher Überlieferung’ von Walther Lipphardt.
Weiter wird anhand von Beispielen einiger überlieferter Strophenformen der Zusammenhang zwischen Text und Melodie beziehungsweise der Strophenstruktur beleuchtet und die Entwicklung der Strophenformen, aus denen neue Strophenformen entstanden, beschrieben. Dies geschieht durch die Betrachtung des ältesten überlieferten Heldenepos ‚Das Nibelungenlied’, das leider ohne Melodie überliefert ist. Es wird der Versuch unternommen, anhand der Textstruktur und von Vergleichen mit ähnlichen Strophenformen Anhaltspunkte für eine Rekonstruktion der Melodie zu sammeln. Schließlich werden die Beziehungen zwischen dem Text des ‚Lieds vom hürnen Seyfrid’ und der Melodie des in ihm zu verwendenden ‚Hildebrandstons’ herausgearbeitet.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wurden Heldenepen gesungen?
- Das Verhältnis zwischen Melodie und Text
- Das Nibelungenlied
- Der Hildebrandston
- Die Heunenweise
- Der Berner-Ton
- Der Herzog-Ernst-Ton
- Vom „Hürnen Seyfrid“ und dem „Hiltebrandes thon“
- Der Titel
- Melodie und Text
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Singbarkeit von mittelhochdeutschen Heldenepen, insbesondere am Beispiel des „Lied vom hürnen Seyfrid“. Die Hauptzielsetzung ist es, die These des gesungenen Vortrags von Heldenepen anhand verschiedener literaturwissenschaftlicher und musikwissenschaftlicher Quellen zu belegen und zu analysieren, wie der Text mit der Melodie interagiert.
- Singbarkeit mittelhochdeutscher Heldenepen
- Zusammenhang zwischen Text und Melodie in epischen Dichtungen
- Analyse überlieferter Melodien und Strophenformen
- Rekonstruktion möglicher Melodien anhand von Textstrukturen
- Der „Hildebrandston“ und seine Bedeutung für das „Lied vom hürnen Seyfrid“
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Singbarkeit von Epik ein und begründet die Relevanz der Forschungsfrage anhand der persönlichen Erfahrungen des Autors mit Musik und mittelhochdeutscher Literatur. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Singbarkeit von Heldenepen und benennt die wichtigsten Quellen, auf die sich die Arbeit stützt, darunter Aufsätze von Horst Brunner, Karl H. Bertau, Rudolf Stephan, Ewald Jammers und Walther Lipphardt. Der Titel des „Lied vom hürnen Seyfrid“ mit der Formulierung „Lied“ wird als Ausgangspunkt der Untersuchung der Frage nach der Singbarkeit von Epik im Mittelalter verwendet.
Wurden Heldenepen gesungen?: Dieses Kapitel diskutiert die Frage nach dem gesungenen Vortrag von mittelhochdeutschen Heldenepen. Es werden Argumente sowohl für als auch gegen die These des gesungenen Vortrags präsentiert. Gegenargumente beziehen sich auf gelegentliche Strophenenjambemente und die angenommene Länge der Epen. Proargumente beruhen auf historischen Zeugnissen aus der Antike, auf altfranzösischen Chansons de geste, dem homerischen Epos und dem finnischen Kalevala. Besonders wichtig ist die Erwähnung von Textstellen in den Epen selbst, die auf einen gesungenen Vortrag hinweisen, sowie die Existenz überlieferter Melodien. Die Veränderung von "singen" zu "sprechen" in Handschriften des 15. und 16. Jahrhunderts wird als Indiz für einen Wandel im Vortrag interpretiert, der durch die Verbreitung des Buchdrucks beeinflusst wurde.
Schlüsselwörter
Heldenepen, mittelhochdeutsch, Singbarkeit, Melodie, Text, Strophenform, Hildebrandston, Nibelungenlied, Lied vom hürnen Seyfrid, Epenmelodien, mittelalterliche Musik, Rezitativgesang.
Häufig gestellte Fragen zum "Lied vom hürnen Seyfrid"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die Singbarkeit mittelhochdeutscher Heldenepen, insbesondere am Beispiel des "Lied vom hürnen Seyfrid". Sie analysiert den Zusammenhang zwischen Text und Melodie in solchen Epen und versucht, die These eines gesungenen Vortrags zu belegen.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wurden mittelhochdeutsche Heldenepen gesungen? Die Arbeit untersucht dies anhand verschiedener Aspekte: die Interaktion von Text und Melodie, die Existenz überlieferter Melodien, historische Zeugnisse und Hinweise im Text selbst.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf literaturwissenschaftliche und musikwissenschaftliche Quellen. Genannt werden unter anderem Aufsätze von Horst Brunner, Karl H. Bertau, Rudolf Stephan, Ewald Jammers und Walther Lipphardt. Sie bezieht sich auch auf Beispiele aus der Antike (Homerisches Epos), der altfranzösischen Literatur (Chansons de geste) und dem finnischen Kalevala.
Welche Melodien werden im Detail betrachtet?
Die Arbeit analysiert den "Hildebrandston" und seine mögliche Bedeutung für das "Lied vom hürnen Seyfrid". Weitere Melodien und Strophenformen, wie der Nibelungenlied-Ton, der Heunenweise, der Berner-Ton und der Herzog-Ernst-Ton, werden im Zusammenhang mit der allgemeinen Frage der Singbarkeit von Epen erwähnt.
Wie wird die These des gesungenen Vortrags belegt?
Die Arbeit präsentiert Argumente für und gegen die These des gesungenen Vortrags. Pro-Argumente basieren auf historischen Zeugnissen, Parallelen zu anderen Epen und Hinweisen im Text selbst. Gegenargumente beziehen sich auf mögliche Probleme der Länge der Epen und gelegentlicher Strophenenjambemente. Die Veränderung von "singen" zu "sprechen" in späteren Handschriften wird als Indiz für einen Wandel im Vortrag interpretiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zur Frage des gesungenen Vortrags von Heldenepen, ein Kapitel zur Beziehung zwischen Melodie und Text mit Beispielen verschiedener Melodien, ein Kapitel zum "Lied vom hürnen Seyfrid" und einen Schluss. Der Titel des Werkes ("Lied vom hürnen Seyfrid") wird als Ausgangspunkt der Untersuchung der Singbarkeit von Epen im Mittelalter verwendet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Heldenepen, mittelhochdeutsch, Singbarkeit, Melodie, Text, Strophenform, Hildebrandston, Nibelungenlied, Lied vom hürnen Seyfrid, Epenmelodien, mittelalterliche Musik, Rezitativgesang.
- Citar trabajo
- Christoph Höbel (Autor), 2003, Die Singbarkeit von Epik am Beispiel des 'Liedes vom hürnen Seyfrid', Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/134013