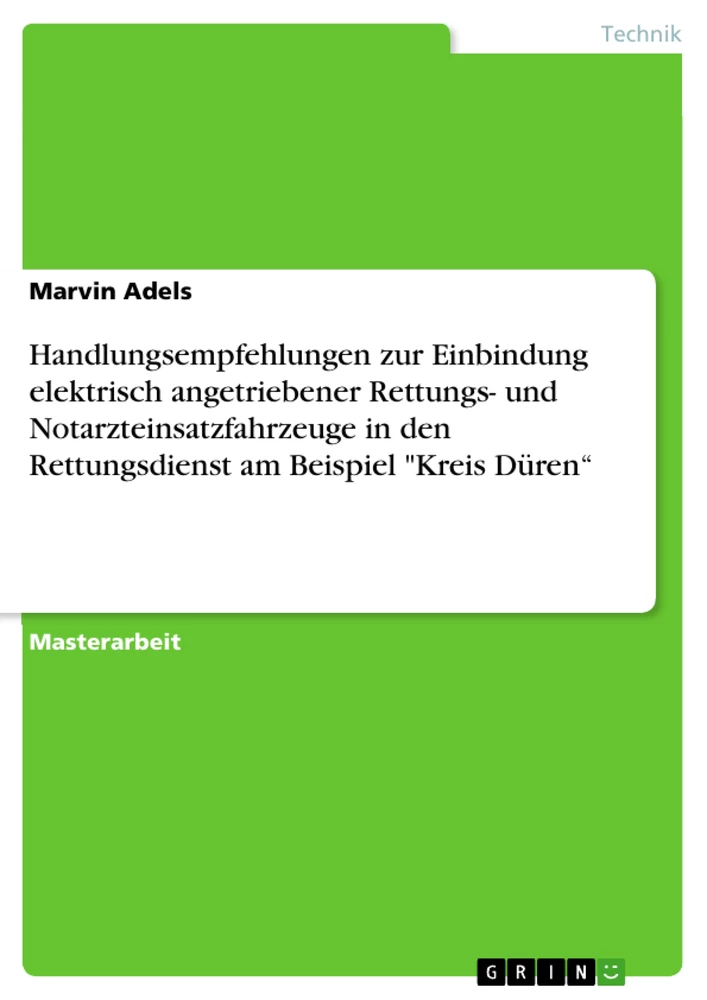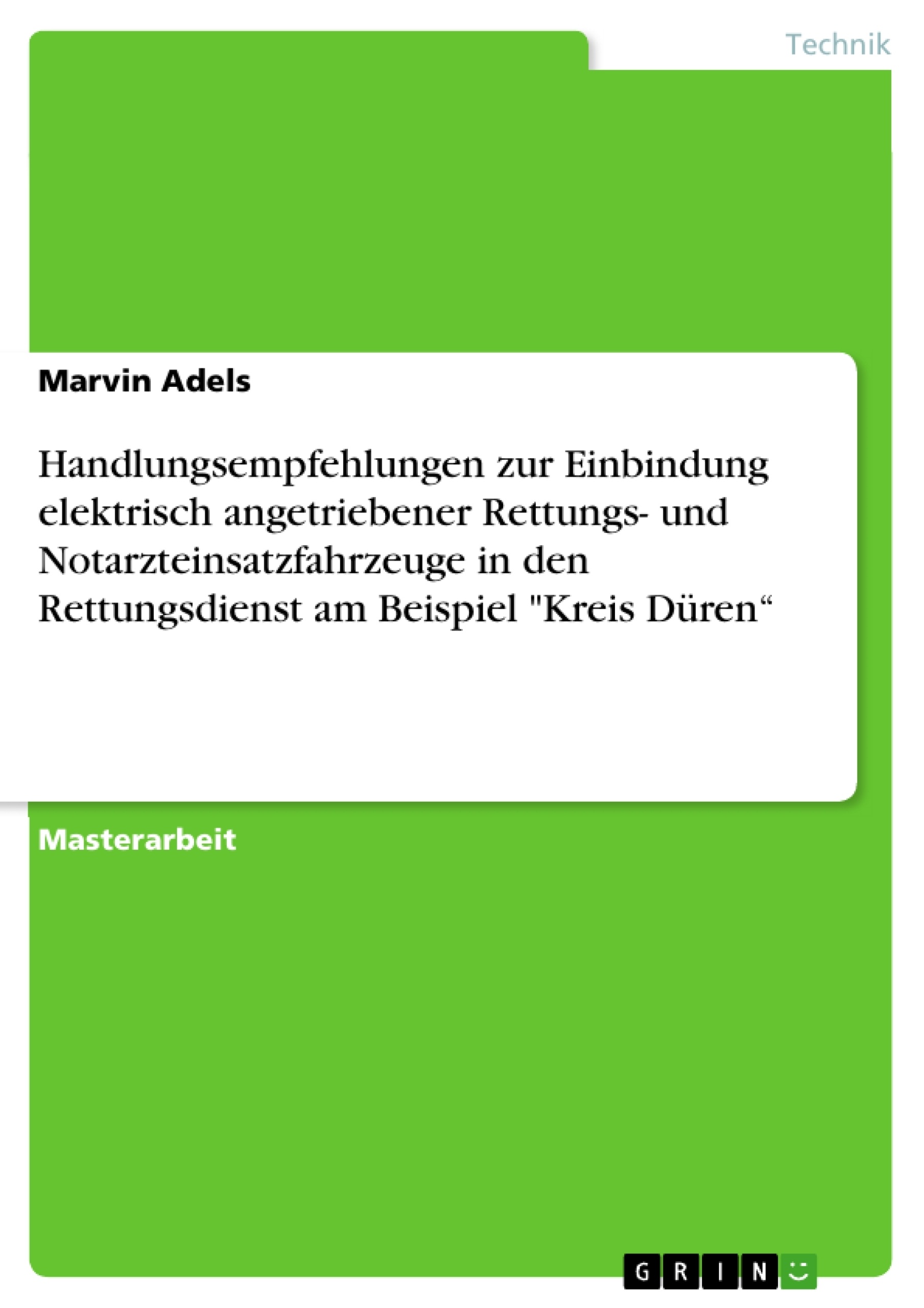Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den technologischen, aber auch den einsatztaktischen Rahmenbedingungen zur Einbindung elektrisch angetriebener Rettungsfahrzeuge in ein städtisches, aber auch ein ländlich geprägtes Umfeld. Hierzu werden zunächst allgemeine Handlungsempfehlungen zur Ladeinfrastruktur im Rettungsdienst, zur einsatztaktischen Alarmierung elektrifizierter Rettungsmittel und zur Realisierung elektrisch angetriebener Rettungsmittel im Regelrettungsdienst formuliert. Der bedarfsgerechte Aufbau von Ladeinfrastrukturen und die Alarmierungsempfehlung nimmt eine Schlüsselrolle für den erfolgreichen Wechsel hin zu Elektrofahrzeugen ein.
Um eine praktische Grundlage zu schaffen, wurden im Teil der Untersuchung der vorliegenden Arbeit verschiedene quantitative Sekundärdaten aus der Rettungsleitstelle auswertetet, analysiert und entsprechend aufbereitet. Die Arbeit schließt mit der Übertragung der theoretisch gebildeten Handlungsempfehlungen, in Beziehung mit den Ergebnissen der Datenerhebung- und Auswertung, auf den Rettungsdienst im Kreis Düren ab.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- Summary
- Inhaltsverzeichnis
- Gender Erklärung
- Danksagung
- 1. Einleitung
- 1.1. Bedeutung, Motivation und Problemstellung
- 1.2. Zielsetzung der Arbeit
- 1.3. Wissenschaftliche Methodik der systematischen Literaturanalyse
- 1.3.1. Literaturanalyse nach Webster
- 1.3.2. Quantitative Forschung
- 1.4. Aufbau der Arbeit
- 2. Begriffsdefinitionen
- 2.1. Rettungsdienst
- 2.2. Elektromobilität
- 3. Theoretische Grundlagen
- 3.1. E-Rettungswagen (eRTW)
- 3.1.1. Aufbau
- 3.1.2. Antriebs- und Stromkonzept
- 3.2. E-Notarzteinsatzfahrzeug (eNEF)
- 3.2.1. Aufbau
- 3.2.2. Antriebs- und Stromkonzept
- 3.3. Ladeinfrastruktur und -systeme
- 3.4. Rettungsdienstorganisation
- 3.4.1. Einsatzorganisation
- 3.4.2. Bedarfsplanung
- 4. Übertragbare Handlungsempfehlungen
- 4.1. Herleitung der Handlungsempfehlungen
- 4.2. Handlungsfeld 1: Standortempfehlungen für Ladesäulen
- 4.2.1. Funktion und Adressat des Handlungsfeldes
- 4.2.2. Handlungsempfehlungen
- 4.3. Handlungsfeld 2: Alarmierungsempfehlung für die Leitstelle
- 4.3.1. Funktion und Adressat des Handlungsfeldes
- 4.3.2. Handlungsempfehlungen
- 4.4. Handlungsfeld 3: Realisierung von elektrischen Rettungsfahrzeugen im Regelrettungsdienst
- 4.4.1. Funktion und Adressat des Handlungsfeldes
- 4.4.2. Handlungsempfehlungen
- 4.5. Übertragbarkeit der Handlungsempfehlungen
- 5. Rettungsdienststruktur des Kreises Düren
- 5.1. Bedarfsplanung
- 5.2. Regelrettungsdienst
- 5.3. Einsatzstatistik
- 5.4. Leitstellenmanagement
- 6. Untersuchung am Fall Kreis Düren
- 6.1. Datenerfassung aus dem Einsatzleitsystem
- 6.2. Methodik der Untersuchung
- 6.3. Auswertung der Daten
- 7. Ergebnisse aus der Untersuchung
- 7.1. Rettungsdienst in einer städtischen Umgebung
- 7.2. Rettungsdienst in einer ländlichen Umgebung
- 7.3. Diskussion der umgebungsspezifischen Auslastung
- 7.4. Übertragbarkeit der Handlungsempfehlungen
- 8. Schlussbetrachtung
- 8.1. Ergebnisse der vorliegenden Arbeit
- 8.2. Kritische Würdigung
- 8.3. Ausblick
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit befasst sich mit der Integration von elektrisch angetriebenen Rettungs- und Notarzteinsatzfahrzeugen in den Rettungsdienst, wobei der Fokus auf den Kreis Düren liegt. Das Hauptziel ist es, Handlungsempfehlungen für die Einführung dieser Fahrzeuge zu entwickeln und deren Übertragbarkeit auf den Kreis Düren zu untersuchen.
- Analyse der technologischen Rahmenbedingungen für den Einsatz von E-Rettungsfahrzeugen
- Entwicklung von Handlungsempfehlungen für die Ladeinfrastruktur im Rettungsdienst
- Untersuchung der einsatztaktischen Anforderungen an die Alarmierung von E-Rettungsfahrzeugen
- Bewertung der Realisierungsmöglichkeiten von E-Rettungsfahrzeugen im Regelrettungsdienst
- Übertragung der entwickelten Handlungsempfehlungen auf die spezifische Situation im Kreis Düren
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die Bedeutung und Motivation der Arbeit sowie die Problemstellung der Integration von E-Rettungsfahrzeugen. Es werden die Zielsetzung der Arbeit und die angewandte wissenschaftliche Methodik vorgestellt.
Im zweiten Kapitel werden die Begriffe Rettungsdienst und Elektromobilität definiert.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit den theoretischen Grundlagen. Es werden die Aufbau und Funktionsweise von E-Rettungswagen und E-Notarzteinsatzfahrzeugen sowie die Ladeinfrastruktur und -systeme beschrieben.
Kapitel 4 stellt übertragbare Handlungsempfehlungen vor, die auf der Grundlage der theoretischen Grundlagen entwickelt wurden. Es werden Empfehlungen für die Standortempfehlungen für Ladesäulen, die Alarmierungsempfehlung für die Leitstelle und die Realisierung von E-Rettungsfahrzeugen im Regelrettungsdienst gegeben.
Kapitel 5 präsentiert die Rettungsdienststruktur des Kreises Düren, inklusive Bedarfsplanung, Regelrettungsdienst, Einsatzstatistik und Leitstellenmanagement.
Kapitel 6 beschreibt die Untersuchung am Fall Kreis Düren. Es werden die Datenerfassung aus dem Einsatzleitsystem, die Methodik der Untersuchung und die Auswertung der Daten dargestellt.
Kapitel 7 präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung. Die Ergebnisse werden in Bezug auf den Rettungsdienst in einer städtischen und ländlichen Umgebung sowie die umgebungsspezifische Auslastung diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen Rettungsdienst, Elektromobilität, Einsatzmanagement und -planung, Ladeinfrastrukturplanung und kommunale Nachhaltigkeitsstrategie. Im Fokus stehen die technologischen und einsatztaktischen Herausforderungen bei der Integration von E-Rettungsfahrzeugen in den Rettungsdienst.
Häufig gestellte Fragen
Können Elektrofahrzeuge im regulären Rettungsdienst eingesetzt werden?
Ja, die Arbeit untersucht die technologischen und einsatztaktischen Rahmenbedingungen für den Einsatz von E-Rettungswagen (eRTW) und E-Notarzteinsatzfahrzeugen (eNEF).
Warum ist der Kreis Düren als Fallbeispiel relevant?
Der Kreis Düren bietet sowohl städtische als auch ländliche Umgebungen, wodurch die Übertragbarkeit der Handlungsempfehlungen auf unterschiedliche Einsatzgebiete geprüft werden kann.
Welche Rolle spielt die Ladeinfrastruktur?
Ein bedarfsgerechter Aufbau von Ladesäulen an strategischen Standorten ist eine Schlüsselrolle für den erfolgreichen Wechsel hin zu Elektrofahrzeugen im Rettungsdienst.
Wie ändert sich die Alarmierung bei E-Fahrzeugen?
Die Leitstelle muss bei der Alarmierung Faktoren wie den Ladestand und die Reichweite berücksichtigen, wofür die Arbeit spezifische Empfehlungen liefert.
Welche Daten wurden für die Untersuchung ausgewertet?
Es wurden quantitative Sekundärdaten aus dem Einsatzleitsystem der Rettungsleitstelle analysiert, um die reale Auslastung und Anforderungen abzubilden.
- Citation du texte
- Marvin Adels (Auteur), 2022, Handlungsempfehlungen zur Einbindung elektrisch angetriebener Rettungs- und Notarzteinsatzfahrzeuge in den Rettungsdienst am Beispiel "Kreis Düren“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1340941