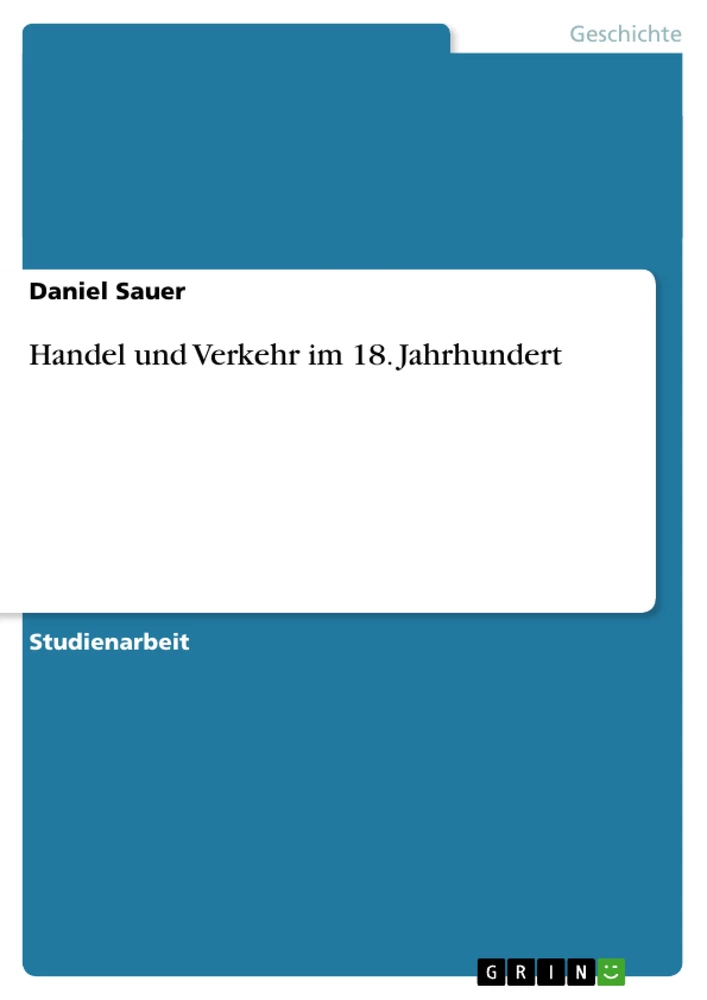Die vorliegende Seminararbeit beschäftigt sich mit dem Handel und dem Verkehr des 18. Jahrhunderts. Einführend in diese zwei Teilbereiche, soll mit der Darstellung des Merkantilismus zunächst die Wirtschaftspolitik der damaligen Zeit erläutert werden, da sie, vor allem für die Abwicklung des Außenhandels, von großer Bedeutung war.
In den nachfolgenden Abschnitten der Arbeit werden die zwei Teilbereiche Handel und Verkehr veranschaulicht. Hierbei wird der Handel in die Unterpunkte Außenhandel und Binnenhandel untergliedert, um eine genauere Abgrenzung und Unterscheidung zu ermöglichen sowie vor allem die Warenhändler und deren gehandelte Waren in dieser Zeit präziser zu veranschaulichen.
Im zweiten Hauptbereich der Seminararbeit wird das Verkehrswesen des 18. Jahrhunderts dargestellt. Unterpunkte bilden hier die Seeschifffahrt, die Binnenschifffahrt und der Chausseebau. In diesem Bereich soll erörtert werden, mit Hilfe welcher Einrichtungen des Verkehrs Händler in dieser Zeit ihre Waren transportiert haben und wie sich diese Einrichtungen weiterentwickelt haben.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Wirtschaftspolitik des 17. und des 18. Jahrhunderts
3. Handel und Handelspolitik
3.1 Der Außenhandel
3.2 Der Binnenhandel
4. Das Verkehrswesen
4.1 Die Seeschifffahrt
4.2 Die Binnenschifffahrt
4.3 Der Chausseebau
5. Zusammenfassung
6. Abbildungsverzeichnis
7. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Die vorliegende Seminararbeit beschäftigt sich mit dem Handel und dem Verkehr des 18. Jahrhunderts. Einführend in diese zwei Teilbereiche, soll mit der Darstellung des Merkantilismus zunächst die Wirtschaftspolitik der damaligen Zeit erläutert werden, da sie, vor allem für die Abwicklung des Außenhandels, von großer Bedeutung war.
In den nachfolgenden Abschnitten der Arbeit werden die zwei Teilbereiche Handel und Verkehr veranschaulicht. Hierbei wird der Handel in die Unterpunkte Außenhandel und Binnenhandel untergliedert, um eine genauere Abgrenzung und Unterscheidung zu ermöglichen sowie vor allem die Warenhändler und deren gehandelte Waren in dieser Zeit präziser zu veranschaulichen.
Im zweiten Hauptbereich der Seminararbeit wird das Verkehrswesen des 18. Jahrhunderts dargestellt. Unterpunkte bilden hier die Seeschifffahrt, die Binnenschifffahrt und der Chausseebau. In diesem Bereich soll erörtert werden, mit Hilfe welcher Einrichtungen des Verkehrs Händler in dieser Zeit ihre Waren transportiert haben und wie sich diese Einrichtungen weiterentwickelt haben.
2. Die Wirtschaftspolitik des 17. und des 18. Jahrhunderts
Die Wirtschaftspolitik der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts und des 18. Jahrhunderts baute auf zwei Grundpfeilern, welche jedoch in enger Beziehung zueinander standen. Zunächst sollte mit der Schaffung von Arbeitsplätzen die innere Wirtschaftskraft gestärkt und dadurch die Einkommensmöglichkeiten der Bevölkerung verbessert werden. Erreichen wollte man diese Ziele zum einen durch eine Politik, die zum Bevölkerungswachstum führt (Peuplierungspolitik), zum anderen durch die Förderung neuer und die Erweiterung schon vorhandener Produktionszweige.
Es reichte jedoch nicht aus, die Wirtschaftskraft allein im Landesinneren zu verbessern. Auch die Außenhandelspolitik, welche das grundsätzliche Ziel verfolgte, den Handel der anderen Länder zu hemmen, war von enormer Wichtigkeit (vgl. Rachel (1911). Als Beispiel für eine solche Außenhandelspolitik dient die englische Navigationsakte vom 9. Oktober 1651. Diese Navigationsakte diente der Eindämmung des Handelsverkehrs der niederländischen Kaufleute. „Aus Übersee, dass heißt von außerhalb Europas durften Waren nur auf englischen Schiffen eingeführt werden, aus Europa nur auf englischen Schiffen oder auf Schiffen des Ursprungslandes […]“ (Henning (1991), S.737). Weiterhin dienten Zölle dieser protektionistischen Außenhandelspolitik. So wurden Fertigwareneinfuhren und Rohstoffausfuhren durch Zölle behindert, während Fertigwarenausfuhren und Rohstoffeinfuhren durch Zollfreiheit begünstigt wurden.
Neben diesen beiden Grundpfeilern, der Stärkung der inneren Wirtschaftskraft sowie einer protektionistischen Außenhandelspolitik, wurden teilweise zusätzliche Maßnahmen ergriffen. Diese Maßnahmen gingen hin bis zur Währungs-, Preis-, Steuer- und Verkehrspolitik (Vgl. Henning (1991), S.758). Unabhängig von der jeweiligen Maßnahme mussten insgesamt alle das Gesamtziel verfolgen, die Wirtschaft der anderen Länder zu schwächen. Die Durchsetzung dieses Ziels traf jedoch spätestens dann auf großen Widerstand, wenn auch in den anderen Ländern die gleiche abwehrende Wirtschaftspolitik betrieben wurde. Auch stellt sich die Frage, ob diese protektionistisch ausgelegte Wirtschaftspolitik langfristig Vorteile für ein Land hatte.
Eine solche Wirtschaftspolitik wird in der Literatur auch als Merkantilismus oder Merkantilsystem beschrieben. Der Begriff Merkantilismus stammt von Adam Smith (1723 bis 1790), der damit die behindernde Handelspolitik, vor allem die Außenhandelspolitik, welche er vehement ablehnte, beschreiben wollte (vgl. Henning (1991), S.758).
Neben den oben genannten Fakten beruhte dieses System auf der Sichtweise, dass durch viel Geld Reichtum geschaffen würde, sowohl für Einzelpersonen als auch für ganze Volkswirtschaften. Man verkannte jedoch die Probleme, die eine solche Sichtweise nach sich zog. Geld allein zeugt noch nicht von Reichtum, erst wenn Güter vorhanden sind, die man mit diesem Geld erwerben kann, ist es möglich, diesen Reichtum auch auszuleben. Um das Güterangebot einer Volkswirtschaft zu erhöhen mussten also entweder die inländische Produktion oder die Einfuhren erhöht werden. Die Kernpunkte dieser Sichtweise bauten somit alle auf dem Handel auf.
Den größten Wert legte man hierbei auf den Außenhandel, da man der Meinung war, dass sich das Geld nur dann vermehrt, wenn die Volkswirtschaft eine aktive Handelsbilanz aufweisen kann, dass heißt, wenn mehr Waren ausgeführt als eingeführt werden. Auch der Aspekt der aktiven Handelsbilanz gilt als eine der wichtigen Ansätze des Merkantilismus.
Im folgenden Abschnitt soll der Schwerpunkt auf den Handel und die Handelspolitik des 18. Jahrhunderts gelegt werden. Hierbei soll zunächst der Außenhandel und darauffolgend der Binnenhandel Deutschlands erläutert werden.
3. Handel und Handelspolitik
Wie oben beschrieben war der Handel eines der wichtigsten Instrumente der damaligen Wirtschaftspolitik. Die Schwerpunkte lagen dabei sowohl auf der Versorgung des inländischen Marktes, als auch auf den außenwirtschaftlichen Beziehungen. Beide waren jedoch an unterschiedliche Rahmenbedingungen geknüpft und sahen sich ungleichen Entwicklungschancen gegenüber. Auch wenn der inländische Warenaustausch zunächst den größeren und wichtigeren Anteil ausmachte, waren die Entwicklungschancen für den Außenhandel größer. Zudem konnte die Idee der aktiven Handelsbilanz und der damit erhofften Vergrößerung des Reichtums nur mit einem weitreichenden Außenhandel verwirklicht werden.
3.1 Der Außenhandel
Das 18. Jahrhundert ist für den Außenhandel ein sehr wichtiger Zeitraum, denn in dieser Zeit konnte der durch den Dreißigjährigen Krieg stark geschwächte Handel wieder auf das Niveau der Vorkriegsjahre ausgeweitet werden. Die wichtigsten Handelsstädte wurden nun jedoch nicht mehr durch die süddeutschen Handels- und Gewerbestädte wie Ulm, Augsburg, Nürnberg oder Regensburg repräsentiert, sondern, durch eine Verlagerung des europäischen Handels vom Mittelmeer zur Nordsee, durch die norddeutschen Küstenstädte wie zum Beispiel Bremen und Hamburg. Begünstigt wurde diese Verlagerung zudem durch die enorme Ausdehnung des Handels zu den Niederlanden und zu Großbritannien, die mittlerweile den größten Teil, der überseeischen Gebiete kontrollierten, wodurch im Laufe der Zeit die Portugiesen und die Spanier aus ihren monopolartigen Handelspositionen heraus gedrängt wurden (vgl. Henning (1994), S.267).
Durch viele Kriege wurde die Produktion, die Einkommensentwicklung und die Nachfrage der einbezogenen Gebiete stark beeinträchtigt, so dass diese Beeinträchtigung auch auf den Handel im örtlichen, regionalen und zwischenregionalen Bereich Auswirkungen zeigte.
Trotz der Kriege konnten sich die auf das Exportgewerbe ausgelegten Standorte wie zum Beispiel die Mittelgebirgszonen von Aachen bis Oberschlesien in dieser Zeit relativ stabil halten. Neben diesen Standorten entwickelten sich auch neue Zentren beispielsweise am linken Niederrhein, im westlichen Westfalen, um Berlin und in der Lausitz. Auch die oben genannten süddeutschen Handelsstädte nahmen weiterhin am Exportgeschäft teil, jedoch vergrößerte sich ihr Handelsvolumen nicht sondern blieb größtenteils konstant. Produziert wurde hier sowohl für den europäischen als auch für den außereuropäischen Markt.
Zu den wichtigsten Handelsplätzen entwickelten sich in dieser Zeit Leipzig und Hamburg. Leipzig profitierte von seinen Messen, die als Verknüpfungspunkt zwischen dem östlichen und dem westlichen Europa von großer Bedeutung waren und auch in Kriegsjahren sehr gut ausfielen. Unterstützt wurde der Verknüpfungscharakter Leipzigs auch dadurch, dass die Messen als sogenannte Mustermessen abgehalten wurden. So musste nicht die gesamte Ware nach Leipzig und wieder zurück transportiert werden. Leipzig wurde durch diese Mustermessen im Vergleich zu Küstenstädten oder an großen Flussläufen liegenden Städten nicht allzu sehr benachteiligt und vor allem vor einer Verlagerung der Handelsströme geschützt.
Hamburg profitierte vor allem durch seine Lage an der Elbe und dem nach und nach ausgebauten brandenburgischen Kanalsystem. Das gesamte Gebiet von Schlesien, Mähren, Böhmen, Sachsen, Thüringen und Brandenburg gehörte damit zum Hinterland Hamburgs. Dadurch konnte der Handelsstandort Exportwaren von den wichtigsten Gewerbestandorten Mitteleuropas beziehen oder diese mit Waren der Weltmärkte versorgen (Vgl. North (2000), S.18f.).
[...]
- Arbeit zitieren
- Daniel Sauer (Autor:in), 2008, Handel und Verkehr im 18. Jahrhundert, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/134224