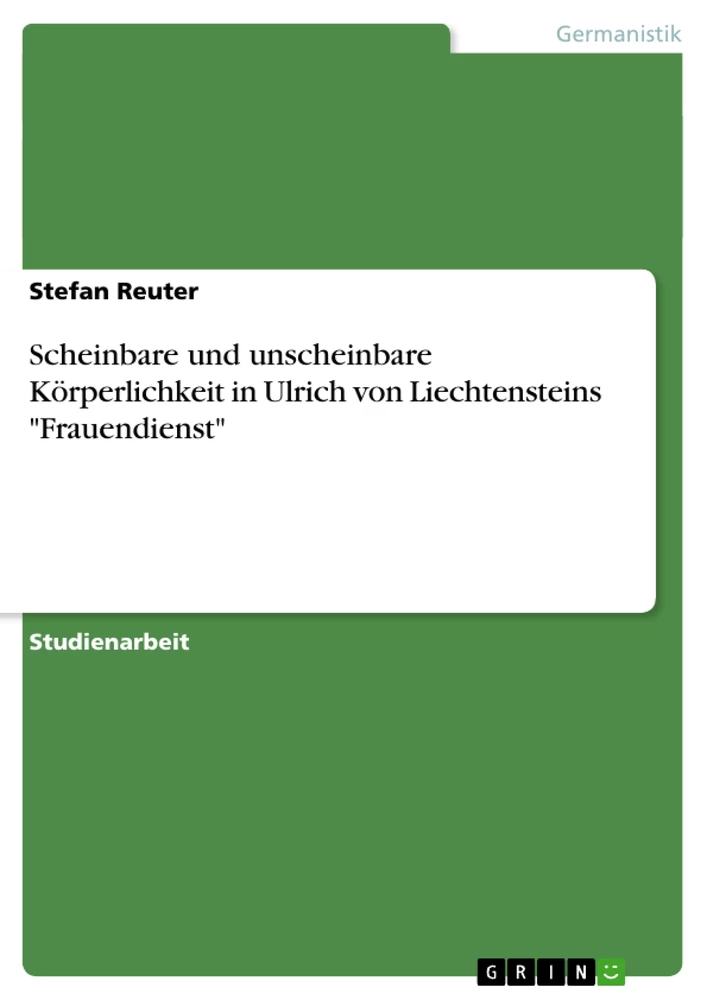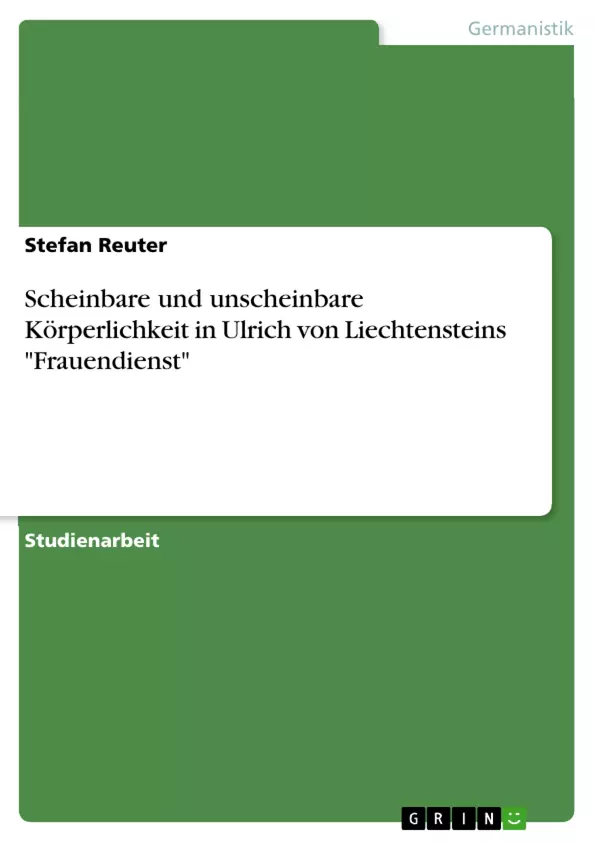Ulrich von Liechtensteins Frauendienst ist ein mit Körperlichkeit angereicherter Roman. Dieser These wird der Leser nach der ersten Lektüre angesichts von Mundoperationen, einem abgehackten Finger oder leprösen Gesichtsentstellungen in der Regel zustimmen.
Gleichzeitig scheint es allerdings unmöglich, ein zusammenhängendes Körperbild von Ulrich zu zeichnen.
Dies wirft die Vermutung auf, dass es sich hier nur um scheinbare Körperlichkeit handelt, welche zeichenhafte Bedeutung hat. Diese Vermutung gilt es zunächst zu untermauern und die entsprechenden Bedeutungen herauszuarbeiten. In einem weiteren Schritt ist nach der Wirkung dieser vom Autor gewählten Methode der Zeichenhaftigkeit zu fragen.
Als Vorgehensweise hierfür erscheint es sinnvoll die einzelnen Beispiele von Körperdarstellungen separat zu analysieren und auf dieser Grundlage Gemeinsamkeiten und eine Interpretation herauszuarbeiten.
Neben dieser auffälligen, jedoch vermutlich scheinbaren Körperlichkeit ist im Text noch eine weitere anscheinend gegenteilige Form von Körperlichkeit zu erkennen.
Gemeint ist hier das Phänomen, dass Gegenstände wie Körper behandelt werden und anscheinend auch als solche fungieren.
Dieses Phänomen ist zunächst wieder an unterschiedlichen Textbeispielen nachzuweisen um anschließend diese eher unscheinbare Körperlichkeit zu erklären und zu interpretieren.
Die hier gewählte Thematik ist dem Bereich der Körperlichkeitsforschung zuzuordnen, die nach Linden ihren Beginn Ende der 80er Jahre hat und somit zu den jüngsten Forschungsrichtungen zum “Frauendienst“ zählt.
Die Körperlichkeitsforschung steht damit am Ende einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Werk, die bereits 1812 begann und unterschiedliche Themen zum Untersuchungsschwerpunkt machte. Linden liefert einen Abriss dieser Forschungsentwicklung, auf den an dieser Stelle verwiesen sei.
Die jüngsten Forschungsergebnisse aus dem Bereich der Körperlichkeitsforschung finden sich bei Kiening (1998) und Ackermann (2002), auf welche in dieser Hausarbeit entsprechend Bezug genommen werden soll.
Das Ziel dieser Hausarbeit ist es hierbei scheinbare Körperlichkeit zu entlarven und unscheinbare Körperlichkeit aufzudecken, sowie beide Kategorien auf ihre Bedeutung und Wirkung hin zu untersuchen. Letztlich soll auf dieser Grundlage ein Beitrag zur Interpretation des Gesamtwerkes gefunden werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Der scheinbare Körper des Helden und die unscheinbaren Körper in seiner Umgebung
- Untersuchungsteil
- Scheinbare Körperlichkeit
- Der ungefüge Mund
- Der verletzte Finger
- Manipulationen und Sexfixiertheit eines schweren Körpers beim Stelldichein
- Reale Körperlichkeit im zweiten Teil des “Frauendienstes”
- Unscheinbare Körperlichkeit
- Ulrichs Zeit als Knecht
- Ulrichs Herz als eigener Körper
- Das Büchlein als textualisierter Körper
- Der abgehackte Finger
- Geschenke der vrowe
- Das süeze wort und der hohe muot
- Scheinbare Körperlichkeit
- Ergebnis
- Ulrich als liebenswürdiger Minnetor
- Ulrichs Aufstieg zum höfischen Minneideal
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Ziel dieser Hausarbeit ist die Untersuchung scheinbarer und unscheinbarer Körperlichkeit im „Frauendienst“ Ulrichs von Liechtenstein. Es soll analysiert werden, wie diese Körperlichkeit zeichenhafte Bedeutung erhält und welche Wirkung die vom Autor gewählte Methode der Zeichenhaftigkeit entfaltet. Die Arbeit trägt damit zur Interpretation des Gesamtwerkes bei.
- Analyse der scheinbaren Körperlichkeit im „Frauendienst“ und ihrer symbolischen Bedeutung.
- Untersuchung der unscheinbaren Körperlichkeit, bei der Gegenstände als Körper behandelt werden.
- Interpretation des Spiels zwischen Fiktion und Realität in der Darstellung der Körperlichkeit.
- Beurteilung von Ulrichs Rolle als Minnetor und seinem Aufstieg zum höfischen Minneideal im Kontext der Körperlichkeit.
- Einordnung der Arbeit in den Kontext der Körperlichkeitsforschung zum „Frauendienst“.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Der scheinbare Körper des Helden und die unscheinbaren Körper seiner Umgebung: Die Einleitung stellt die These auf, dass Ulrich von Liechtensteins „Frauendienst“ ein mit Körperlichkeit angereicherter Roman ist, obwohl ein zusammenhängendes Körperbild Ulrichs schwer zu zeichnen ist. Die Arbeit untersucht daher die scheinbare Körperlichkeit mit zeichenhafter Bedeutung und die unscheinbare Körperlichkeit, bei der Gegenstände wie Körper behandelt werden. Die Methodik beinhaltet die separate Analyse von Körperdarstellungen, um Gemeinsamkeiten und Interpretationen herauszuarbeiten. Die Arbeit wird im Kontext der Körperlichkeitsforschung eingeordnet, die Ende der 80er Jahre begann.
2. Untersuchungsteil: Scheinbare Körperlichkeit: Dieser Abschnitt analysiert die scheinbare Körperlichkeit, die sich durch Zeichenhaftigkeit und Funktionalität auszeichnet und keinen Beitrag zu einem einheitlichen Körperbild Ulrichs leistet. Es wird diskutiert, ob diese Körperlichkeit überhaupt als real angesehen werden kann. Die Analyse konzentriert sich auf verschiedene Episoden, wie die Operation des „ungefüegen Mundes“, welche mehr als 50 Strophen umfasst. Die Interpretation betont das Spiel zwischen Fiktion und Realität und wie ein Missverständnis Ulrichs zu einer realen „Hasenscharte“ wird, wodurch gleichzeitig der Fiktionscharakter angedeutet wird.
2. Untersuchungsteil: Unscheinbare Körperlichkeit: Dieser Teil befasst sich mit der unscheinbaren Körperlichkeit, bei der Objekte als Körper fungieren. Die Analyse untersucht verschiedene Beispiele, um diese Form der Körperlichkeit zu erklären und zu interpretieren. Es werden Aspekte wie Ulrichs Zeit als Knecht, sein Herz als eigener Körper, das Büchlein als textualisierter Körper, der abgehackte Finger sowie Geschenke der „vrowe“ und die Bedeutung von „süeze wort“ und „hoher muot“ untersucht. Der Fokus liegt auf der symbolischen Bedeutung dieser Elemente im Kontext der Erzählung.
Schlüsselwörter
Frauendienst, Ulrich von Liechtenstein, Körperlichkeit, Scheinbare Körperlichkeit, Unscheinbare Körperlichkeit, Zeichenhaftigkeit, Minne, Höfische Konventionen, Fiktion, Realität, Körperlichkeitsforschung, Redekompetenz, Minnelied.
Häufig gestellte Fragen zum „Frauendienst“ Ulrichs von Liechtenstein
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Darstellung von Körperlichkeit im „Frauendienst“ Ulrichs von Liechtenstein, indem sie zwischen „scheinbarer“ und „unscheinbarer“ Körperlichkeit unterscheidet und deren symbolische Bedeutung analysiert. Die Arbeit beleuchtet, wie die vom Autor gewählte Zeichenhaftigkeit wirkt und trägt zur Gesamtinterpretation des Werkes bei.
Welche Aspekte der Körperlichkeit werden untersucht?
Die Arbeit analysiert sowohl die „scheinbare Körperlichkeit“, die durch Zeichenhaftigkeit und Funktionalität geprägt ist und nicht unbedingt ein einheitliches Körperbild Ulrichs ergibt, als auch die „unscheinbare Körperlichkeit“, bei der Gegenstände metaphorisch als Körper behandelt werden. Beispiele hierfür sind Ulrichs Zeit als Knecht, sein Herz als eigener Körper, das Büchlein als textualisierter Körper, ein abgehackter Finger, Geschenke der „vrowe“, sowie die Bedeutung von „süeze wort“ und „hoher muot“.
Welche konkreten Beispiele für „scheinbare“ Körperlichkeit werden analysiert?
Die Analyse der „scheinbaren“ Körperlichkeit umfasst Episoden wie die Operation des „ungefüegen Mundes“ (über 50 Strophen), den verletzten Finger und die Darstellung von Manipulationen und Sexfixiertheit eines schweren Körpers beim Stelldichein. Es wird diskutiert, inwieweit diese Körperlichkeit als real angesehen werden kann und wie das Spiel zwischen Fiktion und Realität dargestellt wird.
Wie wird die „unscheinbare“ Körperlichkeit interpretiert?
Die „unscheinbare“ Körperlichkeit wird anhand verschiedener Objekte untersucht, die metaphorisch als Körper fungieren. Der Fokus liegt dabei auf der symbolischen Bedeutung dieser Elemente im Kontext der Erzählung und deren Beitrag zum Verständnis des Gesamtwerks.
Welche Zielsetzung verfolgt die Hausarbeit?
Das Ziel ist die Analyse der scheinbaren und unscheinbaren Körperlichkeit im „Frauendienst“, die Untersuchung ihrer symbolischen Bedeutung und die Interpretation des Spiels zwischen Fiktion und Realität in der Darstellung der Körperlichkeit. Weiterhin wird Ulrichs Rolle als Minnetor und sein Aufstieg zum höfischen Minneideal im Kontext der Körperlichkeit beurteilt und die Arbeit in den Kontext der Körperlichkeitsforschung zum „Frauendienst“ eingeordnet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Frauendienst, Ulrich von Liechtenstein, Körperlichkeit, Scheinbare Körperlichkeit, Unscheinbare Körperlichkeit, Zeichenhaftigkeit, Minne, Höfische Konventionen, Fiktion, Realität, Körperlichkeitsforschung, Redekompetenz, Minnelied.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Untersuchungsteil (unterteilt in „Scheinbare Körperlichkeit“ und „Unscheinbare Körperlichkeit“) und einen Ergebnis-Teil. Die Einleitung stellt die These und Methodik vor. Der Untersuchungsteil analysiert die verschiedenen Aspekte der Körperlichkeit. Der Ergebnis-Teil fasst die Erkenntnisse zusammen und interpretiert Ulrichs Rolle und Entwicklung.
In welchem Kontext wird die Arbeit eingeordnet?
Die Arbeit wird im Kontext der Körperlichkeitsforschung zum „Frauendienst“ eingeordnet, die Ende der 80er Jahre begann. Sie trägt zur Interpretation des Gesamtwerks bei und analysiert die vom Autor gewählte Methode der Zeichenhaftigkeit.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussfolgerungen werden im Ergebnis-Teil zusammengefasst und beziehen sich auf Ulrichs Rolle als liebenswürdiger Minnetor und seinen Aufstieg zum höfischen Minneideal im Kontext der analysierten Körperlichkeit. Die konkreten Ergebnisse lassen sich aus den Kapitelzusammenfassungen entnehmen.
- Quote paper
- Stefan Reuter (Author), 2006, Scheinbare und unscheinbare Körperlichkeit in Ulrich von Liechtensteins "Frauendienst", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/134349