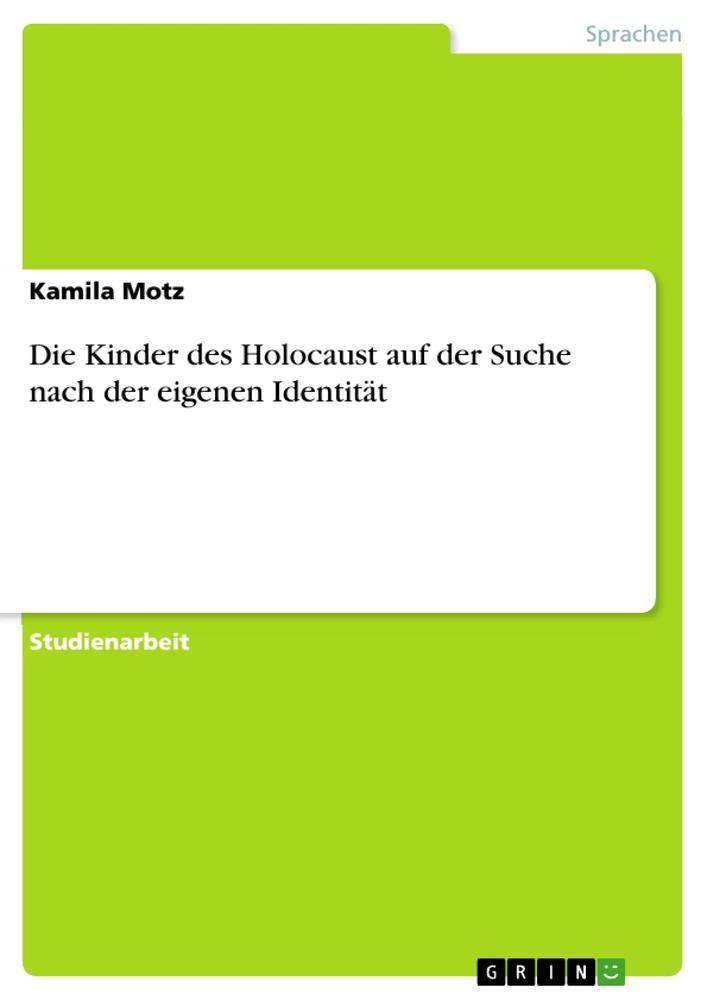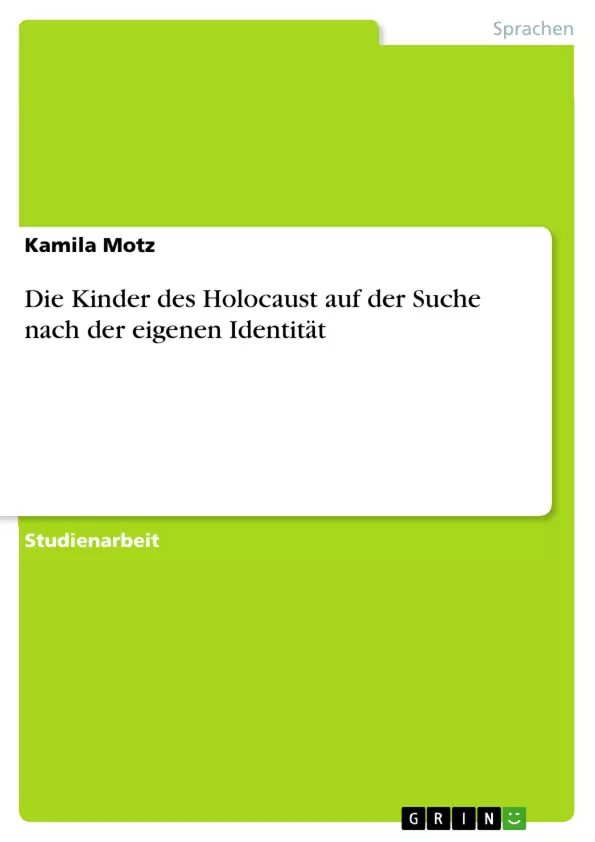Während des zweiten Weltkriegs wurden zirka 6 Millionen Juden Konzentrations- und Vernichtungslagern sowie bei Massenexekutionen umgebracht. Diejenigen, die Nazi- Terror überlebt hatten, trugen oftmals schwerwiegende physische und psychische Folgen davon, waren heimatlos und total niedergeschlagen. Auch nach dem Krieg änderte sich anfangs kaum etwas; die Probleme der europäischen Juden wurden häufig ignoriert. Die Überlebenden der Konzentrationslager wollten nach der Befreiung überallhin emigrieren, viele hatten auch vor, in ihre Heimat zurückkehren, fanden dort aber nichts anderes als Zerstörung und Verwüstung vor. Die Auswanderer mussten in fremden Ländern neue Sprachen lernen und sich in der neuen Kultur zurechtfinden. Sie gründeten Familien, schlossen sich aneinander und lebten sich in eine fremde Umwelt ein. Über die Geschehnisse des Holocaust wurde meist geschwiegen. Das Thema meiner Hausarbeit beschränkt sich auf einen besonderen Teilaspekt dieses Problems, nämlich auf den Einblick in die Entwicklung und Psyche der erwachsenen Juden, die nach dem Zweiten Weltkrieg von den polnischen Familien großgezogen wurden und erst als Erwachsene erfahren haben, aus welcher Volksgruppe sie stammen, wo ihre wahren Wurzeln liegen. Als literarische Quelle bediene ich mich des Buches von Hanna Krall: „Die Existenzbeweise“. Des Weiteren werde ich mich mit der zweiten Generation der Holocaust-Überlebenden beschäftigen, deren Eltern direkt nach dem Krieg in die USA oder nach Kanada emigriert haben. Anhand des Buches von Helen Epstein: „Die Kinder des Holocaust“ beschreibe ich, wie diese Kinder sich mit dem Trauma der elterlichen Vergangenheit auseinandergesetzt haben. Der Schwerpunkt meiner Arbeit beinhaltet die Frage der Identitätssuche. Ich versuche an diesen zwei literarischen Werken die Suche verschiedenen Kinder, bzw. Erwachsenen nach eigener Identität, nach eigenem „Ich“ darzustellen und zu analysieren. Bevor ich mich jedoch mit dem eigentlichen Thema auseinandersetze, fange ich mit Begriffserklärungen an.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Begriffserklärungen
2.1 Holocaust
2.2. Judentum
2.3. Ghetto
2.4. Überlebenden-Syndrom
3. Kinder als Opfer des Holocaust
4. Hanna Krall - ihr Schicksal und Übermittlung für die Nachkommen
5. Helen Epstein „Die Kinder des Holocaust. Gespräche mit Söhnen und Töchtern von Überlebenden“
6. Identität
6.1 Definition
6.2. Verlust der Identität
7. Die zweite Generation von Kinder des Holocaust – auf der Suche nach der eigenen Identität
7.1. Hanna Krall
7.2. Hellen Epstein
8. Zusammenfassung
9. Literaturverzeichnis
9.1. Primärliteratur
9.2. Sekundärliteratur
1. Einleitung
Während des zweiten Weltkriegs wurden zirka 6 Millionen Juden Konzentrations- und Vernichtungslagern sowie bei Massenexekutionen umgebracht. Diejenigen, die Nazi- Terror überlebt hatten, trugen oftmals schwerwiegende physische und psychische Folgen davon, waren heimatlos und total niedergeschlagen. Auch nach dem Krieg änderte sich anfangs kaum etwas; die Probleme der europäischen Juden wurden häufig ignoriert. Die Überlebenden der Konzentrationslager wollten nach der Befreiung überallhin emigrieren, viele hatten auch vor, in ihre Heimat zurückkehren, fanden dort aber nichts anderes als Zerstörung und Verwüstung vor. Die Auswanderer mussten in fremden Ländern neue Sprachen lernen und sich in der neuen Kultur zurechtfinden. Sie gründeten Familien, schlossen sich aneinander und lebten sich in eine fremde Umwelt ein. Über die Geschehnisse des Holocaust wurde meist geschwiegen.
Das Thema meiner Hausarbeit beschränkt sich auf einen besonderen Teilaspekt dieses Problems, nämlich auf den Einblick in die Entwicklung und Psyche der erwachsenen Juden, die nach dem Zweiten Weltkrieg von den polnischen Familien großgezogen wurden und erst als Erwachsene erfahren haben, aus welcher Volksgruppe sie stammen, wo ihre wahren Wurzeln liegen. Als literarische Quelle bediene ich mich des Buches von Hanna Krall: „Die Existenzbeweise“. Des Weiteren werde ich mich mit der zweiten Generation der Holocaust-Überlebenden beschäftigen, deren Eltern direkt nach dem Krieg in die USA oder nach Kanada emigriert haben. Anhand des Buches von Helen Epstein: „Die Kinder des Holocaust“ beschreibe ich, wie diese Kinder sich mit dem Trauma der elterlichen Vergangenheit auseinandergesetzt haben. Der Schwerpunkt meiner Arbeit beinhaltet die Frage der Identitätssuche. Ich versuche an diesen zwei literarischen Werken die Suche verschiedenen Kinder, bzw. Erwachsenen nach eigener Identität, nach eigenem „Ich“ darzustellen und zu analysieren. Bevor ich mich jedoch mit dem eigentlichen Thema auseinandersetze, fange ich mit Begriffserklärungen an.
2. Begriffserklärungen
2.1 Holocaust
Der Begriff Holocaust stammt aus dem Griechischen „holokaustos“ und bedeutet ursprünglich „vollständiges Brandopfer“. Die erste deutsche Übersetzung leistete Luther mit dem Ausdruck „Brandopfer“ und erst nach dem Nazi-Regime hat man diesen Begriff mit der Judenermordung assoziiert. Heutzutage verwendet man ihn ausschließlich als Sinnbild für die Leiden und Völkermord an den europäischen Juden in den Konzentrationslagern.
2.2. Judentum
Das Judentum bezeichnet sowohl eine Volks- als auch eine Religionszugehörigkeit. Der Jude ist ein Glied eines Volkes, dessen Ursprünge von der Religion bestimmt wurden.
2.3. Ghetto
Ein Ghetto bzw. Getto ist ein Stadtviertel, in dem eine bestimmte Bevölkerungs- oder kulturell geprägte Gruppe in einer mehr oder weniger strengen Isolation zu leben gezwungen ist.
2.4. Überlebenden-Syndrom
Unter Überlebenden-Syndrom, auch unter den Synonymen KZ-Syndrom und Holocaust-Syndrom bekannt, versteht man eine Art der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS). In der engen Verwendung betrifft dieser Begriff nur Überlebende des Holocaust. In einem weiteren Sinne werden darunter heute auch andere Personen bzw. Personengruppen verstanden, die Formen von Genozid und Lagerhaft physisch überstanden haben, durch die Erlebnisse jedoch psychisch traumatisiert wurden.[1]
3. Kinder als Opfer des Holocaust
Sechs Millionen Juden starben im Holocaust, davon eineinhalb Millionen Kinder. Diesen Kindern wurde nichts erspart: Diskriminierung, Ausschluss aus der Gesellschaft, in die sie hineingeboren waren, die Zerstörung des Lebens, der Tod ihrer Eltern, Geschwister und Freunde, die Angst vor Verfolgung, Ghettos, der Deportation in die Konzentrationslager, ihr Überlebenskampf gegen Hunger und Krankheit bis hin zu ihrer Vernichtung in den Gaskammern.
Diese Überlebenden sind entweder nach Amerika, Kanada, Palästina ausgewandert oder haben sich in Europa niedergelassen. Mit der Zeit heirateten Sie und gründeten eigene Familien. In dem neuen Zuhause haben sie leider keine Ruhe gefunden. Die Bilder und Stimmen der Vergangenheit plagten sie und unterbewusst auch ihre Kinder. Die Übertragung der seelischen Erschütterung der Eltern auf ihre eigenen Kinder vollzog sich bis zur dritten Generation.
"Die zweite Generation nach dem Holocaust durchbricht das Schweigen, mit dem die Überlebenden ihre tiefen Wunden zu überdecken suchten. Voll Betroffenheit muss man zur Kenntnis nehmen, wie Verdrängung und Selbstverachtung auf Seiten der Opfer eine zusätzliche und schmerzhafte Hinterlassenschaft der Dritten Reiches sind".[2]
4. Hanna Krall - ihr Schicksal und Übermittlung für die Nachkommen
Hanna Krall wurde am 20. Mai 1937 in Warschau als Jüdin geboren, hat ein Studium der Publizistik an der Warschauer Universität abgeschlossen und danach war sie als Journalistin tätig. Sie arbeitet seit 1979 auch für Theater und Film. Ihre Werke wurden mit zahlreichen nationalen und internationalen Preisen ausgezeichnet und in vielen Sprachen übersetzt.
Hanna Kralls Form des Erzählens ist aus literarischen Reportagen bekannt.
„In ihrer meisterhaften Collagetechnik, die Zeiten und Schicksale miteinander verknüpft, hat Hanna Krall ein aufwühlendes Werk voll Güte und Wahrhaftigkeit verfasst.“[3]
„Existenzbeweise“ schildern die Einzelschicksale polnischer Juden. Sie beschränkt sich jedoch nicht auf die Seite der Opfer. Nebeneinander kämpfen Deutsche, Juden und Polen um ihr Dasein, alle müssen mit ihrer Schuld und seelischen Erschütterung zurechtkommen. Wie schwerwiegend die Folgen von unverdauter Geschichte der Familie und des ganzen Volkes sich auf die Kinder übertragen lassen, zeigen die Erzählungen über die nachgeborene Generation.
In den „Existenzbeweisen“ beschäftigt sich Hanna Krall mit unklaren Biographien ihrer Figuren. Den Figuren der Erzählungen ist die Suche nach ihrer Identität gemeinsam: sie erfahren nach Jahren, dass sie Juden sind; sie wollen jüdisch sein und sind es doch nicht, weil sie es aber nicht belegen können. Mit der neuen Wahrheit versuchen sie sich in ihrer „neuen“ Lebensgrundlage wieder zu finden. Meistens werden sie in ihrer Umgebung nicht verstanden, sogar abgestoßen.
Hanna Krall beschreibt diesen Sachverhalt ganz schlicht, ohne emotionale Anteilnahme, trotzdem ist es ihr gelungen, auf diesen paar Seiten viel noch vorhandenen Schmerz und Verletzungen lebender Menschen aufzuzeichnen.
5. Helen Epstein „Die Kinder des Holocaust. Gespräche mit Söhnen und Töchtern von Überlebenden“
„Lange Jahre war es in einer Art Kasten tief in mir vergraben. Ich wusste, dass ich – verborgen in diesem Kasten - schwer zu erfassende Dinge mit mir herumtrug. Sie waren feuergefährlich, sie waren intimer als die Liebe, bedrohlicher als jede Chimäre, jedes Gespenst. Gespenster hatten aber immerhin eine Gestalt, einen Namen. (…) Es besaß eine Macht von so düsteren, furchtbarer Gewalt, dass die Worte, die sie hätten benennen können, vor ihr zergingen.“[4]
Mit diesen Worten fängt die amerikanische Journalistin Helen Epstein ihr Buch an. In vielen Interviews mit den Opfern aus der zweiten und dritten Generation der Holocaust-Überlebenden, in einer engen Verbindung mit eigenen Erfahrungen[5] geht sie der traumatischen und unbegreiflichen Vergangenheit nach.
Die Lebensgeschichten ihrer Gesprächspartner verflechtet sie mit eigenen Erinnerungen. Diese Gespräche scheinen für sie eine Art der Psychotherapie zu sein, die ihr ermöglichen, eigene Probleme hervorzubringen, benennen und verarbeiten.
In den einzelnen Kapitel tauchen verschiedene Lebensgeschichten der Überlebenden aus der Sicht ihrer Kinder auf, die schon nach dem Krieg geboren wurden, oft in der Fremde, weit von der Heimat der Eltern. Fast in jeder Erzählung wiederholen sich die gleichen Motive und Aspekte, die man unter einen gemeinsamen Nenner bringen kann: Überlebenssyndrom.
[...]
[1] Vgl.: http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cberlebenden-Syndrom
[2] Epstein, Helen: Die Kinder des Holocaust. S. 256
[3] Karl-Markus Gauß, Frankfurter Allgemeine Zeitung. In: http://www.dtv.de/dtv.cfm?wohin=dtvnr13395
[4] Epstein, Helen: Die Kinder des Holocaust. S. 9.
[5] Die Großeltern von Helen Epstein wurden in einem Konzentrationslager ermordet.
Häufig gestellte Fragen
Was thematisiert Hanna Kralls Buch „Existenzbeweise“?
Es schildert Einzelschicksale polnischer Juden, die oft erst als Erwachsene von ihrer jüdischen Identität erfahren haben, nachdem sie in polnischen Familien aufgewachsen sind.
Was versteht man unter dem Überlebenden-Syndrom?
Auch als KZ-Syndrom bekannt, bezeichnet es eine Form der posttraumatischen Belastungsstörung bei Holocaust-Überlebenden, die sich oft auch auf nachfolgende Generationen überträgt.
Welchen Fokus hat Helen Epsteins Werk „Die Kinder des Holocaust“?
Epstein untersucht durch Interviews mit der zweiten Generation, wie die Kinder der Überlebenden das Trauma ihrer Eltern verarbeiten und nach ihrer eigenen Identität suchen.
Warum wird von einer „zweiten Generation“ gesprochen?
Es betrifft die nach dem Krieg geborenen Kinder der Überlebenden, die indirekt durch das Schweigen oder die psychischen Wunden ihrer Eltern traumatisiert wurden.
Was bedeutet der Begriff „Ghetto“ im historischen Kontext des Holocaust?
Ein Ghetto war ein Stadtviertel, in dem Juden während der NS-Zeit unter Zwang und in Isolation leben mussten, bevor sie oft deportiert wurden.
- Arbeit zitieren
- Kamila Motz (Autor:in), 2006, Die Kinder des Holocaust auf der Suche nach der eigenen Identität, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/134379