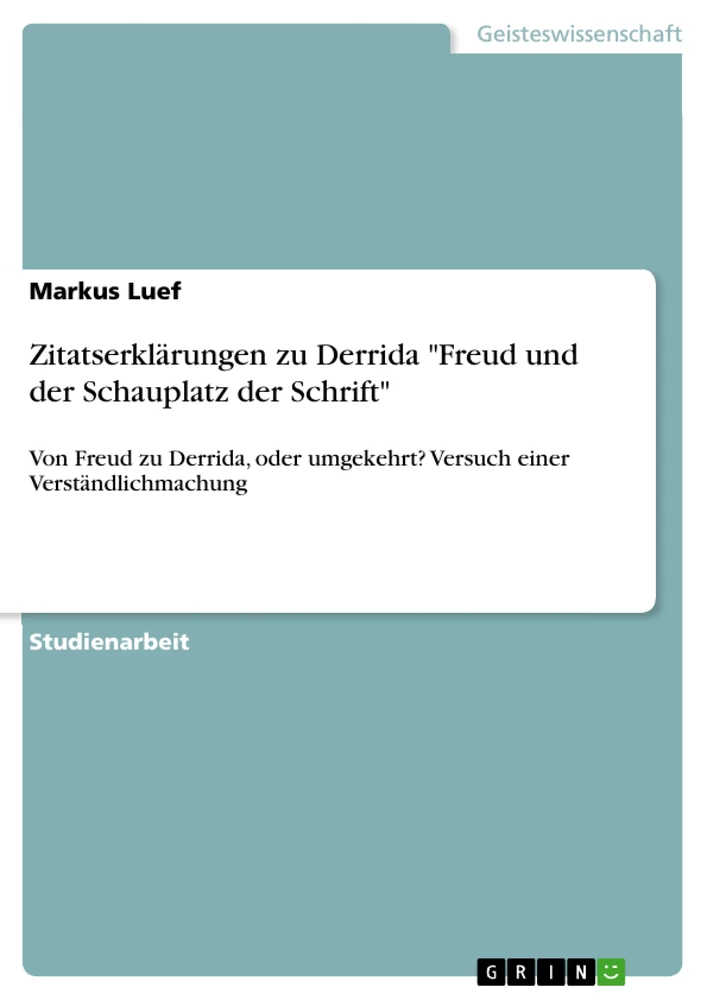Derrida bearbeitet zwei Schriften von Freud, die 30 Jahre auseinander liegen. Abgesehen davon, dass er damit seine Kritik am Phonozentrismus und sein Programm einer immer schon existierenden, lautlosen Urschrift unterstreichen will – was in weiterer Folge weniger interessieren wird – zeigt er auch Folgendes:
1. Die Entwicklung des Freudschen Denkens weg von einer neurologischen, topischen Erklärung des Wahrnehmungsapparates hin zu einer psychologischen, ja meta-psychologischen Theorie, die ja bekanntermaßen in der Entdeckung oder Erfindung der Psychoanalyse als Psychotherapie sowie als Weltsicht mündet.
2. Die Wichtigkeit und Schwierigkeit einer einigermaßen vernünftigen Theorie des Gedächtnisses.
3. Die Unmöglichkeit in einem endlichen Wesen Unendliches auszumachen.
Was mit nun bei Derrida interessanter erscheint als der Textkörper selbst, ist die Textauswahl. Beide Texte Freuds haben die gleichen Grundideen, zumindest wenn man Derridas Blick folgt. Dies ist ja auch das interessante Moment: zwingt die Auswahl uns eine Denkrichtung auf, oder schafft sie tatsächlich Raum für eine neuartige Lesart der Freudschen Metapsychologie?
Diese Frage kann ich nicht beantworten, klar ist aber: Derridas Text funktioniert ohne diese beiden Texte nicht.
Inhaltsverzeichnis
0 Warum?
1. Zur Einleitung
2. Entwurf einer Psychologie, I. Teil, [1] – [10]
0 Einleitung
1. Erster Hauptsatz – Die Quantitative Auffassung
2. Zweiter Hauptsatz – Die Neuronentheorie
3. Die Kontaktschranken
4. Der biologische Standpunkt
5. Quantitätsproblem
6. Der Schmerz
7. Qualitätsproblem
8. Das Bewusstsein
9. Das Funktionieren des Apparates
10. Die ψ Leitungen
3. Notiz über den «Wunderblock»
0 Warum?
Die Linie, die Unendlichkeit, Unterbrechungen, Brechungen, das Kontinuum, die Dichte. Eine Kurve, eine Krümmung, die Zeit. Alle diese Begriffe kommen natürlich in der Mathematik vor. Ebenso haben sie ihren Platz in der Logik.
In der Philosophie hat man sich damit auch beschäftigt, und macht dies wohl immer noch. Zwei Beispiele, mit denen ich sie verknüpfe, sind
1. die mittelalterliche Philosophie des 12. und 13. Jahrhunderts, vor allem eine Fragestellung von Ibn Rushd, a.k.a. Averroes.[i] Es dreht sich im Kern um die Frage der zeitlichen Kontinuität: wenn die Welt von Gott geschaffen wurde, was tat er vor der Schöpfung? Oder wurde die Zeit – und damit das Kontinuum – mit geschaffen? Welche Art von Zeit existierte davor; eine Engelszeit? Denn wenn Gott ewig und vollkommen ist, wie kann ihm dann zu einem gewissen Zeitpunkt eine Idee zukommen? Dies erscheint beim vollkommenen Wesen kaum vorstellbar. Aber auch die Ansicht, dass Gott die Schöpfungsidee schon unendliche Zeit in sich hatte, sie sich aber zu einem realen Zeitpunkt manifestiert, ist schwer verständlich.
2. die psychologische Philosophie, die sich mit der Tatsache eines durchgehenden Lebens beschäftigt. Wie können Träume in das Konzept des Bewusstseins integriert werden, wie ist es möglich, dass wir Dinge falsch im Gedächtnis behalten, und sie dennoch als wahr empfinden? Wie können wir in so vielen Situationen verschieden reagieren, uns aber als eine Person erleben? Ein – wenn nicht der – Höhepunkt wurde Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts erreicht. Franz Brentano[ii] und seine vielen Schüler[iii], allen voran Sigmund Freud[iv], haben diese Problematik massiv in den Raum gebracht. So scheint es ja im Unbewussten eine unglaubliche und schier unendliche Speicherkapazität zu geben, man denke nur an einen so genannten Ohrwurm, also ein irgendwann gehörtes, plötzlich wieder ins Bewusstsein springendes Musikstück. Wo war es die letzten Jahre abgelegt, wie kann es aus mir selbst kommend fremd erschienen? 1912 schreibt Freud:
Eine Vorstellung – oder jedes andere psychische Element – kann jetzt in meinem Bewußtsein gegenwärtig sein und im nächsten Augenblick daraus verschwinden; sie kann nach einer Zwischenzeit ganz unverändert wiederum auftauchen, und zwar, wie wir es ausdrücken, aus der Erinnerung, nicht als Folge einer neuen Sinneswahrnehmung. Um dieser Tatsache Rechnung zu tragen, sind wir zu der Annahme genötigt, daß die Vorstellung auch während der Zwischenzeit in unserem Geiste gegenwärtig gewesen sei, wenn sie auch im Bewußtsein latent blieb. In welcher Gestalt sie aber existiert haben kann, während sie im Seelenleben gegenwärtig und im Bewußtsein latent war, darüber können wir keine Vermutung aufstellen. [v]
Beide Ansätze – die natürlich nur zwei von unzähligen sein können – haben zumindest eine Gemeinsamkeit: Aristoteles. Seit die islamische Philosophie seine Schriften nach Europa brachte waren sein Kontinuumsbegriff und seine Lehre vom unbewegten Beweger, der das Denken denkt, Thema. Andererseits hat Aristoteles bekanntermaßen in seiner Lehre des „Doppelten Intellekts“ die Seelenlehre Freuds schon vorprogrammiert.
Womit nun endlich der Übergang zu Jacques Derrida geschafft wäre. In seinem Essay Freud und der Schauplatz der Schrift[vi] zeigt er nicht nur sein Können in der Dekonstruktion, sondern auch seine profunde Kenntnis über die Psychoanalyse und Freud. Die Frage ist: wie kann unser Wahrnehmungsapparat einerseits immer wieder neue Eindrücke aufnehmen, sie aber andererseits auch – mehr oder weniger – dauerhaft abspeichern? Was können unsere Fehlleistungen uns dazu lehren?
Wie viel können wir also steuern – aktiver versus passiver Intellekt.
Wie entsteht ein Leben, das uns ohne Fraktale erscheint – Kontinuum.
Derrida benutzt dazu zwei wohl bedacht ausgewählte Schriften Freuds: einerseits die prä-analytische Schrift Entwurf einer Psychologie[vii] aus dem Jahre 1895, andererseits die metapsychologische Schrift aus dem Jahre 1925 Notiz über den «Wunderblock» [viii].
Nicht nur die Weiterentwicklung der Ansichten Freuds sind bemerkenswert, sondern auch die Tatsache, dass er sich über so lange Zeit konsequent mit derselben Problematik beschäftigte. Flankierend benutzt Derrida dazu noch einige andere Schriften Freuds.
Für den Begriff der Bahnung sind die Texte Freuds mehr als bedeutend, Derrida erfindet sie nicht, er findet sie nur an den richtigen Stellen und biegt sie in sein Konzept. Es sollen also Freuds Schriften behandelt werden, so als ob sie zur Vorbereitung von Derridas Texten dienen sollten.
1. Zur Einleitung
Derrida bearbeitet zwei Schriften von Freud, die 30 Jahre auseinander liegen. Abgesehen davon, dass er damit seine Kritik am Phonozentrismus und sein Programm einer immer schon existierenden, lautlosen Urschrift unterstreichen will – was in weiterer Folge weniger interessieren wird – zeigt er auch Folgendes:
1. Die Entwicklung des Freudschen Denkens weg von einer neurologischen, topischen Erklärung des Wahrnehmungsapparates hin zu einer psychologischen, ja meta-psychologischen Theorie, die ja bekanntermaßen in der Entdeckung oder Erfindung der Psychoanalyse als Psychotherapie sowie als Weltsicht mündet.
2. Die Wichtigkeit und Schwierigkeit einer einigermaßen vernünftigen Theorie des Gedächtnisses.
3. Die Unmöglichkeit in einem endlichen Wesen Unendliches auszumachen.
Was mit nun bei Derrida interessanter erscheint als der Textkörper selbst, ist die Textauswahl. Beide Texte Freuds haben die gleichen Grundideen, zumindest wenn man Derridas Blick folgt. Dies ist ja auch das interessante Moment: zwingt die Auswahl uns eine Denkrichtung auf, oder schafft sie tatsächlich Raum für eine neuartige Lesart der Freudschen Metapsychologie?
Diese Frage kann ich nicht beantworten, klar ist aber: Derridas Text funktioniert ohne diese beiden Texte nicht. Er ist dann text- und kontextlos. Derrida verwendet die Überlegungen Freuds, als wären sie allgemein Gültiges. Wieder stellt sich die Frage: möchte Derrida hier seine eigenen Gedanken in Freudsche Zitate kleiden, oder will er vielmehr – oder muss er vielmehr – in der Annahme sein, dass seine Lektüre notwendigerweise zur Lektüre Freuds führt, oder aber gar, dass nur Freud Kenner Derrida lesenswert finden?
Wie dem auch sei, ich nehme mir die Freiheit heraus, in erster Linie die beiden Schriften von Freud zu behandeln, und so zu tun, als wüsste ich nicht, dass Derrida die Schrift meiner Gedanken schon verändert hat. Es sollen nun also die Freudtexte mit einem unbewussten Derrida gelesen werden, wobei die indirekten Antworten, um nicht gänzlich heraus zufallen, sich an diesen oben erwähnten drei Fragen heften werden.
Lange Rede, kurzer Sinn: ich möchte Zitatinformationen zu Freud und der Schauplatz der Schrift geben.
2. Entwurf einer Psychologie, I. Teil, [1] – [10]
0 Einleitung
Die Einleitung Freuds ist kurz, besteht nur aus drei Sätzen. Dennoch ist sie für das Verständnis des Textes wohl nicht wichtig und schwierig genug einzuschätzen. Freud möchte eine „naturwissenschafftliche Psychologie“[ix] liefern – damals vielleicht neuartig, man denke wieder an Brentanos Psychologieentwurf[x] (heutzutage kann man sich aber gar keine andere Art mehr vorstellen - zumindest nicht in Wien).
Dann kommen aber Freuds Hauptideen:
- Q meint Quantität, und Quantität ist DAS Merkmal, um psychische Zustände zu erklären. Quantität unterscheidet zwischen „Tätigkeit und Ruhe“[xi].
- Die Psyche besteht aus Materie, damit unterliegt sie den Materiegesetzen. Die spezifische Materie sind hier die „Neurone“[xii].
Die Neuronen werden bei Freud nun mit „N“ bezeichnet, die spezifische Quantität mit Qή, wobei das ή wohl für Energie im Sinne von Wirkungsgrad steht.[xiii]
1. Erster Hauptsatz – Die Quantitative Auffassung
Was passiert im Nervensystem? Es fließt Quantität, eben Q, durch die Neuronen, also durch N. Diese wollen dies aber eigentlich nicht, Freud spricht hier von einer Art Trägheitsgesetz. Lieber als durchflossen zu werden sind die N in Ruhe. Deshalb haben sie auch die Möglichkeit, sich der Energie zu entledigen: sie geben sie weiter, und zwar an die „Muskelmaschinen“[xiv]. Dieses System ist auch schon die Primärfunktion des gesamten Nervensystems.
Bei der Art der Weitergabe der Qή werden jene Wege (Bahnen) bevorzugt, die den Reiz beenden. Diese werden auch zu erhalten versucht. Dem zu Grunde liegt das Konzept der „Reizflucht“.[xv] Es gibt jedoch von Anfang an nicht nur dieses Trägheitsprinzip der N, sondern auch etwas, was Freud als „Not des Lebens“[xvi] bezeichnet. Die N beziehen ja nicht nur von außen eine Qή, sondern auch von innen, vom Körper selbst. Damit sind Notwendigkeiten wie zum Beispiel Essen, Atmen, Sexualität gemeint. Die N können sich dem nicht durch simple Weitergabe entziehen, sondern es muss zur Beendigung eine Aktion gesetzt werden. Das Nervensystem muss also einen Qή Level zulassen, um reagieren zu können; dieser wird aber so niedrig wie möglich gehalten; das stellt auch schon die Sekundärfunktion des Nervensystems dar.
[...]
[i] Siehe hierzu: Averroes (1991): Philosophie und Theologie von Averroes. Übersetzung von Marcus Joseph Müller. Weinheim. Besonders das erste Thema des fünften Abschnittes der Spekulativen Dogmatik, und hier wiederum Seite 96f.: „Sagt man zu ihnen: Wie kann etwas gewolltes Entstandenes von einem ewigen Willen herkommen? so ant-worten sie: der ewige Wille verbindet sich mit der Hervorbringung desselben in einer determinierten Zeit, das ist die Zeit, in welcher es existiert. Wenn man nun sagt: Wenn das Verhältnis des wollenden Agens zum Hervorgebrachten in der Zeit seines Nichtseins das nämliche ist wie zur Zeit seiner Hervorbringung, so kann das Hervorgebrachte ebensogut in einer anderen Zeit in die Existenz getreten sein als in der Zeit, wo dieses wirklich geschehen ist, da sich in der Zeit seiner Existenz keine Aktion mit ihm verbindet, welche für die Zeit seines Nichtseins von ihm zu negieren ist.“
[ii] Brentano, Franz (1973): Psychologie vom empirischen Standpunkt. 2 Bände. Hamburg.
[iii] Siehe dazu zum Beispiel: http://en.wikipedia.org/wiki/School_of_Brentano (Zugriff vom 20.11.08) Folgende Namen werden genannt: Carl Stumpf, Edmund Husserl, Alexius Meinong, Christian von Ehrenfels, Kazimierz Twardowski, Anton Marty, Alois Höfler, Benno Kerry, Tomáš Masaryk, Sigmund Freud, Rudolf Steiner.
Aber: gibt’s auch analog, in: Benetka, Gerhard, Guttmann, Giselher: „Akademische Psychologie in Österreich. Ein historischer Überblick. In: Karl Acham (HG.) (2001): Geschichte der österreichischen Humanwissenschaften. Band 3.1: Menschliches Verhalten und gesellschaftliche Institutionen: Einstellungen, Sozialverhalten, Verhaltensorientierung. Wien, S. 90.:
Brentano war ein charismatischer Lehrer. Die Wirkung, die er über seine Vorlesungstätigkeit an den Universitäten Würzburg und Wien entfaltete, ist kaum zu überschätzen. In Würzburg, wo er von 1866 an als Privatdozent und seit 1872 als ao. Professor lehrte, zählten für die spätere Entwicklung von Philosophie und Psychologie so bedeutsame Persönlichkeiten wie Carl Stumpf, Anton Marty und Hermann Schell, in Wien dann neben Edmund Husserl, Kasimir Twadowski, Christian von Ehrenfels, Alexius Meinong, Franz Hillebrand auch Thomas Masaryk und Sigmund Freud zu seinen Schülern.
[iv] Sigmund Freud hat wohl am meisten zur Zertrümmerung des Subjekts beigetragen, am wichtigsten finde ich dazu seine metapsychologischen Schriften. Die bahnbrechende Schrift Das Ich und das Es sei hier stellvertretend genannt, z.B.: Freud, Sigmund (200712): Das Ich und das Es. Frankfurt a.M., S.254: „Den meisten philosophisch Gebildeten ist die Idee eines Psychischen, das nicht auch bewußt ist, so unfaßbar, daß sie ihnen absurd und durch bloße Logik abweisbar erscheint. Ich glaube, dies kommt nur daher, daß sie die betreffenden Phänomene der Hypnose und des Traums, welche – vom Pathologischen ganz abgesehen – zu solcher Auffassung zwingen, nie studiert haben. Ihre Bewußtseinspsychologie ist aber auch unfähig, die Probleme des Traums und der Hypnose zu lösen.“
[v] Freud, Sigmund (1912): „Einige Bemerkungen über den Begriff des Unbewussten in der Psychoanalyse“ in: ders.(200712): Das Ich und das Es. Frankfurt a. M., S.41.
[vi] In: Derrida, Jacques (200812): Die Schrift und die Differenz. Frankfurt a.M., 302-350.
[vii] Freud, Sigmund (1895): „Entwurf einer Psychologie“, in: Ders. (1999): Briefe an Wilhelm Fließ 1887 – 1904.
Frankfurt a.M. Oder, für die Arbeit verwendet, in: Ders. (1999): Gesammelte Werke Nachtragsband Texte aus den
Jahren 1885 - 1938 , Frankfurt a.M., S. 386-477. [In Zukunft zitiert als EP]
[viii] Freud, Sigmund (1925): „Notiz über den «Wunderblock»“, in: Ders. (200712): Das Ich und das Es. Frankfurt a. M., S. 311 -318.[In Zukunft zitiert als NW]
[ix] EP, 387.
[x] Siehe Endnote 3.
[xi] EP, 387.
[xii] EP, 387.
[xiii] Genaueres erklärt der Text nicht, David Link nennt das Qή in seiner Inaugural-Dissertation Poesiemaschinen/ Maschinenpoesie auf S. 155 „geistige Energie“. Das gefällt mir gut, trifft die Sache aber fürchte ich nicht so ganz. Siehe dazu: http://edoc.hu-berlin.de/dissertationen/link-david-2004-07-27/PDF/Link.pdf (Zugriff: 8.12.2008)
[xiv] EP, 389.
[xv] EP, 389.
[xvi] EP, 390.
Häufig gestellte Fragen
Welche Texte von Freud analysiert Jacques Derrida in seinem Essay?
Derrida bezieht sich primär auf den „Entwurf einer Psychologie“ (1895) und die „Notiz über den Wunderblock“ (1925).
Was ist das Hauptthema der Untersuchung von Derrida?
Er untersucht die Entwicklung von Freuds Denken weg von neurologischen Erklärungen hin zu einer metapsychologischen Theorie des Gedächtnisses und der Schrift.
Was versteht Freud unter dem Begriff „Bahnnung“?
Bahnung beschreibt den Prozess, bei dem psychische Energie (Quantität Q) bevorzugte Wege durch das Nervensystem (Neuronen) findet und so Erinnerungsspuren hinterlässt.
Warum ist der „Wunderblock“ für die Psychoanalyse relevant?
Freud nutzt den Wunderblock als Metapher für den Wahrnehmungsapparat, der gleichzeitig neue Eindrücke aufnehmen und dauerhafte Spuren (Gedächtnis) speichern kann.
Was kritisiert Derrida mit dem Begriff „Phonozentrismus“?
Derrida nutzt Freuds Texte, um seine Kritik an der Bevorzugung der gesprochenen Sprache gegenüber einer „immer schon existierenden, lautlosen Urschrift“ zu untermauern.
Wie erklärt Freud das Bewusstsein in seinen frühen Schriften?
In seinen frühen Entwürfen versucht Freud, Bewusstsein und psychische Zustände durch materielle Gesetze und die Bewegung von Quantitäten in Neuronen zu erklären.
- Citar trabajo
- mag. Markus Luef (Autor), 2009, Zitatserklärungen zu Derrida "Freud und der Schauplatz der Schrift", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/134519