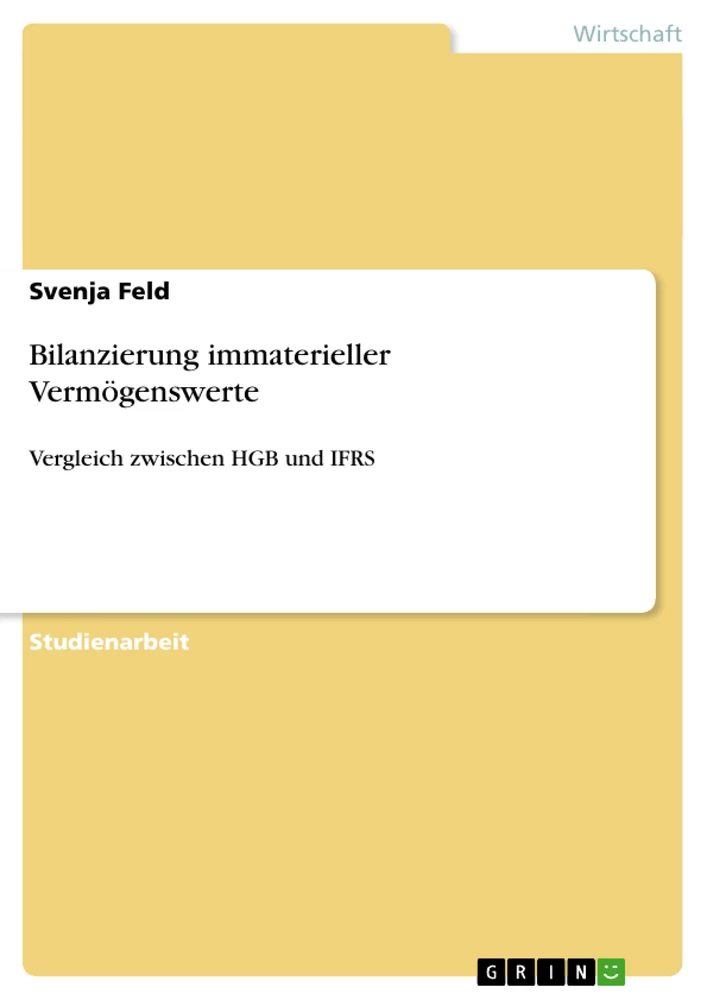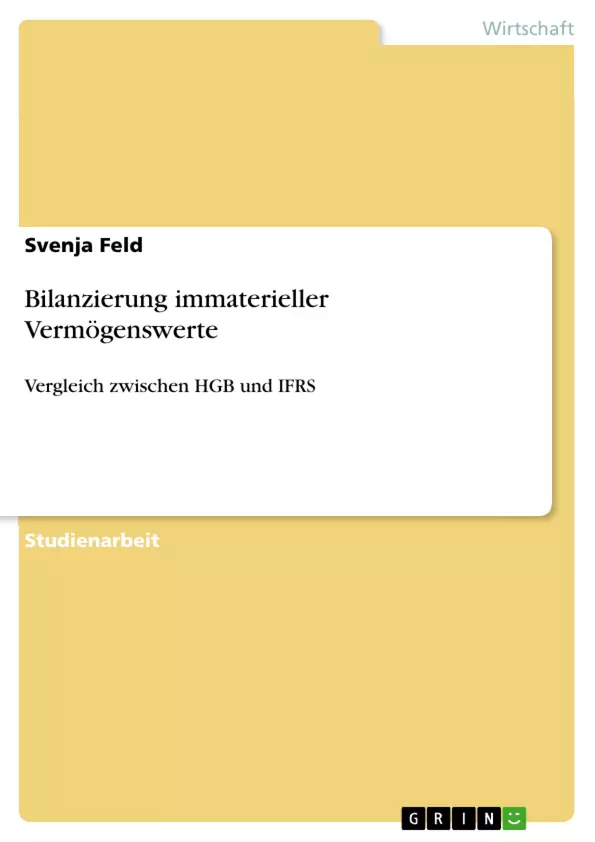Die Globalisierung der Wirtschaft bewirkt einen hohen Wettbewerbsdruck auf die Unternehmen. Die zunehmende internationale Verflechtung der Volkswirtschaften wird durch die steigende Bedeutung des Technologie-, Forschungs- und Informationssektors begünstigt. Vor diesem Hintergrund wird es für Unternehmen immer wichtiger, sich eine stabile Marktposition zu sichern. Materielle Werte gehen in ihrer Bedeutung in der Wertschöpfungskette zurück, wohingegen immateriellen Vermögenswerten im Zuge der betrieblichen Leistungserstellung ein immer größerer Stellenwert zugewiesen wird (vgl. Wagner, 2006, S. 1). Aufgrund ihrer steigenden Bedeutung machen immaterielle Werte, wie beispielsweise Software, Patent- oder Markenrechte, Mitarbeiter, Erfahrungen, Wissen, Lieferanten- oder Kundenbeziehungen, zu einem großen Anteil den eigentlichen Unternehmenswert aus (vgl. Haunerdinger und Probst, 2004, S. 42; Wagner, 2006a, S. 433).
Die Abbildung immaterieller Vermögensgegenstände stellt Unternehmen vor neue Herausforderungen, da diese Werte nicht unmittelbar greifbar bzw. physisch erkennbar sind. Sie können im Vergleich zu physischen Gütern in einer Bestandsaufnahme durch periodische Inventur nicht unmittelbar festgestellt werden und sind häufig sehr unternehmensspezifisch. Eine genaue Identifizierung und Bewertung sind somit oftmals sehr schwierig durchzuführen (vgl. Bertel, 2006, S. 107).
Im Folgenden wird die bilanzielle Behandlung von immateriellen Vermögensgegen-ständen im Rahmen eines Rechtsvergleiches der nationalen, deutschen Rechnungslegungsvorschriften (HGB) mit den internationalen Rechnungslegungsvorschriften (IAS/IFRS) dargestellt. Um die Unterschiede in den jeweiligen Vorschriften nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) und den International Financial Reporting Standards (IFRS) aufzuzeigen, werden die folgenden drei zentralen Fragestellungen in dieser Arbeit beantwortet:
• Wann entsteht ein immaterieller Vermögensgegenstand nach HGB und IFRS?
• Welche unterschiedlichen Ansatz- und Bewertungsvorschriften sind den immateriellen Vermögenswerten nach HBG und IFRS zu Grunde zu legen?
• Wie ist die Aussagekraft der beiden Rechnungslegungsvorschriften für den externen Leser zu beurteilen bzw. gewährt ein nach HGB oder IFRS erstellter Jahresabschluss dem Bilanzleser einen realistischen Einblick in das Unternehmensvermögen?
Inhaltsverzeichnis
- 1 Problemstellung
- 2 Grundlagen immaterieller Vermögenswerte
- 2.1 Der Begriff des immateriellen Vermögenswertes nach HGB
- 2.2 Der Begriff des immateriellen Vermögenswertes nach IFRS
- 2.3 Vergleich der Begriffsdefinitionen
- 3 Bilanzierung und Bewertung immaterieller Vermögenswerte
- 3.1 Ansatzvorschriften
- 3.1.1 Aktivierungsfähigkeit nach HGB
- 3.1.2 Aktivierungsfähigkeit nach IFRS
- 3.1.3 Vergleich der Ansatzvorschriften
- 3.2 Bewertungsvorschriften
- 3.2.1 Zugangs- und Folgebewertung nach HGB
- 3.2.2 Zugangs- und Folgebewertung nach IFRS
- 3.2.3 Vergleich der Bewertungsvorschriften
- 3.3 Vergleich der Aussagekraft
- 4 Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die bilanzielle Behandlung immaterieller Vermögensgegenstände im Vergleich zwischen den deutschen Handelsgesetzbuch (HGB) und den International Financial Reporting Standards (IFRS). Die Zielsetzung besteht darin, die Unterschiede in den Ansatz- und Bewertungsvorschriften aufzuzeigen und die Aussagekraft beider Systeme für den externen Bilanzleser zu beurteilen.
- Vergleich der Definitionen immaterieller Vermögenswerte nach HGB und IFRS
- Analyse der Ansatzvorschriften für immaterielle Vermögenswerte unter HGB und IFRS
- Untersuchung der Bewertungsvorschriften für immaterielle Vermögenswerte unter HGB und IFRS
- Bewertung der Aussagekraft der Bilanzierung immaterieller Vermögenswerte nach HGB und IFRS
- Herausforderungen der Bilanzierung immaterieller Vermögenswerte im Kontext der Globalisierung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Problemstellung: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein und beschreibt die steigende Bedeutung immaterieller Vermögenswerte in der heutigen Wirtschaft, insbesondere im Kontext der Globalisierung und des erhöhten Wettbewerbsdrucks. Es werden die Schwierigkeiten bei der Identifizierung und Bewertung immaterieller Werte hervorgehoben und die zentralen Forschungsfragen der Arbeit formuliert: Wann entsteht ein immaterieller Vermögensgegenstand nach HGB und IFRS? Welche unterschiedlichen Ansatz- und Bewertungsvorschriften gibt es? Wie ist die Aussagekraft der beiden Rechnungslegungssysteme für den externen Bilanzleser zu beurteilen?
2 Grundlagen immaterieller Vermögenswerte: Dieses Kapitel analysiert den Begriff des immateriellen Vermögenswertes sowohl nach HGB als auch nach IFRS. Es wird deutlich, dass das HGB im Gegensatz zu den IFRS keine explizite Definition bietet, sondern auf die Bilanzgliederung verweist. Der Vergleich der Definitionen zeigt Gemeinsamkeiten (z.B. Nicht-Monetärität, fehlende physische Substanz, zukünftiger wirtschaftlicher Nutzen) und Unterschiede in der Detailliertheit und der Konkretisierung der Kriterien (z.B. Identifizierbarkeit, Verfügungsmacht). Die Abgrenzungsprobleme aufgrund der oft vorhandenen Kombination materieller und immaterieller Komponenten werden angesprochen.
Schlüsselwörter
Immaterielle Vermögenswerte, HGB, IFRS, Bilanzierung, Bewertung, Ansatzvorschriften, Bewertungsvorschriften, Globalisierung, Wettbewerbsdruck, Aktivierung, Aussagekraft, Rechtsvergleich.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema "Bilanzierung immaterieller Vermögenswerte nach HGB und IFRS"
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die bilanzielle Behandlung immaterieller Vermögenswerte nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) und den International Financial Reporting Standards (IFRS). Es enthält ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der Ansatz- und Bewertungsvorschriften beider Rechnungslegungsstandards und der Beurteilung ihrer Aussagekraft für den externen Bilanzleser.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in folgende Kapitel: 1. Problemstellung, 2. Grundlagen immaterieller Vermögenswerte (inkl. Unterkapiteln zu HGB, IFRS und einem Vergleich), 3. Bilanzierung und Bewertung immaterieller Vermögenswerte (inkl. Unterkapiteln zu Ansatzvorschriften nach HGB und IFRS, Bewertungsvorschriften nach HGB und IFRS, einem Vergleich beider und der Aussagekraft), und 4. Schlussbetrachtung.
Was ist die Zielsetzung des Dokuments?
Die Zielsetzung besteht darin, die Unterschiede in den Ansatz- und Bewertungsvorschriften für immaterielle Vermögenswerte nach HGB und IFRS aufzuzeigen und die Aussagekraft beider Systeme für den externen Bilanzleser zu beurteilen. Es wird ein Vergleich der Definitionen, Ansatzvorschriften und Bewertungsvorschriften durchgeführt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die wichtigsten Themenschwerpunkte sind der Vergleich der Definitionen immaterieller Vermögenswerte nach HGB und IFRS, die Analyse der Ansatzvorschriften unter HGB und IFRS, die Untersuchung der Bewertungsvorschriften unter HGB und IFRS, die Bewertung der Aussagekraft der Bilanzierung nach HGB und IFRS und die Herausforderungen der Bilanzierung im Kontext der Globalisierung.
Wie werden immaterielle Vermögenswerte nach HGB und IFRS definiert?
Das HGB bietet keine explizite Definition, sondern verweist auf die Bilanzgliederung. Die IFRS hingegen bieten eine detailliertere Definition. Gemeinsamkeiten bestehen in der Nicht-Monetärität, dem Fehlen physischer Substanz und dem zukünftigen wirtschaftlichen Nutzen. Unterschiede liegen in der Detailliertheit und Konkretisierung der Kriterien (z.B. Identifizierbarkeit, Verfügungsmacht).
Welche Unterschiede gibt es bei den Ansatz- und Bewertungsvorschriften nach HGB und IFRS?
Das Dokument vergleicht die Aktivierungsfähigkeit und die Zugangs- und Folgebewertung nach HGB und IFRS. Es werden konkrete Unterschiede in den Vorschriften aufgezeigt, jedoch ohne detaillierte Darstellung der einzelnen Regelungen. Der Vergleich soll die unterschiedlichen Anforderungen und Auswirkungen auf die Bilanzierung verdeutlichen.
Welche Aussagekraft haben die Bilanzierungen nach HGB und IFRS?
Die Aussagekraft der Bilanzierung immaterieller Vermögenswerte nach HGB und IFRS wird im Dokument bewertet und verglichen. Es werden die Vor- und Nachteile beider Systeme für den externen Bilanzleser beleuchtet. Die detaillierte Bewertung ist jedoch nicht im FAQ enthalten, sondern im Hauptdokument zu finden.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Immaterielle Vermögenswerte, HGB, IFRS, Bilanzierung, Bewertung, Ansatzvorschriften, Bewertungsvorschriften, Globalisierung, Wettbewerbsdruck, Aktivierung, Aussagekraft, Rechtsvergleich.
Wo finde ich detailliertere Informationen?
Detailliertere Informationen zu den einzelnen Aspekten der Bilanzierung immaterieller Vermögenswerte nach HGB und IFRS finden sich in den einzelnen Kapiteln des Hauptdokuments.
- Citar trabajo
- Svenja Feld (Autor), 2008, Bilanzierung immaterieller Vermögenswerte , Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/134543