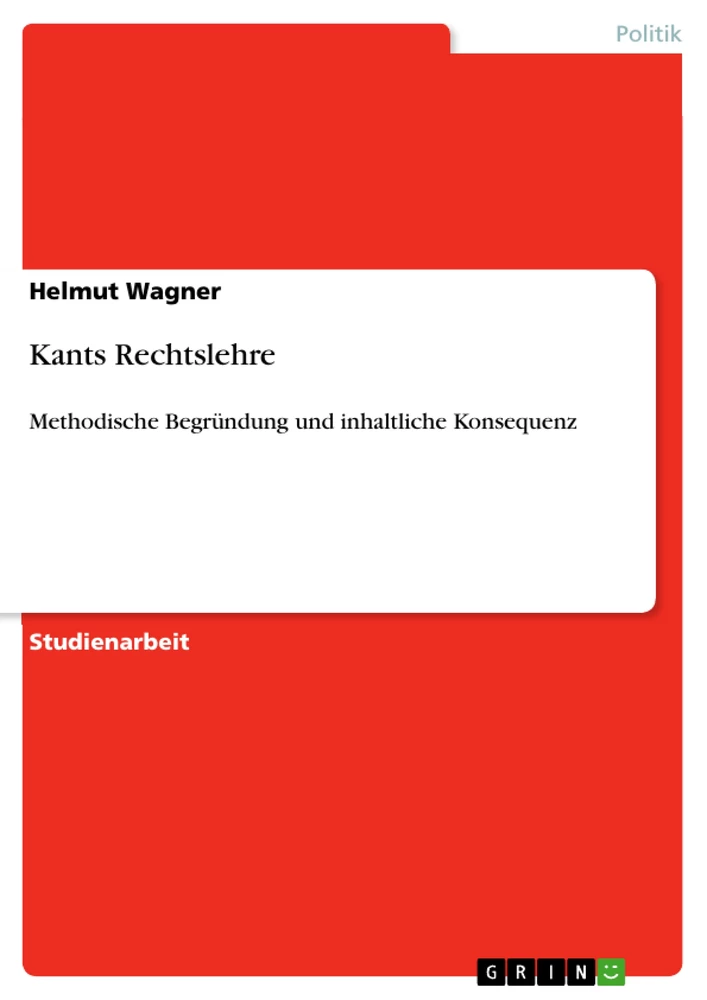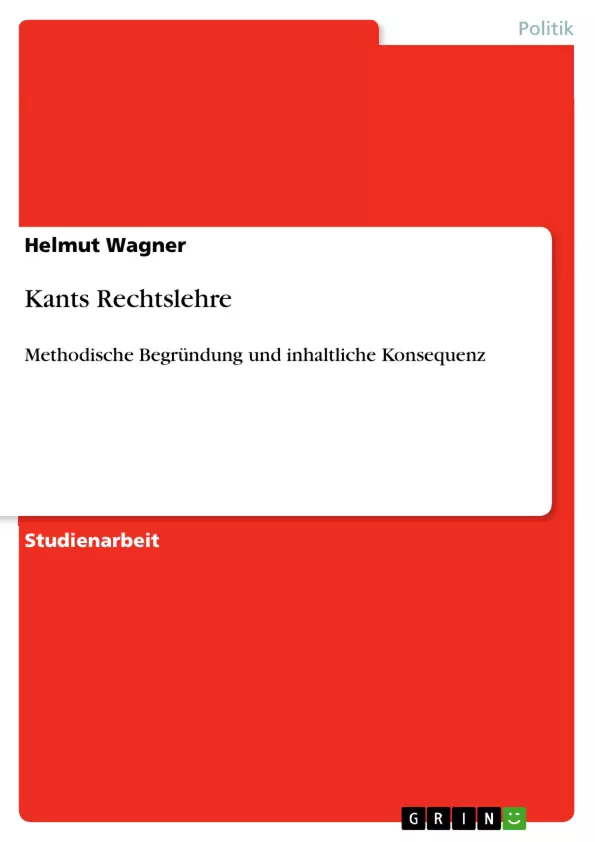Der Philosoph Immanuel Kant hinterließ uns ein geistiges Erbe, das auf einen besonderen Menschen und außergewöhnlichen Denker schließen lässt. Doch, so eine berechtigte Frage: inwiefern ist seine Philosophie überhaupt noch aktuell?
Entgegen der heute oft vorherrschenden Ansicht, dass die Staats- und Rechtsphilosophie keiner Begründung durch die Metaphysik mehr bedarf - wie z.B. in Rawls’ » politischer, nicht metaphysischer « Gerechtigkeitstheorie - hielt Kant die Metaphysik nämlich noch für eine unerlässliche Pflicht. Hierbei gilt es zunächst einmal zu unterscheiden, worauf die Rechtslehre eigentlich zielt. Denn wenn sie bloß auf die positiv geltende Rechtsordnung zielt, so scheint eine Metaphysik nicht zwingend erforderlich. Anders sieht es aber für den Fall einer Rechtsphilosophie aus, die sich als Rechtsethik versteht, wie dies bei Kant der Fall ist. Ihr liegt ja der normative Anspruch zugrunde, die letztgültigen Prinzipien aller positiven Rechtsordnung ethisch zu begründen, und nicht nur diejenigen der modernen liberalen Demokratie. Es geht also um die Legitimationsaufgabe von Philosophie für die Frage der rechtlich-politischen Organisation von Gesellschaft überhaupt, für die auch in der Epoche der Moderne gilt: » eine Metaphysik der Sitten voraussetzen […] ist […] Pflicht «.
Kant nimmt sich dieser Frage mutig an, mit einer systematischen Methodik und einer begrifflichen Klarheit, die ihresgleichen sucht und dabei auf seiner normativen Urteilskraft beruht. Zwar hat Kants Rechts- und Staatslehre in der Politischen Theorie wohl nicht die Wertschätzung erfahren, wie sie Platons Politeia und Aristoteles’ Politik für die Antike und Augustinus’ De civitate Dei für das Mittelalter beanspruchen können, und für die Neuzeit vor allem Hobbes’ Leviathan, Lockes Second Treatise und Rousseaus Contrat Social - dies tut seiner originären Leistung aber keinen Abbruch, denn sein Werk setzt v.a. Hoffnung in den Menschen.
Im Rahmen dieser Arbeit wird untersucht werden, wie Kant seine Rechtslehre begründet und welches Ziel er damit verfolgt. Dabei wird das Konzept der praktischen Vernunft als die methodische Grundlage vorgestellt und dann hinsichtlich seiner inhaltlichen Konsequenzen erläutert. In intensiver Auseinandersetzung mit der Forschungsliteratur wird der systematische Aufbau von Kants Rechtslehre leicht verständlich nachgezeichnet. Die Arbeit vermittelt dem Leser auf wenigen Seiten einen fundierten Überblick über die Grundzüge von Kants Rechtslehre.
INHALTSVERZEICHNIS
A Einleitung
B Gründzüge der Rechtslehre von Immanuel Kant
I. Die Neubegründung der Metaphysik durch das Konzept der praktischen Vernunft
II. Anwendung auf die Rechtslehre
1. Transzendentale Begründung
2. Praxisorientierte Ausrichtung
III. Inhaltliche Konsequenzen
1. Vom Privatrecht als dem Naturzustand
2. Vom Öffentlichen Recht als dem bürgerlichen Zustand
2.1. Das Staatsrecht
2.2. Das Völkerrecht
2.3. Das Menschen- und Weltbürgerrecht
C) Fazit
Literaturverzeichnis
A Einleitung
Der Philosoph Immanuel Kant (1724 - 1804) gilt gemeinhin als der Begründer des Deutschen Idealismus[1], dem als prominenteste Vertreter u. a. noch Fichte, Schelling und auch Hegel hinzugerechnet werden. Der Begriff Idealismus als solcher (abgeleitet vom gr. ιδέα, Idee, Urbild) bezeichnet dabei in einem sehr allgemeinen Sinne eine philosophische Tradition, welche Ideen als das eigentlich Wirkliche betrachtet, da diese der menschlichen Erfahrung vorausgehen und für jene eine konstitutive, oder - wie bei Kant - zumindest eine regulative Bedeutung haben. Bei genauer Betrachtung beinhaltet der Begriff dabei sowohl einen erkenntnistheoretischen als auch einen kritischen Aspekt: In erkenntnistheoretischer Hinsicht bedeutet er zunächst, dass die Wirklichkeit immer nur für ein Subjekt erscheinen kann. Damit wird nach Kant jedoch nicht gesagt, dass eben jene Wirklichkeit aus geistigen Schöpfungen des Ichs besteht (was man nach Henning Ottmann besser einen Spiritualismus nennt). Abzugrenzen ist zudem in begrifflicher Hinsicht der Realismus, welcher von einer objektiv erkennbaren Welt ausgeht. Diesem ist Kant ebenso wenig gewogen wie dem Materialismus, welcher die Wirklichkeit rein auf Materie und deren Gesetzmäßigkeiten reduziert - und diese nur aus ihrer materiellen Erscheinungsform erklären will. Was aber nun kennzeichnet den Deutschen Idealismus im Besonderen und inwiefern lässt sich darin wiederum Kant als ein Idealist bezeichnen? Was kennzeichnet seine politische Philosophie?
In historischer Hinsicht wird der Deutsche Idealismus häufig als ein philosophischer Entwurf zur Französischen Revolution, dem bedeutendsten Ereignis jener Zeit gesehen - als eine » Revolution im Kopfe «.[2] Hierfür steht in ideengeschichtlicher Hinsicht vor allem die Überzeugung, wonach sich das menschliche Handeln aus der Vernunft ideell begründen lässt und nicht länger empirischer Willkür ausgeliefert ist. So sieht Kant jeden Menschen als ein vernunftbegabtes Wesen mit einer natürlichen Anlage zur Metaphysik[3]: der Mensch stellt von sich aus Fragen nach dem höheren Sinn einer Ordnung, die sich immer nur transzendental, also von jeglicher Erfahrung unabhängig begründen lässt - d.h. nach apriorischen Prinzipien wie Freiheit, Gleichheit und Souveränität. Kant geht in seiner Philosophie davon aus, dass Ideen für unser Verständnis von Welt leitend sind, wir dabei jedoch auch immer abhängig bleiben von den Sinneseindrücken der Empirie. Nur in der sittlichen Erkenntnis kann sich der Mensch erheben. Deren Prinzipien zu verwirklichen ist ihm primär eine Frage des Rechts, das es auf die konkreten Verhältnisse anzuwenden gilt. Dabei zeigt sich immer wieder: Kant ist ein äußerst pragmatischer Idealist, der seine Theorie stets an der Praxis ausrichtet.
B Gründzüge der Rechtslehre von Immanuel Kant
I. Die Neubegründung der Metaphysik durch das Konzept der praktischen Vernunft
Mutig soll ein Philosoph genannt werden, der alle bisherigen Grundlagen des Wissens in Frage stellt, weil er bereit ist, zum Ursprung aller Erkenntnismöglichkeit vorzudringen. Am Ausgangspunkt von Kants Rechtslehre steht nicht weniger als das gewagte Unterfangen, die Philosophie als eine Disziplin neu zu begründen, indem er methodisch hinterfragt: » Wie ist Metaphysik als Wissenschaft möglich? «.[4] Er kritisiert dabei die traditionelle, primär auf Platon zurückgehende Metaphysik als rein spekulativ: sie habe die praktischen Interessen aus den Augen verloren und dadurch der Philosophie geschadet, sie als wirklichkeitsfremd in Verruf gebracht.[5] Indem sie sich stets in den Irrungen und Wirrungen der dialektischen Natur der kontemplativen Vernunft verliert - einem spekulativen Für und Wider, dem jeglicher Prüfstein der Erfahrung fehlt - folge sie einer Logik des Scheines, der nur zu Hirngespinsten führt und damit in Täuschung und Illusion. Dennoch postuliert Kant zugleich ein Grundbedürfnis des Menschen nach metaphysischen Fragestellungen und beklagt sich - vor allem im Hinblick auf die historische Tatsache, dass die positiven Naturwissenschaften im Zeitalter der Aufklärung der Philosophie zunehmend den Rang ablaufen - über die allseits zu beobachtende moralische Indifferenz gegenüber einer solchen Entwicklung. Denn all jener Fortschrittseuphorie seiner Epoche zum Trotz gibt es doch letzte Fragen nach dem höheren Sinn von Existenz, die keinem Menschen gleichgültig sein können, weil sie sein natürliches Anliegen sind: » Nun ist aber diese Art von Erkenntnis in gewissem Sinne doch auch als gegeben anzusehen, und Metaphysik ist, wenngleich nicht als Wissenschaft, doch als Naturanlage (metaphysica naturalis) wirklich. Denn die menschliche Vernunft geht unaufhaltsam [..] durch eigenes Bedürfnis getrieben bis zu solchen Fragen fort, die durch keinen Erfahrungsgebrauch der Vernunft und daher entlehnte Prinzipien beantwortet werden können, und so ist wirklich in allen Menschen […] irgendeine Metaphysik zu aller Zeit gewesen, und wird auch immer darin bleiben. «[6] Der Mensch ist mit Kant ein von Natur aus metaphysische Fragen stellendes Wesen, was in seiner Fähigkeit zur Vernunft begründet liegt und genau darin nach einer Antwort sucht.
Kant erkennt das grundlegende Bedürfnis dieser Erkenntnisform an und fragt nach den Bedingungen der Möglichkeit, dabei zu einer gesicherten Erkenntnis zu kommen.[7] Er möchte die Metaphysik - die er in ihrer bisherigen Form als gescheitert ansieht, und doch zugleich auch zukünftig als unbedingt notwenig erachtet - auf eine neue, eine methodische Grundlage stellen. Die grundsätzliche Frage, die er sich dabei stellt, lautet also: Wie ist eine synthetische Erkenntnis apriori, d.h. eine Erkenntnis, die frei von Erfahrung gewonnen wird und unsere bisherige Kenntnis erweitert, überhaupt möglich? Kant unterscheidet in seiner Kritik der reinen Vernunft zunächst zwischen zwei menschlichen Erkenntnisformen: dem Verstand und der Sinnlichkeit, die aber beide aufeinander angewiesen sind. Es ist der Verstand, der stets auf allgemeine Erkenntnis zielt, dabei jedoch auf die Sinnlichkeit zurückgeworfen ist, die ihm erst den Zugang zur Erfahrungswelt verschafft. Die Sinnlichkeit wiederum bedarf des Verstandes, wenn sie das Besondere der Erfahrungswelt mit allgemeinen Begriffen versehen und dadurch ordnen und systematisch verstehen will. Dies verdeutlicht Kant in einem seiner berühmten Sinnsprüche, wenn er schreibt: » Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind. «[8] Erfahrungsunabhängige Erkenntnis gibt es Kant zufolge nicht, weil mit dem Verstand nicht über die sinnliche Erfahrung hinausgegangen werden kann. Im Gegensatz zu Platon, der die rein verstandesgemäße Erkenntnis der höchsten Idee noch für möglich hielt, beschränkt sich nach Kant die menschliche Erkenntnis allein darauf, die Vielheit der Erscheinungen der Sinnenwelt auf die Einheit eines vom Individuum gedachten Begriffes zu synthetisieren[9] - die Idee (gr. eidos) hat keine konstitutive, sondern nur mehr eine regulative Funktion.[10]
Die angestrebte Neubegründung der Metaphysik gelingt ihm erst durch das Konzept der praktischen Vernunft, die mit einer methodologischen Aufwertung der Ethik einhergeht.[11] Kant begründet eine Metaphysik aus dem Sittlichen, weil er in der moralischen Urteilskraft des Menschen gemäß der Logik der reinen Vernunft die einzige Möglichkeit von apriorischer Erkenntnis sieht. Im moralischen Urteil kann sich der Mensch demnach über seinen Status als ein determiniertes Naturwesen, das den Kausalitätsgesetzen der sinnlichen Erscheinungswelt zu folgen gezwungen ist, sittlich erheben - was zugleich Bedingung seiner inhärenten Freiheit und Würde ist. Es entsteht somit ein Spannungsverhältnis zwischen dem Menschen als ein determiniertes Naturwesen und den Imperativen der moralischen Pflicht, welche ja Grundlage seiner Freiheit ist - eine Spannung, die sich in einer seltsamen inneren Zerrissenheit äußert.[12] Und genau aus dieser inneren Unruhe des Menschen, die zugleich seine metaphysica naturalis ausmacht, weil er nach Antworten sucht, motiviert sich Kants Bestreben, eine Metaphysik zu begründen, die sich an den praktischen Interessen der reinen Vernunft orientiert.[13] Nur im praktischen Gebrauch der reinen Vernunft erweist sich der Nutzen von Metaphysik.
II. Anwendung auf die Rechtslehre
Kant hält es also für möglich, dass der Mensch zu synthetischer Erkenntnis a priori gelangt - allerdings bedarf diese vernunftgemäße Erkenntnis dann wiederum der Überprüfung an der konkreten Empirie, vor der sie Bestand haben muss. Es handelt sich somit um einen zweischneidigen Vernunftbegriff: Demnach ist der Mensch als ein vernunftbegabtes Wesen qua seines Verstandes zwar fähig zur Einsicht in reine Ideale und letzte Prinzipien, diese apriorische Erkenntnis erhält ihre Relevanz jedoch erst durch die Anwendung auf die Praxis
1. Transzendentale Begründung
Kants Rechtslehre baut vor allem auf der Kritik der reinen Vernunft, in welcher er die Philosophie mit dem Konzept der praktischen Vernunft auf eine neue methodische Grundlage stellt, sowie der anschließenden Grundlegung zur Metaphysik der Sitten auf. Darin gelingt ihm eine im Prinzip metaphysisch begründete Rechtstheorie a priori, deren Grundlage die reine Vernunftidee von Recht ist.[14] Ausgangspunkt ist ihm dabei eine unbedingte moralische Verpflichtung des Menschen, die er als Bedingung seiner Autonomie für so ursprünglich hält, dass sie keine weitere Ableitung duldet.[15] Sie findet Ausdruck in einer Ethik, der es um ein Handeln nach den richtigen Intentionen und Maximen geht, was konsequenterweise in den kategorischen Imperativ mündet: » Das oberste Prinzip der Tugendlehre ist: Handle nach einer Maxime der Zwecke, die zu haben für jedermann ein allgemeines Gesetz sein kann. «[16] Die von Kant somit angesetzte Möglichkeit einer vernünftigen Einsicht in letzte, handlungsleitende Zwecke und Prinzipien wird dann auch zur Grundlage seiner Konzeption von Politik, die primär als eine Rechtslehre zu verstehen ist. Apriorische, d.h. von der Erkenntnisfähigkeit der reinen Vernunft begründete Prinzipien wie Freiheit, Gleichheit und Selbstständigkeit, die sich auf den autonomen Menschen als Zweck an sich richten, bilden dabei die erste Grundlage seines Rechtsverständnisses.[17] Die Autonomie des Menschen als ein moralisch handelndes Subjekt zu sichern ist folglich zentrale Aufgabe des Rechts. Indem Kant seine Metaphysik der Sitten auf den Zweck einer autonomen und als solche zu achtenden Menschheit ausrichtet, eröffnet er - vom Boden der Metaphysik aus - die Möglichkeit einer juristisch konzipierten politischen Philosophie.[18] Abgesehen von ihrer transzendentalen Begründung gehört die Rechtslehre jedoch zum praktischen Teil der Metaphysik.[19] Sie bedeutet die Anwendung auf die konkrete Empirie, für die der Unterschied zwischen Moralität und Legalität entscheidend wird.
2. Praxisorientierte Ausrichtung
Allen W. Wood verweist ihn seinem Essay zu Kants Rechtslehre auf den angeblichen Fehler, neben der Tugendlehre auch die Rechtslehre und die sich daraus ergebenden Pflichten auf ein gemeinsames Prinzip zurückzuführen, den kategorischen Imperativ.[20] Denn nach dieser Interpretation wäre Recht nur ein Substrat derjenigen moralischen Verpflichtungen, für die eine Gesetzgebung möglich ist, so Wood. Das Recht als die Befähigung, andere unter den äußeren Zwang des Gesetzes zu stellen, um dadurch die Autonomie der Menschen zu gewährleisten, ergäbe sich demnach aus der Ableitung aus dem moralischen Imperativ. Wood jedoch bestreitet dies, weil nach seiner Lesart die Rechtslehre im Gegensatz zur Tugendlehre, welche synthetisch begründet ist, keiner apriorischen Einsichtnahme bedarf, da sie analytisch konzipiert ist. Das allgemeine Prinzip der Ethik, der kategorische Imperativ, lautet dabei nach Kant, in einer anderen Formulierung als eben noch: » Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. «[21] Dieser kategorische Imperativ beansprucht als solcher Geltung im Bereich der Moralität als innere Gesetzgebung und richtet sich an das ethische Handeln des Einzelnen. Im Unterschied dazu formuliert Kant für den Bereich der Legalität als äußere Gesetzgebung, die das friedliche Zusammenleben der Menschen in Freiheit regeln soll, das allgemeine Prinzip des Rechts wie folgt: » Eine Handlung ist recht, die oder nach deren Maxime die Freiheit der Willkür eines jeden mit jedermanns Freiheit nach einem allgemeinen Gesetze zusammen bestehen kann. «[22]
Nun behauptet die von Woods kritisierte Position, dass das allgemeine Rechtsprinzip eine Ableitung aus dem moralischen Imperativ sei, die sich durch dessen Anwendung auf den Bereich des Rechts ergibt - auch Ottmann verweist auf Parallelen.[23] Wood verfolgt jedoch eine andere Argumentation, indem er behauptet, dass sich die beiden Prinzipien nicht miteinander vereinbaren ließen, weil sie unterschiedlich begründet seien. So beinhalte das Prinzip des Rechts kein explizites Wollen des handelnden Subjekts und sei deshalb auch kein Bestandteil des ethischen Prinzips. Im Gegensatz zu diesem sei jenes nicht synthetisch begründet, da es nicht nötig sei, über empirische Erfahrung hinauszugehen, um zu verstehen, dass äußere Gesetze notwendig sind, um eine Koexistenz in Freiheit zu gewähren. Ottmann zufolge lässt Kant beide Argumentationsstränge nebeneinander bestehen und es ist umstritten, inwiefern er Recht und Moral voneinander trennen kann und will. Doch stellt sich hier meiner Meinung nach schon auch die Frage, was die Grundintention von Kants Philosophie ist?
[...]
[1] Vgl. Ottmann, H., Politisches Denken, Bd. III/2, 2008, S.143-144
[2] Ebd., S.143
[3] Grondin, J., Kant, 1994, S.13-14
[4] Kant, I., Kritik, 1998, S.77
[5] Vgl. Grondin, J., Kant, 1994, S.7-30
[6] Kant, I., Kritik, 1998, S.75
[7] Vgl. Grondin, J., Kant, 1994, S.31-34
[8] Kant, I., Kritik, 1998, S.130
[9] Grondin, J., Kant, 1994, S.46
[10] Ottmann, H., Politisches Denken, Bd. III/2, 2008, S.146
[11] Grondin, J., Kant, 1994, S.40
[12] Ottmann, H., Politisches Denken, Bd. III/2, 2008, S.147
[13] Grondin, J., Kant, 1994, S.94
[14] Höffe, O., Einführung, 1999, S.3
[15] Grondin, J., Kant, 1994, S.114
[16] Kant, I., Metaphysik, 1954, Einl. Tugendlehre, IX., S.237
[17] Ottmann, H., Politisches Denken, Bd. III/2, 2008, S.147
[18] Grondin, J., Kant, 1994, S.119
[19] Höffe, O., Einführung, 1999, S.10
[20] Vgl. Wood, A., Doctrine of Right, 1999
[21] Kant, I., Grundlegung, 1999, S.45
[22] Ders., Metaphysik, 1954, Einl. Rechtslehre, § C, S.35
[23] Vgl. Ottmann, H., Politisches Denken, Bd. III/2, 2008, S.177-178
Häufig gestellte Fragen
Warum hielt Kant die Metaphysik für eine unerlässliche Pflicht?
Für Kant ist der Mensch ein vernunftbegabtes Wesen mit einer "Naturanlage zur Metaphysik". Um Rechtsethik und letztgültige Prinzipien einer Rechtsordnung zu begründen, bedarf es einer Metaphysik der Sitten.
Was ist der Unterschied zwischen Privatrecht und Öffentlichem Recht bei Kant?
Das Privatrecht ordnet Kant dem "Naturzustand" zu, während das Öffentliche Recht den "bürgerlichen Zustand" beschreibt, der durch staatliche Gesetze und Institutionen gesichert wird.
Was bedeutet "praktische Vernunft" in Kants Rechtslehre?
Die praktische Vernunft ist die Fähigkeit des Menschen, sein Handeln nach moralischen Gesetzen und apriorischen Prinzipien (wie Freiheit und Gleichheit) auszurichten, unabhängig von empirischer Willkür.
Wie begründet Kant das Völkerrecht?
Kant sieht das Völkerrecht als notwendige Erweiterung des Rechtszustands auf die Beziehungen zwischen Staaten, um einen dauerhaften Frieden und eine weltbürgerliche Ordnung zu ermöglichen.
Ist Kants Rechtsphilosophie heute noch aktuell?
Ja, besonders sein normativer Anspruch, Rechtsordnungen ethisch zu legitimieren, und sein Fokus auf Menschenrechte und Weltbürgerrecht sind zentrale Grundlagen moderner Demokratien.
Was kritisiert Kant an der traditionellen Metaphysik?
Er kritisiert sie als rein spekulativ und wirklichkeitsfremd. Er möchte sie auf eine methodische Grundlage stellen, die sich an den praktischen Interessen der Vernunft orientiert.
- Quote paper
- Helmut Wagner (Author), 2009, Kants Rechtslehre, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/134670