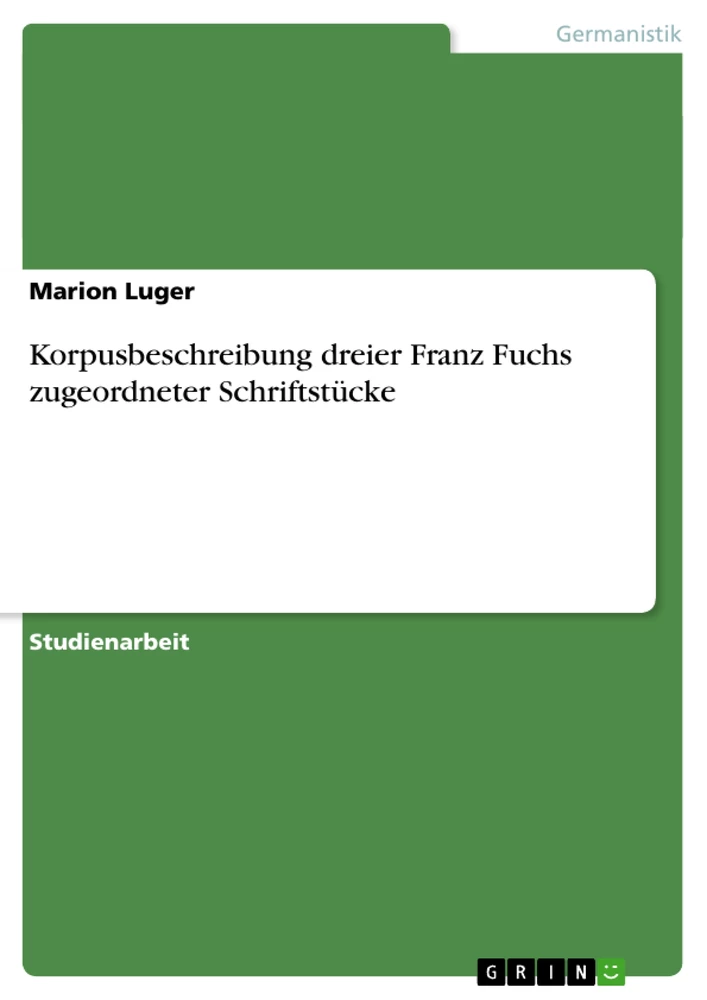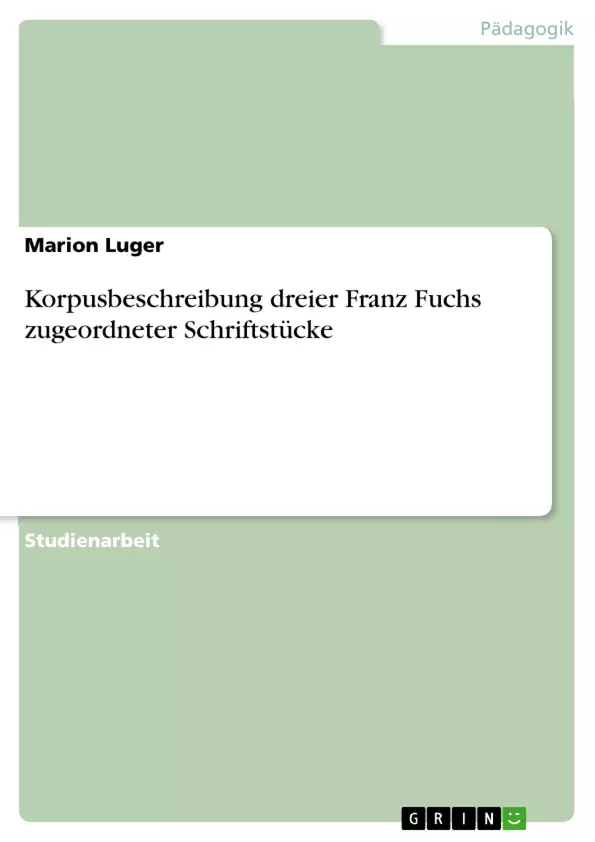Nachdem von 1993 bis 1997 eine Briefbombenserie Österreich erschütterte, die von acht „Bekennerschreiben“ begleitet gewesen war, wurde im Jahr 1999 der Steirer Franz Fuchs als Beteiligter dieser Anschläge rechtskräftig verurteilt. Die vorliegende Arbeit soll nun drei - Franz Fuchs zugeschriebene - Textkorpora untersuchen und so eine Basis für einen Vergleich mit den Tatschriften schaffen, um Aufschluss darüber zu erhalten, ob ihm wirklich alle „Bekennerschreiben“ zur Last gelegt werden können.
Beim ersten der zu beschreibenden Schriftstücke handelt es sich um einen Brief, den Franz Fuchs einem Vizeleutnant des österreichischen Bundesheeres zukommen ließ, der im Radio über die Not von Flüchtlingen aus dem ehemaligen Jugoslawien berichtet hatte. Das zweite Schreiben stellt einen von Franz Fuchs am 8. August 1976 verfassten Abschiedsbrief an seine Eltern dar. Fuchs’ Vater fand den Brief und ließ den Sohn daraufhin in die psychiatrische Anstalt in Graz einliefern. Die dritte Vergleichsschrift, die man als „Entwurf für ein Bekennerschreiben“ bezeichnen könnte, wurde schließlich nach der Verhaftung von Franz Fuchs in dessen Wohnung gefunden.
Zu prüfen sind das Ausmaß und die Bedingungen der Übereinstimmungen zwischen den Vergleichstexten und das Verhältnis aller drei zu der üblichen Norm der deutschen Sprache. Intention der Arbeit ist es, auf zahlreiche einzelne Merkmale der drei Korpora hinzuweisen, um für den Vergleich mit den BKS möglichst viele Anhaltspunkte für einen „individuellen Stil“ geben zu können. Darüber hinaus soll abschließend über homo- und heterogene textübergreifende Merkmalskonfigurationen resümiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Causa „Franz Fuchs“ und das vorliegende Korpus
- 3. Formale Beschreibung
- 4. Bestimmung der Textsorten
- 5. Isotopie
- 6. Themen
- 6.1. Themenentfaltung
- 7. Textkonnektoren
- 7.1. Verweisformen
- 7.2. Textorganisatoren
- 7.3. Gliederungssignale
- 7.4. Rhetorische Mittel
- 7.4.1. Rhetorische Figuren
- 7.4.2. Redetaktiken
- 8. Sprechakte
- 9. Stil - Kolloquialismen
- 10. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert drei Franz Fuchs zugeschriebene Texte (Vergleichstexte VGT 1-3) mittels textlinguistischer Methoden. Ziel ist es, sprachliche Merkmale zu identifizieren, die einen Vergleich mit den Bekennschreiben der Briefbombenserie ermöglichen und Hinweise auf die Urheberschaft liefern. Die Ergebnisse sollen Aufschluss darüber geben, ob Fuchs tatsächlich für alle Anschläge verantwortlich ist.
- Analyse der formalen Eigenschaften der Texte (Orthographie, Interpunktion, Grammatik).
- Bestimmung der Textsorten und deren konventioneller Merkmale.
- Untersuchung der Isotopieketten und -netze zur Ermittlung semantischer Zusammenhänge.
- Identifizierung der Haupt- und Nebenthemen sowie deren Entfaltungsmuster.
- Analyse von Textkonnektoren (Verweisformen, rhetorische Mittel etc.) und Sprechakten.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der forensischen Linguistik ein und beschreibt die Herausforderungen bei der Autorenidentifizierung anhand linguistischer Textanalysen. Sie diskutiert die Problematik des "Individualtils" und die Möglichkeit der Nachahmung, betont die Notwendigkeit einer vorsichtigen Interpretation linguistischer Daten und skizziert den Ansatz dieser Arbeit, textlinguistische Methoden auf den forensischen Textvergleich anzuwenden, um individuelle Abweichungen von sprachlichen Regularitäten aufzuzeigen. Die Arbeit betont die Notwendigkeit einer multiperspektivischen Analyse, die sprachliche, thematische und kommunikativ-pragmatische Ebenen umfasst.
2. Die Causa „Franz Fuchs“ und das vorliegende Korpus: Dieses Kapitel beschreibt den Kontext der Arbeit, nämlich die Briefbombenserie in Österreich und die rechtskräftige Verurteilung von Franz Fuchs. Es werden drei Texte vorgestellt, die als Vergleichsbasis für die Analyse der Bekennschreiben dienen: ein Brief an einen Vizeleutnant, ein Abschiedsbrief an seine Eltern und ein Entwurf für ein Bekennschreiben. Die Kapitel erläutert die Herausforderungen bei der Untersuchung aufgrund des fehlenden Zugangs zu den Originaldokumenten.
3. Formale Beschreibung: Aufgrund des Mangels an Originaldokumenten wird auf eine detaillierte äußere Textkritik verzichtet. Das Kapitel beschreibt dennoch die verfügbaren Informationen zur äußeren Form der Texte, wie z.B. handgeschriebene Korrekturen und den Umfang der analysierbaren Worteinheiten. Es analysiert Besonderheiten in Orthographie, Interpunktion, Zahlenschreibung und Datumsangaben und stellt fest, dass es trotz der indirekten Quellenlage keine Verstöße gegen die Regeln der deutschen Rechtschreibung gibt.
4. Bestimmung der Textsorten: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Textsorte" und unterscheidet zwischen Textsorten und Texttypen. Es analysiert die drei Vergleichstexte anhand verschiedener Kriterien (Textfunktion, Thema, thematische Entfaltung, sprachlich-stilistische Ausformung) und ordnet sie den Textsorten "Hörerbrief", "Abschiedsbrief" und (ungewöhnliche Ausprägung von) "Bekennerschreiben" zu. Das Kapitel diskutiert die Abweichungen der Texte von den konventionellen Merkmalen der jeweiligen Textsorten.
5. Isotopie: Das Kapitel erklärt das semantische Modell der Isotopie und analysiert die in den Vergleichstexten vorhandenen Isotopieketten und -netze. Es beschreibt die semantischen Beziehungen zwischen den Lexemen und identifiziert die zentralen semantischen Felder, die den Textzusammenhang gewährleisten.
6. Themen: Dieses Kapitel bestimmt die Haupt- und Nebenthemen der drei Vergleichstexte. Es analysiert die Themen "Angst vor Überfremdung und Aussterben der Deutschen" (VGT 1), "Beschreibung der Umstände des Suizids" (VGT 2), und "Lächerlichmachen der Gegner" (VGT 3). Die einzelnen Teilthemen werden detailliert aufgezeigt.
6.1. Themenentfaltung: Die Kapitel beschreibt die unterschiedlichen Arten der Themenentfaltung (deskriptiv, narrativ, explikativ, argumentativ) und analysiert die in den drei Vergleichstexten dominierenden Muster. Es zeigt, wie die Hauptthemen in den einzelnen Texten sprachlich präsentiert und entwickelt werden.
7. Textkonnektoren: Dieses Kapitel untersucht die sprachlichen Elemente, die zur Verknüpfung von Sätzen und Absätzen beitragen. Es analysiert Verweisformen (Pronomen, Artikel, Adverbien, Deiktika), Textorganisatoren, Gliederungssignale und rhetorische Mittel (Figuren und Taktiken) in den Vergleichstexten und erklärt deren Funktion für den Textzusammenhang.
8. Sprechakte: Der Kapitel erklärt die Sprechakttheorie und analysiert die in den Vergleichstexten realisierten Sprechakte (lokutiv, illokutiv, perlokutiv). Es identifiziert die dominierenden Illokutionen in jedem Text und diskutiert deren Funktion im kommunikativen Kontext.
9. Stil - Kolloquialismen: Dieses Kapitel analysiert den Stil der Texte und untersucht die Verwendung von Kolloquialismen. Es listet verschiedene umgangssprachliche Wendungen auf und diskutiert deren Bedeutung im Kontext der gesamten Analyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse der Texte von Franz Fuchs
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert drei Franz Fuchs zugeschriebene Texte (Vergleichstexte VGT 1-3) mithilfe textlinguistischer Methoden. Ziel ist der Vergleich mit den Bekennschreiben der Briefbombenserie, um Hinweise auf die Urheberschaft zu finden und die Frage nach Fuchs' alleiniger Verantwortung für alle Anschläge zu klären.
Welche Texte wurden untersucht?
Es wurden drei Texte untersucht: ein Brief an einen Vizeleutnant (VGT 1), ein Abschiedsbrief an seine Eltern (VGT 2) und ein Entwurf für ein Bekennschreiben (VGT 3). Die Analyse basiert auf Kopien, da der Zugang zu den Originaldokumenten nicht möglich war.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Analyse verwendet textlinguistische Methoden, darunter die Untersuchung der formalen Eigenschaften (Orthographie, Interpunktion, Grammatik), die Bestimmung der Textsorten, die Analyse von Isotopien, die Identifizierung von Themen und deren Entfaltung, die Analyse von Textkonnektoren (Verweisformen, rhetorische Mittel etc.), die Analyse von Sprechakten und die Untersuchung des Stils, insbesondere der Verwendung von Kolloquialismen.
Welche Aspekte der formalen Beschreibung wurden berücksichtigt?
Aufgrund fehlender Originaldokumente wurde auf detaillierte äußere Textkritik verzichtet. Die Analyse konzentrierte sich auf verfügbare Informationen zur äußeren Form, wie handgeschriebene Korrekturen und den Umfang der analysierbaren Worteinheiten. Besonderheiten in Orthographie, Interpunktion, Zahlenschreibung und Datumsangaben wurden untersucht.
Wie wurden die Textsorten bestimmt?
Die Texte wurden anhand von Kriterien wie Textfunktion, Thema, thematische Entfaltung und sprachlich-stilistische Ausformung analysiert und den Textsorten "Hörerbrief", "Abschiedsbrief" und (ungewöhnliche Ausprägung von) "Bekennerschreiben" zugeordnet. Abweichungen von konventionellen Merkmalen der jeweiligen Textsorten wurden diskutiert.
Wie wurde die Isotopie analysiert?
Das Kapitel erklärt das semantische Modell der Isotopie und analysiert die in den Vergleichstexten vorhandenen Isotopieketten und -netze. Es beschreibt die semantischen Beziehungen zwischen den Lexemen und identifiziert die zentralen semantischen Felder, die den Textzusammenhang gewährleisten.
Welche Themen wurden identifiziert?
Die Haupt- und Nebenthemen der Texte wurden bestimmt. Dazu gehören "Angst vor Überfremdung und Aussterben der Deutschen" (VGT 1), "Beschreibung der Umstände des Suizids" (VGT 2), und "Lächerlichmachen der Gegner" (VGT 3). Die einzelnen Teilthemen werden detailliert aufgezeigt.
Wie wurde die Themenentfaltung analysiert?
Die Arbeit beschreibt die unterschiedlichen Arten der Themenentfaltung (deskriptiv, narrativ, explikativ, argumentativ) und analysiert die in den drei Vergleichstexten dominierenden Muster. Es zeigt, wie die Hauptthemen in den einzelnen Texten sprachlich präsentiert und entwickelt werden.
Wie wurden Textkonnektoren untersucht?
Die Analyse untersucht sprachliche Elemente zur Satz- und Absatzverknüpfung: Verweisformen (Pronomen, Artikel, Adverbien, Deiktika), Textorganisatoren, Gliederungssignale und rhetorische Mittel (Figuren und Taktiken). Ihre Funktion für den Textzusammenhang wird erklärt.
Wie wurden Sprechakte analysiert?
Die Arbeit erklärt die Sprechakttheorie und analysiert die in den Vergleichstexten realisierten Sprechakte (lokutiv, illokutiv, perlokutiv). Die dominierenden Illokutionen in jedem Text und deren Funktion im kommunikativen Kontext werden identifiziert.
Wie wurde der Stil, insbesondere die Verwendung von Kolloquialismen, untersucht?
Der Stil der Texte wird analysiert, insbesondere die Verwendung von Kolloquialismen. Umgangssprachliche Wendungen werden aufgelistet und im Kontext der gesamten Analyse diskutiert.
Welche Schlussfolgerungen wurden gezogen?
Die Arbeit zielt darauf ab, sprachliche Merkmale zu identifizieren, die einen Vergleich mit den Bekennschreiben der Briefbombenserie ermöglichen und Hinweise auf die Urheberschaft liefern. Die Ergebnisse sollen Aufschluss darüber geben, ob Fuchs tatsächlich für alle Anschläge verantwortlich ist. Die Interpretation der linguistischen Daten wird als vorsichtig und multiperspektivisch (sprachliche, thematische und kommunikativ-pragmatische Ebenen) beschrieben.
- Arbeit zitieren
- Marion Luger (Autor:in), 2000, Korpusbeschreibung dreier Franz Fuchs zugeordneter Schriftstücke, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/134918