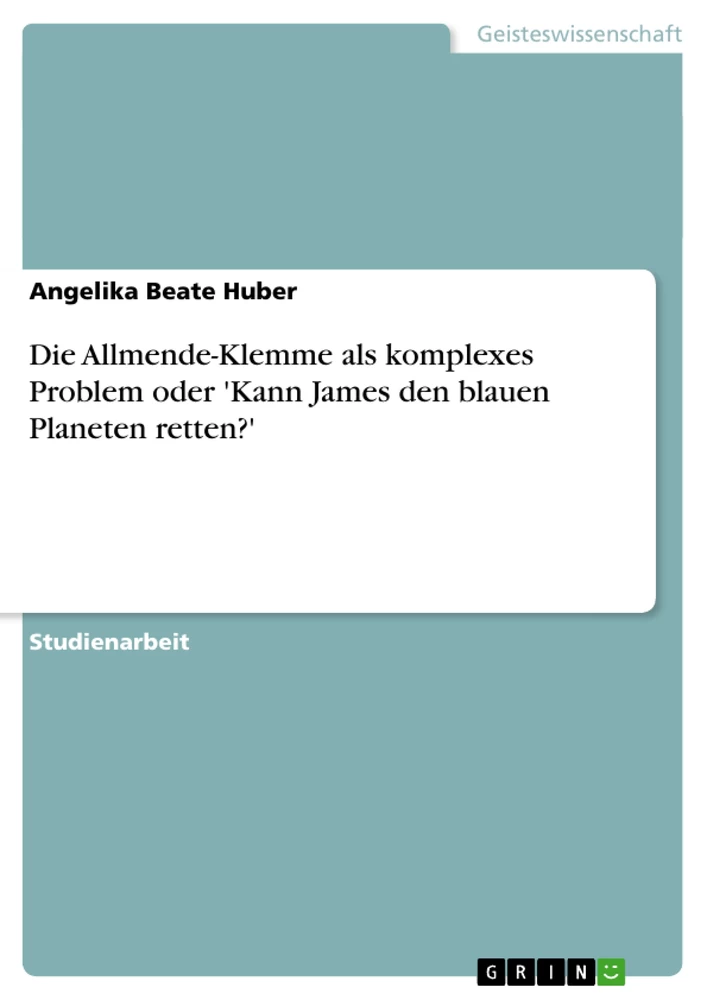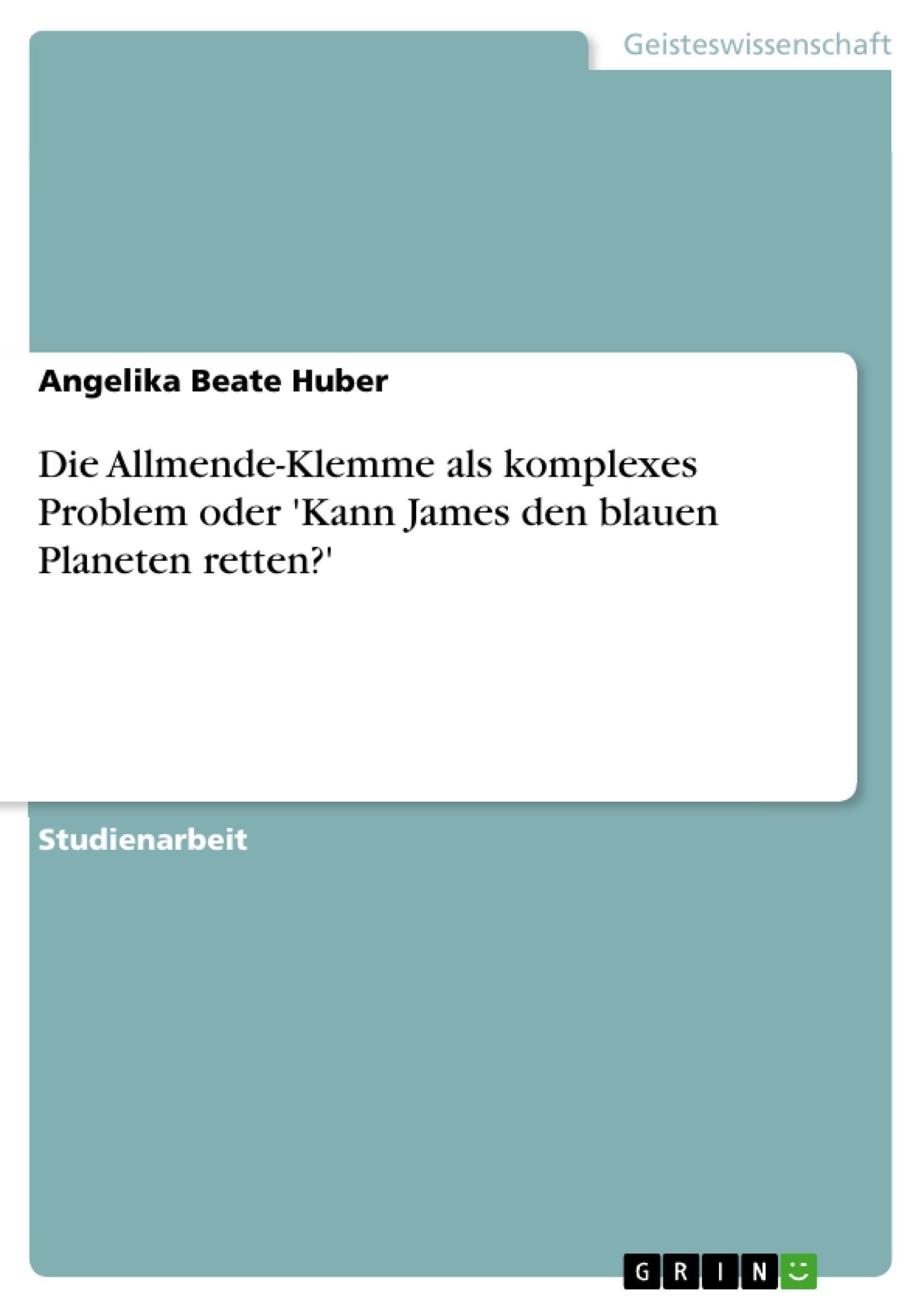„Die Katastrophe hat mich in meinen Grundfesten erschüttert“ titelte die
Berliner Morgenpost am 7. September 2002 einen Artikel zur Elbeflut im
letzten Jahr. Die persönliche Betroffenheit in der Aussage eines freiwilligen
Helfers, zu den Folgen der Überflutung, ist nicht zu überhören.
Dass Naturkatastrophen ständig zunehmen ist in Versicherungskreisen längst
ein Thema. Die Branche rechnet für das nächste Jahrzehnt mit einer
Schadenshöhe von 25-50 Milliarden Dollar, die durch Naturkatastrophen
verursacht werden soll (Linneweber, 2001). Unsere Umwelt, so scheint es,
gerät allmählich aus dem Gleichgewicht.
Um die Zusammenhänge zwischen menschlichem Verhalten und den
möglichen Folgen für die Umwelt aufzuzeigen, bietet sich das Modell der
Allmende-Klemme an. In Kapitel 2 werden zuerst allgemeine Überlegungen
zum Verständnis angestellt. Daran anschließend folgen Merkmale, die typisch
für Allmende-Klemmen sind.
Am Beispiel der Trinkwasserversorgung auf unserem „blauen Planeten“ wird
eine reale Allmende-Klemme näher ausgeführt. Um die später folgenden
theoretischen Sachverhalte anschaulicher zu machen, wird auf dieses Beispiel
im weiteren Text immer wieder zurückgegriffen.
Ökologische Systeme sind meist sehr komplex aufgebaut. Was allgemein unter
Komplexität verstanden wird und welche Probleme sich beim Verständnis
solcher Systeme ergeben können, ist Thema des vierten Kapitels.
Danach wird eine komplexe Theorie zur menschlichen Handlungsregulation
ausführlich vorgestellt. Da die Theorie sehr umfassend ist, reichen einfache
schematische Darstellungen nicht mehr aus, deshalb wurde versucht, die
Vorgaben durch eine PC-Simulation umzusetzen. Welche Überlegungen hier
maßgeblich waren erläutert Kapitel 6.
Es folgt die kritische Diskussion der gewonnenen Erkenntnisse. Ein kurzes
persönliches Resümee schließt die Arbeit ab.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretischer Rahmen und Definition von Allmende-Klemme
- 2.1 Spieltheorie und Gefangenendilemma
- 2.2 Allmende-Klemme
- 3 Die globale Trinkwasserversorgung als Beispiel für eine Allmende-Klemme
- 4 Komplexe Situationen
- 4.1 Definition
- 4.2 Kognitive Denkfehler
- 4.3 Motivationale Denkfehler
- 5 Die Handlungsregulations-Theorie (PSI-Theorie) von Dörner
- 5.1 Einordnung der Theorie
- 5.2 Was sind Bedürfnisse?
- 5.3 Erzeugung eines Motivs
- 5.4 Auswahl eines Motivs
- 5.5 Bedürfnisbefriedigung
- 6 Computersimulation einer komplexen Theorie am Beispiel der PSI-Theorie
- 6.1 Menschliche Psyche PC-Simulation – ein Widerspruch?
- 6.2 Das „Autonomie“-Projekt: Hintergrund zur Entstehung und Anwendungsmöglichkeit der Simulation
- 6.3 EmoRegul oder „Wer ist James?“
- 6.3.1 Umwelt und Umweltwahrnehmung
- 6.3.2 Modulation psychischer Prozesse im Programm EmoRegul
- 6.3.3 Ergebnisse
- 6.4 Beschreibung des „Insel“-Szenarios aus dem Autonomie-Projekt
- 6.4.1 Instruktion für die realen Versuchspersonen
- 6.4.2 „Insel“-Szenario
- 6.4.3 Ergebnisse
- 6.4.5 Ausblick (Sozionik-Projekt)
- 7 Diskussion der gewonnenen Ergebnisse
- 8 Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Konzept der Allmende-Klemme anhand des Beispiels der globalen Trinkwasserversorgung. Ziel ist es, die Komplexität dieser Problematik aufzuzeigen und die Grenzen menschlichen Verhaltens im Umgang mit ökologischen Dilemmata zu beleuchten. Die Arbeit nutzt dabei die Handlungsregulations-Theorie (PSI-Theorie) und deren Computersimulation zur Analyse.
- Das Konzept der Allmende-Klemme und seine Anwendung auf reale Probleme
- Die Rolle von kognitiven und motivationalen Denkfehlern im Kontext komplexer Situationen
- Die Anwendung der Handlungsregulations-Theorie (PSI-Theorie) zur Erklärung menschlichen Verhaltens
- Die Möglichkeiten und Grenzen von Computersimulationen zur Modellierung komplexer Systeme
- Die Herausforderungen der Bewältigung ökologisch-sozialer Dilemmata
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Allmende-Klemme ein und veranschaulicht die Bedeutung des Themas anhand von Naturkatastrophen und deren steigenden Auswirkungen. Sie stellt die globale Trinkwasserversorgung als ein Beispiel für eine Allmende-Klemme vor und skizziert den Aufbau der Arbeit, wobei die einzelnen Kapitel und deren jeweilige Schwerpunkte kurz beschrieben werden.
2 Theoretischer Rahmen und Definition von Allmende-Klemme: Dieses Kapitel legt den theoretischen Grundstein der Arbeit. Es erläutert die Spieltheorie, insbesondere das Gefangenendilemma, um das Kernproblem der Allmende-Klemme zu verdeutlichen. Die Definition der Allmende-Klemme wird präzisiert und ihre zentralen Merkmale werden herausgearbeitet, um ein fundiertes Verständnis für die nachfolgenden Analysen zu schaffen. Der Fokus liegt darauf, die individuellen Anreize zu erklären, die zu einem kollektiven Problem führen.
3 Die globale Trinkwasserversorgung als Beispiel für eine Allmende-Klemme: Dieses Kapitel veranschaulicht die abstrakten Konzepte aus Kapitel 2 anhand des konkreten Beispiels der globalen Trinkwasserversorgung. Es analysiert die Herausforderungen der nachhaltigen Wasserbewirtschaftung und zeigt auf, wie individuelle Handlungen und nationale Interessen zu einem globalen Problem führen können. Das Kapitel dient als Fallstudie, um die praktische Relevanz der Allmende-Klemme zu unterstreichen.
4 Komplexe Situationen: Hier wird der Begriff der Komplexität definiert und die Schwierigkeiten beim Verständnis komplexer Systeme herausgearbeitet. Das Kapitel identifiziert kognitive und motivationale Denkfehler, die unser Verständnis und unsere Entscheidungen in komplexen Situationen beeinflussen und die Lösung ökologischer Probleme erschweren. Die Ausführungen dieses Kapitels bilden die Grundlage für das Verständnis der Herausforderungen, vor denen die in Kapitel 5 vorgestellte Theorie steht.
5 Die Handlungsregulations-Theorie (PSI-Theorie) von Dörner: Dieses Kapitel beschreibt ausführlich die PSI-Theorie, ein komplexes Modell zur Erklärung menschlicher Handlungsregulation. Es werden die zentralen Elemente der Theorie erläutert, wie die Entstehung und Auswahl von Motiven sowie die Bedürfnisbefriedigung. Die Theorie dient als analytisches Werkzeug für die Interpretation der Ergebnisse der Computersimulation in Kapitel 6.
6 Computersimulation einer komplexen Theorie am Beispiel der PSI-Theorie: Kapitel 6 beschreibt die Umsetzung der PSI-Theorie in eine Computersimulation. Es werden die Herausforderungen und die Motivation hinter der Simulation erläutert. Der Fokus liegt auf der Beschreibung des "Insel"-Szenarios und der Interpretation der Ergebnisse. Die Simulation dient dazu, die Theorie praxisnah zu testen und die Grenzen menschlichen Entscheidungsverhaltens in komplexen Umwelten aufzuzeigen.
Schlüsselwörter
Allmende-Klemme, Spieltheorie, Gefangenendilemma, globale Trinkwasserversorgung, komplexe Systeme, kognitive Denkfehler, motivationale Denkfehler, Handlungsregulations-Theorie (PSI-Theorie), Computersimulation, ökologisch-soziale Dilemmata, Nachhaltigkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Analyse der Allmende-Klemme am Beispiel der globalen Trinkwasserversorgung
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht das Konzept der Allmende-Klemme anhand des Beispiels der globalen Trinkwasserversorgung. Sie analysiert die Komplexität dieser Problematik und beleuchtet die Grenzen menschlichen Verhaltens im Umgang mit ökologischen Dilemmata. Die Handlungsregulations-Theorie (PSI-Theorie) und deren Computersimulation dienen als zentrale Analysewerkzeuge.
Welche Theorie wird zur Analyse verwendet?
Die Arbeit verwendet die Handlungsregulations-Theorie (PSI-Theorie) von Dörner. Diese Theorie erklärt menschliche Handlungsregulation und wird zur Interpretation der Ergebnisse einer Computersimulation eingesetzt.
Welche konkreten Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: das Konzept der Allmende-Klemme und dessen Anwendung auf reale Probleme, die Rolle kognitiver und motivationaler Denkfehler in komplexen Situationen, die Anwendung der PSI-Theorie zur Erklärung menschlichen Verhaltens, die Möglichkeiten und Grenzen von Computersimulationen zur Modellierung komplexer Systeme und die Herausforderungen der Bewältigung ökologisch-sozialer Dilemmata.
Wie wird die Allmende-Klemme definiert und erklärt?
Die Allmende-Klemme wird im Kontext der Spieltheorie, insbesondere des Gefangenendilemmas, erklärt. Es wird gezeigt, wie individuelle Anreize zu einem kollektiven Problem führen, das die nachhaltige Nutzung gemeinschaftlicher Ressourcen gefährdet.
Welches Beispiel wird für die Allmende-Klemme verwendet?
Die globale Trinkwasserversorgung dient als konkretes Beispiel für eine Allmende-Klemme. Die Arbeit analysiert die Herausforderungen der nachhaltigen Wasserbewirtschaftung und zeigt, wie individuelle Handlungen und nationale Interessen zu einem globalen Problem führen können.
Welche Rolle spielen kognitive und motivationale Denkfehler?
Die Arbeit identifiziert kognitive und motivationale Denkfehler, die unser Verständnis und unsere Entscheidungen in komplexen Situationen beeinflussen und die Lösung ökologischer Probleme erschweren. Diese Denkfehler werden im Kontext der Komplexität des Problems analysiert.
Wie wird die PSI-Theorie in die Analyse eingebunden?
Die PSI-Theorie wird detailliert beschrieben und dient als analytisches Werkzeug zur Interpretation der Ergebnisse der Computersimulation. Zentrale Elemente der Theorie, wie die Entstehung und Auswahl von Motiven und die Bedürfnisbefriedigung, werden erläutert.
Welche Computersimulation wird verwendet und warum?
Die Arbeit beschreibt die Umsetzung der PSI-Theorie in eine Computersimulation, insbesondere das „Insel“-Szenario aus dem „Autonomie“-Projekt. Die Simulation dient dazu, die Theorie praxisnah zu testen und die Grenzen menschlichen Entscheidungsverhaltens in komplexen Umwelten aufzuzeigen.
Welche Ergebnisse werden in der Arbeit präsentiert und diskutiert?
Die Arbeit präsentiert und diskutiert die Ergebnisse der Computersimulation des „Insel“-Szenarios, die die Herausforderungen der Entscheidungsfindung in komplexen, ökologisch-sozialen Dilemmata beleuchten. Die Ergebnisse werden im Kontext der Allmende-Klemme und der PSI-Theorie interpretiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Allmende-Klemme, Spieltheorie, Gefangenendilemma, globale Trinkwasserversorgung, komplexe Systeme, kognitive Denkfehler, motivationale Denkfehler, Handlungsregulations-Theorie (PSI-Theorie), Computersimulation, ökologisch-soziale Dilemmata, Nachhaltigkeit.
- Quote paper
- Angelika Beate Huber (Author), 2003, Die Allmende-Klemme als komplexes Problem oder 'Kann James den blauen Planeten retten?', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13497