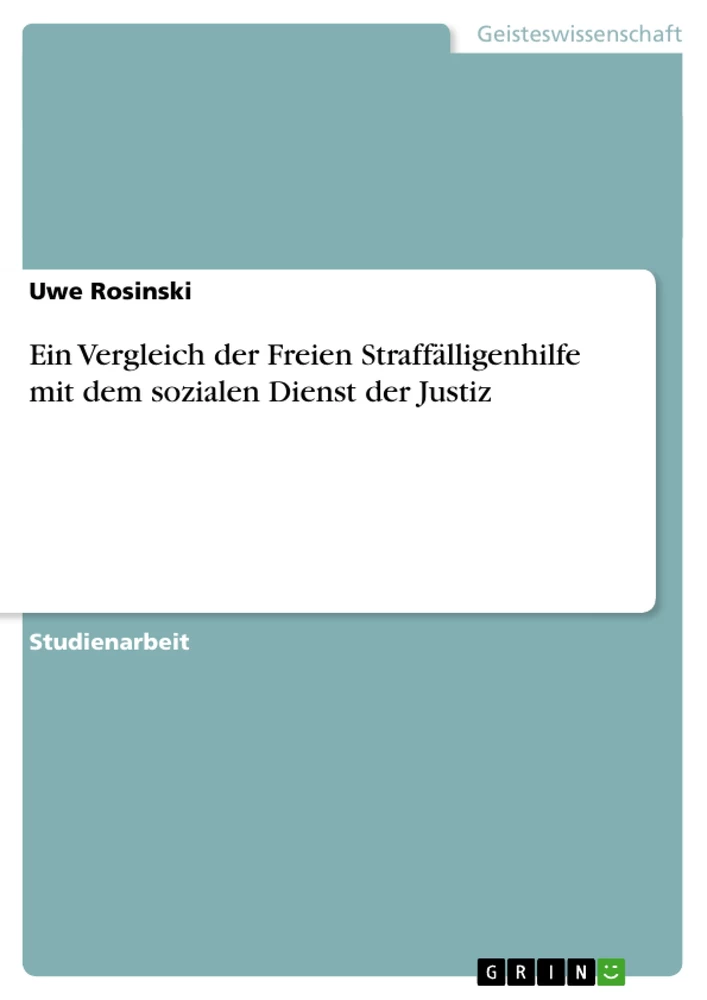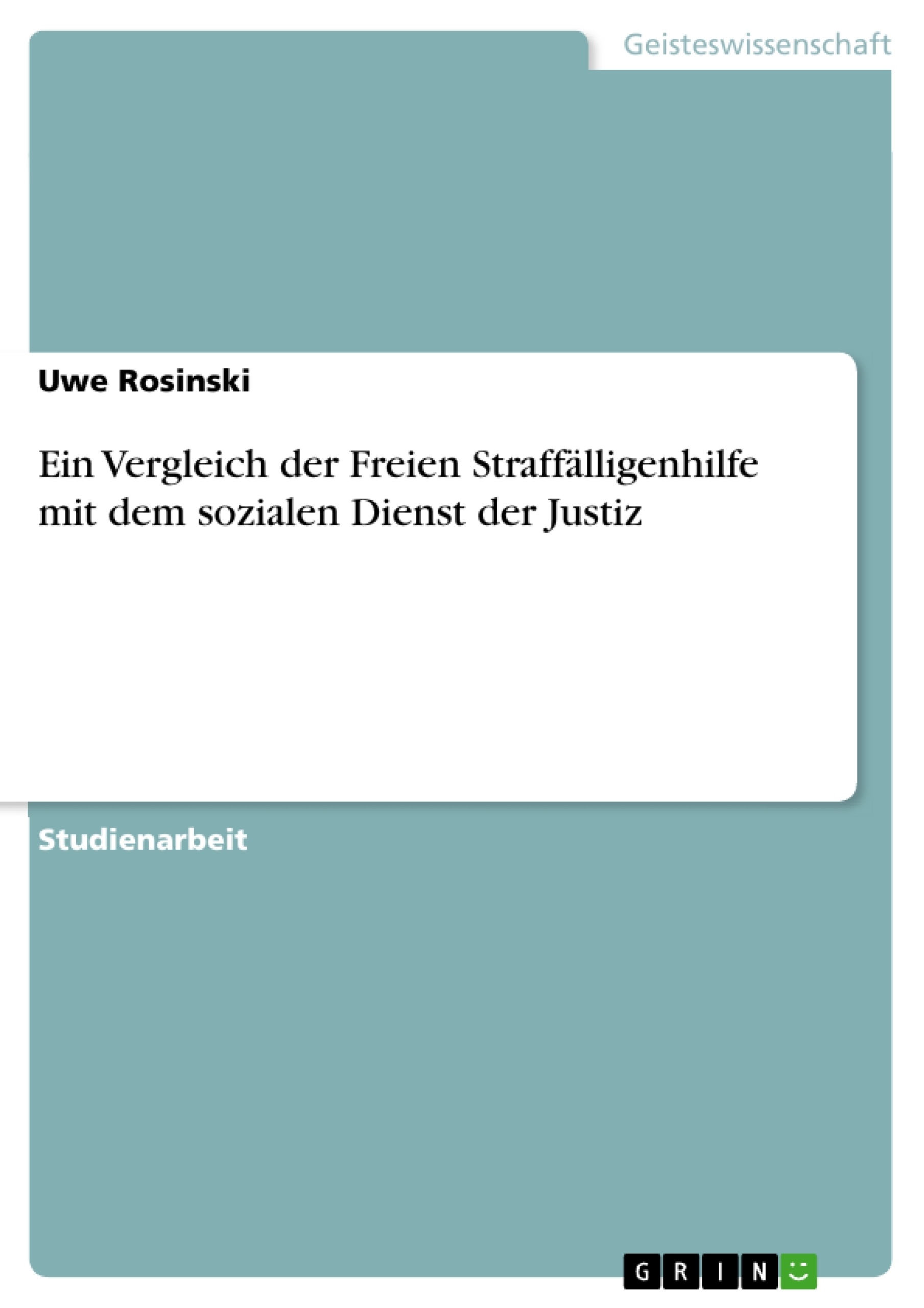Im Jahre 2005 gab es in Sachsen 53131 rechtskräftig verurteilte Straftäter (vgl. Rechtspflege – Rechtskräftig Verurteilte 2007, S. 1).
Ein Teil von ihnen verbüßt eine Freiheitsstrafe – auch mit vorzeitiger Entlassung, andere werden zu einer Bewährungsstrafe mit Auflagen verurteilt.
Ein Teil der Straffälligen wird dem Sozialen Dienst der Justiz in Form eines Bewährungshelfers unterstellt. Manche der Straffälligen wählen selbst die Angebote der Freien Straffälligenhilfe.
Alle Straffälligen haben ein Recht auf Neuanfang nach ihrer verbüßten Strafe, bzw. wenn sie vorzeitig aus der Haft entlassen wurden. Die besonderen Lebensumstände dieses Personenkreises erfordern meist Resozialisierungsmaßnahmen, zum Beispiel: Wohnungsbeschaffung, Ermöglichen eines Einkommens aus einer Erwerbstätigkeit und Unterstützung bei weiteren Problemen.
Hier findet Sozialarbeit als Profession an Straffälligen statt. Die Sozialarbeiter sollen nach dem Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“ professionell arbeiten, um Menschen auf ihrem Weg in ein neues straffreies Leben zu unterstützen und zu begleiten.
Neben den Sozialen Diensten der Justiz bieten Vereine der Freien Straffälligenhilfe Möglichkeiten, um straffällig gewordenen Menschen zu helfen. Ein Vergleich dieser Hilfeformen will Gemeinsamkeiten und Unterschiede beleuchten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitende Gedanken
- 2. Straffälligenhilfe der Justiz
- 2.1 Die Gerichtshilfe
- 2.2 Die Bewährungshilfe
- 2.3 Soziale Hilfe im Strafvollzug
- 2.4 Die Führungsaufsicht
- 3. Die Freie Straffälligenhilfe
- 3.1 Die gesetzlichen Grundlagen
- 3.2 Die Probleme der Straffälligen und die Aufgaben der Freien Straffälligenhilfe
- 3.3 Die Handlungsprinzipien der Freien Straffälligenhilfe
- 4. Die Abgrenzung der Freien Straffälligenhilfe vom Sozialen Dienst der Justiz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, die Freie Straffälligenhilfe und den Sozialen Dienst der Justiz vergleichend zu betrachten und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede aufzuzeigen. Der Fokus liegt auf der Analyse der jeweiligen Aufgaben, Handlungsprinzipien und der gesetzlichen Grundlagen beider Hilfesysteme.
- Vergleich der Freien Straffälligenhilfe und des Sozialen Dienstes der Justiz
- Analyse der gesetzlichen Grundlagen beider Hilfesysteme
- Untersuchung der Aufgaben und Handlungsprinzipien
- Bewertung der Zusammenarbeit zwischen beiden Systemen
- Resozialisierung von Straftätern
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitende Gedanken: Die Einleitung beleuchtet die historische Entwicklung staatlicher Hilfen für Straffällige in Deutschland seit den 1920er Jahren, mit dem Wandel vom Fokus auf Vergeltung hin zur Resozialisierung. Sie stellt die beiden zentralen Hilfesysteme, den Sozialen Dienst der Justiz und die Freie Straffälligenhilfe, vor und begründet die Notwendigkeit eines Vergleichs beider Ansätze zur Unterstützung von Straftätern auf ihrem Weg in ein straffreies Leben, unter Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen dieser Personengruppe. Die Einleitung skizziert die Bedeutung von Resozialisierungsmaßnahmen wie Wohnungsbeschaffung und Unterstützung bei der Arbeitssuche und betont die Rolle der Sozialarbeit nach dem Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“.
2. Straffälligenhilfe der Justiz: Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Bereiche des Sozialen Dienstes der Justiz: Gerichtshilfe, Bewährungshilfe, soziale Hilfe im Strafvollzug und Führungsaufsicht. Es erklärt die unterschiedlichen Aufgaben dieser Bereiche, von persönlicher Hilfe und Beratung bis hin zur Überwachung von Auflagen und Weisungen. Der Kapitel betont den oft bestehenden Rollenkonflikt zwischen Hilfe und Kontrolle für sowohl den Verurteilten als auch den Sozialarbeiter. Die beschränkten Ressourcen und die Notwendigkeit einer verstärkten Zusammenarbeit mit der Freien Straffälligenhilfe werden hervorgehoben, um die Effektivität der Resozialisierung zu steigern. Die Bedeutung von Einzelfallhilfe und die Herausforderungen durch die oft ähnliche Problemlage der Betroffenen (Arbeitslosigkeit, Wohnungsmangel, Verschuldung, Sucht) werden diskutiert. Es wird die Möglichkeit einer engeren Verzahnung der verschiedenen Bereiche des Sozialen Dienstes der Justiz zur Optimierung des Resozialisierungsprozesses vorgeschlagen.
Schlüsselwörter
Freie Straffälligenhilfe, Sozialer Dienst der Justiz, Resozialisierung, Bewährungshilfe, Gerichtshilfe, Strafvollzug, Hilfe zur Selbsthilfe, gesetzliche Grundlagen, Rollenkonflikt, Zusammenarbeit.
Häufig gestellte Fragen zu "Freie Straffälligenhilfe und Sozialer Dienst der Justiz"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht die Freie Straffälligenhilfe und den Sozialen Dienst der Justiz in Deutschland. Sie analysiert die Aufgaben, Handlungsprinzipien und gesetzlichen Grundlagen beider Hilfesysteme und untersucht deren Zusammenarbeit. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, Kapitel über den Sozialen Dienst der Justiz (Gerichtshilfe, Bewährungshilfe, soziale Hilfe im Strafvollzug, Führungsaufsicht) und die Freie Straffälligenhilfe, sowie eine Zusammenfassung und Schlüsselwörter.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung der Straffälligenhilfe, die verschiedenen Bereiche des Sozialen Dienstes der Justiz, die gesetzlichen Grundlagen und Handlungsprinzipien der Freien Straffälligenhilfe, den Vergleich beider Systeme, die Herausforderungen der Resozialisierung und die Bedeutung der Zusammenarbeit beider Hilfesysteme. Der Fokus liegt auf der Analyse der Aufgaben und der Herausforderungen, die sich aus der oft ähnlichen Problemlage der Betroffenen (Arbeitslosigkeit, Wohnungsmangel, Verschuldung, Sucht) ergeben.
Welche Bereiche des Sozialen Dienstes der Justiz werden beschrieben?
Der Soziale Dienst der Justiz wird in seinen verschiedenen Bereichen beschrieben: Gerichtshilfe, Bewährungshilfe, soziale Hilfe im Strafvollzug und Führungsaufsicht. Die Arbeit erklärt die Aufgaben jedes Bereichs und hebt den oft bestehenden Rollenkonflikt zwischen Hilfe und Kontrolle hervor.
Was sind die Handlungsprinzipien der Freien Straffälligenhilfe?
Die Arbeit untersucht die Handlungsprinzipien der Freien Straffälligenhilfe, wobei das Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“ hervorgehoben wird. Die genauen Handlungsprinzipien werden im Detail im entsprechenden Kapitel erläutert.
Wie werden die beiden Hilfesysteme verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Freie Straffälligenhilfe und den Sozialen Dienst der Justiz anhand ihrer Aufgaben, Handlungsprinzipien und gesetzlichen Grundlagen. Gemeinsamkeiten und Unterschiede werden aufgezeigt, und die Bedeutung der Zusammenarbeit beider Systeme für eine effektive Resozialisierung wird betont.
Welche Herausforderungen werden im Zusammenhang mit der Resozialisierung von Straftätern angesprochen?
Die Arbeit thematisiert die Herausforderungen der Resozialisierung, wie z.B. Arbeitslosigkeit, Wohnungsmangel, Verschuldung und Sucht. Es wird die Notwendigkeit einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen dem Sozialen Dienst der Justiz und der Freien Straffälligenhilfe hervorgehoben, um die Effektivität der Resozialisierung zu steigern.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Freie Straffälligenhilfe, Sozialer Dienst der Justiz, Resozialisierung, Bewährungshilfe, Gerichtshilfe, Strafvollzug, Hilfe zur Selbsthilfe, gesetzliche Grundlagen, Rollenkonflikt, Zusammenarbeit.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst folgende Kapitel: Einleitende Gedanken, Straffälligenhilfe der Justiz (mit Unterkapiteln zu Gerichtshilfe, Bewährungshilfe, sozialer Hilfe im Strafvollzug und Führungsaufsicht), Die Freie Straffälligenhilfe (mit Unterkapiteln zu den gesetzlichen Grundlagen, den Problemen der Straffälligen und den Aufgaben der Freien Straffälligenhilfe sowie den Handlungsprinzipien), und die Abgrenzung der Freien Straffälligenhilfe vom Sozialen Dienst der Justiz.
- Arbeit zitieren
- Uwe Rosinski (Autor:in), 2007, Ein Vergleich der Freien Straffälligenhilfe mit dem sozialen Dienst der Justiz, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/134980