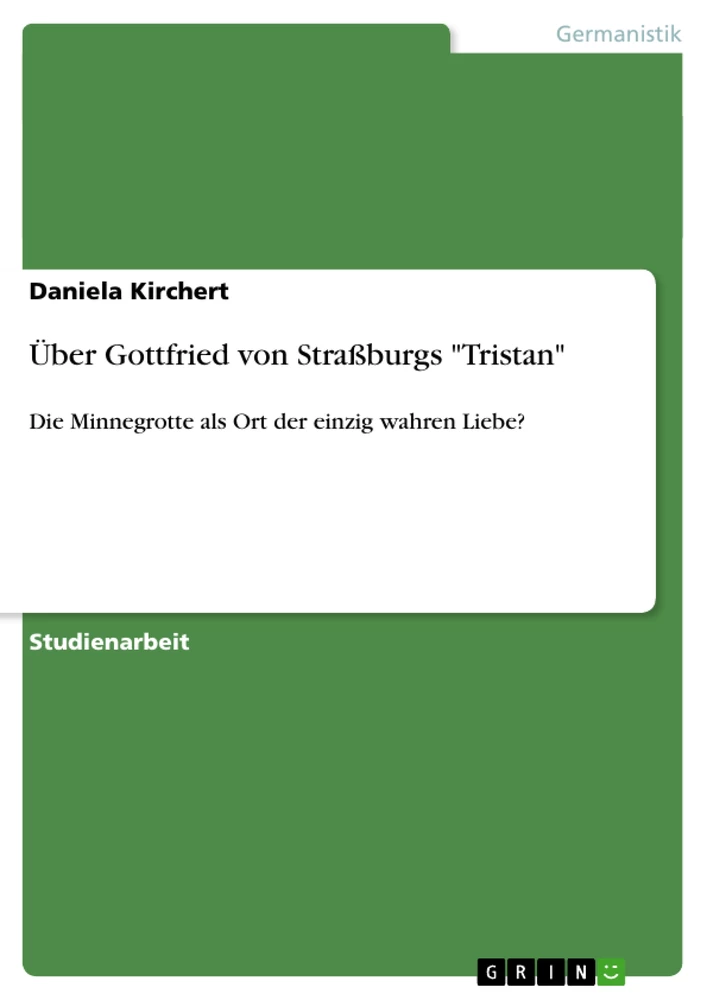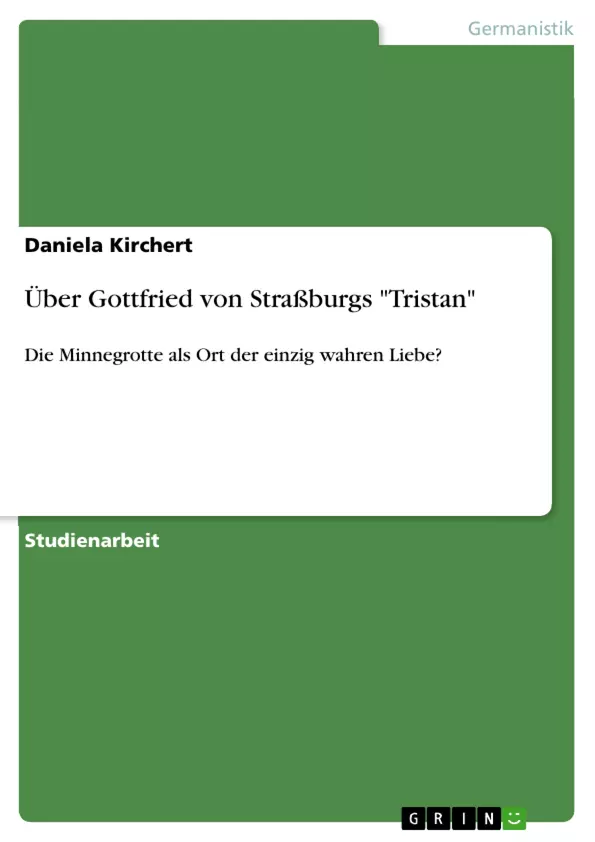In dieser Arbeit über Gottfried von Straßburgs "Tristan" soll die Minnegrotten - Episode etwas näher betrachtet werden, welche eine bedeutende Rolle einnimmt.
Der Inhalt des Werkes ist allerdings keine Erfindung Gottfrieds, sondern eine Bearbeitung schon bekannter Vorlagen. Viele mittelalterliche Dichter haben bereits auf diese zurückgegriffen, da das Publikum vor allem vertraute Stoffe bevorzugte. Die Autoren suchten sich daher Vorbilder, deren Themen sie neu überarbeiten konnten. Damit wurden alte Texte aktualisiert und Bezüge zur Wirklichkeit hergestellt, um es dem Publikum zu erleichtern Analogien zum eigenen Leben zu finden. Gottfried erwähnt selbst in seinem Prolog, dass er lange nach einer Vorlage gesucht hat. Die Bearbeitung durch Thomas von Britannien erschien ihm als die einzig Richtige, deshalb nutze er sie auch als Vorbild für seine Fassung.
sine sprâchen in der rihte niht,
als Thômas von Britanje giht,
der âventiure meister was
und an britûnschen buochen las
aller der lanthêrren leben
und ez uns ze künde hât gegeben.
Als der von Tristande seit,
die rihte und die wârheit
begunde ich sêre suochen
in beider hande buochen
walschen und latînen
und begunde mich des pînen,
daz ich in sîner rihte
rihte diese tihte.
Auch Thomas hat den Stoff lediglich bearbeitet und ging wahrscheinlich, wie viele Andere, von dem nicht überlieferten Werk, der „Estoire“ aus. Aber Gottfried übernahm dessen Inhalt nicht unbewertet. Seine Fassung und die Thomas` weisen Gegensätze in einigen Episoden auf, welche noch etwas näher in dieser Arbeit betrachtet werden. Auch bei der Ausführung der Minnegrotte lassen sich Abweichungen finden.
Die Darstellung der Grotte in der Waldleben - Episode kann als Allegorie verstanden werden. Diese Methode der Schriftauslegung dient dazu, den hinter dem Wortlaut verborgenen Sinn zu entschlüsseln. Im Mittelalter nutzte man sie vor allem dazu, die Bibel auszulegen, deren Wahrheit durch den Buchstabensinn verhüllt wurde. Damit konnte ein einheitliches Verständnis geschaffen werden.
Zum ersten Mal in der deutschen Sprache taucht die weltliche Allegorie in Gottfrieds Tristan (um 1210) auf. Die Allegorese wird in der Minnegrottenszene auf einen nicht-geistlichen Inhalt übertragen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorgeschichte
- Situation am Hof
- Die Verbannung
- Die Minnegrotte
- Aufbau der Szene
- Beschreibung der Grotte
- Das Speisewunder
- Das Gesellschaftswunder
- Die Auslegung der Minnegrotte
- Autobiographischer Bezug
- Grottenleben
- Erzählung antiker Liebesgeschichten
- Rolle der Musik
- Der wunderbare Hirsch
- Die Entdeckung
- Illustration der Minnegrotte
- Die Rückkehr
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Episode der Minnegrotte in Gottfried von Straßburgs „Tristan“. Ziel ist es, die Bedeutung dieser Szene im Kontext des gesamten Werkes zu beleuchten und ihre Funktion als Allegorie zu analysieren. Dabei werden die literarischen Vorlagen und die spezifischen Abweichungen in Gottfrieds Version berücksichtigt.
- Die Minnegrotte als Allegorie und ihre Auslegung
- Die Darstellung von Liebe und höfischer Gesellschaft
- Der Vergleich von Gottfrieds Version mit den Vorlagen
- Die Rolle der Wunder in der Minnegrotte
- Der Konflikt zwischen höfischer Etikette und individueller Liebe
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Seminararbeit ein und skizziert die Bedeutung der Minnegrotte-Episode in Gottfrieds „Tristan“. Sie erläutert, dass Gottfrieds Werk eine Bearbeitung bereits existierender Vorlagen darstellt und die Arbeit sich auf die Unterschiede und Besonderheiten in Gottfrieds Version konzentrieren wird, insbesondere im Bezug auf die Darstellung der Minnegrotte.
Vorgeschichte: Dieses Kapitel beschreibt die Situation am Hof vor der Verbannung von Tristan und Isolde. Es beleuchtet den scheinbar erfolgreichen Versuch des Paares, ihre Liebe zu verbergen, und Marks wachsenden Argwohn und letztliche Erkenntnis der Wahrheit. Die sukzessive Steigerung von Marks Eifersucht und Zorn bis hin zur Entscheidung zur Verbannung wird detailliert dargestellt, wobei die Ambivalenz des Königs zwischen blinder Liebe und königlicher Pflicht herausgearbeitet wird. Der Abschied des Königs und die Gewährung der Freiheit unterstreichen die Tragik der Situation und die Notwendigkeit der Verbannung aus höfischer Sicht.
Die Minnegrotte: Dieses Kapitel behandelt die zentrale Episode der Minnegrotte. Es verspricht eine detaillierte Analyse des Aufbaus, der Beschreibung der Grotte, der Wunder (Speise- und Gesellschaftswunder) sowie der Rolle der Musik und antiker Liebesgeschichten innerhalb der Szene. Die Auslegung der Minnegrotte als Allegorie für die wahre Liebe wird im Mittelpunkt stehen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem autobiographischen Bezug, der Bedeutung des Grottenlebens und den literarischen und gesellschaftlichen Kontexten.
Der wunderbare Hirsch: [Diese Zusammenfassung muss basierend auf dem Originaltext geschrieben werden, da der bereitgestellte Text diesen Abschnitt nicht detailliert beschreibt.]
Die Entdeckung: [Diese Zusammenfassung muss basierend auf dem Originaltext geschrieben werden, da der bereitgestellte Text diesen Abschnitt nicht detailliert beschreibt.]
Illustration der Minnegrotte: [Diese Zusammenfassung muss basierend auf dem Originaltext geschrieben werden, da der bereitgestellte Text diesen Abschnitt nicht detailliert beschreibt.]
Die Rückkehr: [Diese Zusammenfassung muss basierend auf dem Originaltext geschrieben werden, da der bereitgestellte Text diesen Abschnitt nicht detailliert beschreibt.]
Schlüsselwörter
Minnegrotte, Gottfried von Straßburg, Tristan, Allegorie, höfische Liebe, mittelalterliche Literatur, Vorlagen, Thomas von Britannien, Eifersucht, Verbannung, Wunder, Gesellschaft, Autobiographie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu Gottfried von Straßburgs "Tristan" - Die Minnegrotte
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit analysiert die Episode der Minnegrotte in Gottfried von Straßburgs „Tristan“. Der Fokus liegt auf der Bedeutung dieser Szene im Kontext des gesamten Werks und ihrer Funktion als Allegorie. Dabei werden die literarischen Vorlagen und die Abweichungen in Gottfrieds Version untersucht.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie die Minnegrotte als Allegorie und ihre Deutung, die Darstellung von Liebe und höfischer Gesellschaft, den Vergleich mit den literarischen Vorlagen, die Rolle der Wunder in der Minnegrotte und den Konflikt zwischen höfischer Etikette und individueller Liebe.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel Einleitung, Vorgeschichte, Die Minnegrotte, Der wunderbare Hirsch, Die Entdeckung, Illustration der Minnegrotte, Die Rückkehr und Fazit. Die Kapitel "Der wunderbare Hirsch", "Die Entdeckung", "Illustration der Minnegrotte" und "Die Rückkehr" werden im vorliegenden Auszug nicht detailliert beschrieben.
Was wird in der Einleitung beschrieben?
Die Einleitung führt in das Thema ein und skizziert die Bedeutung der Minnegrotte-Episode in Gottfrieds „Tristan“. Sie erläutert, dass Gottfrieds Werk eine Bearbeitung existierender Vorlagen darstellt und die Arbeit sich auf die Unterschiede und Besonderheiten in Gottfrieds Version konzentrieren wird.
Was wird in der Vorgeschichte dargestellt?
Die Vorgeschichte beschreibt die Situation am Hof vor der Verbannung von Tristan und Isolde. Sie beleuchtet den Versuch des Paares, ihre Liebe zu verbergen, Marks wachsenden Argwohn und die letztliche Erkenntnis der Wahrheit. Die Steigerung von Marks Eifersucht und Zorn bis zur Verbannung wird detailliert dargestellt, wobei die Ambivalenz des Königs zwischen Liebe und Pflicht herausgearbeitet wird.
Was ist der Schwerpunkt des Kapitels "Die Minnegrotte"?
Das Kapitel "Die Minnegrotte" analysiert detailliert den Aufbau, die Beschreibung der Grotte, die Wunder (Speise- und Gesellschaftswunder), die Rolle der Musik und antiker Liebesgeschichten. Die Auslegung der Minnegrotte als Allegorie für die wahre Liebe steht im Mittelpunkt, ebenso wie der autobiographische Bezug und die literarischen und gesellschaftlichen Kontexte.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Minnegrotte, Gottfried von Straßburg, Tristan, Allegorie, höfische Liebe, mittelalterliche Literatur, Vorlagen, Thomas von Britannien, Eifersucht, Verbannung, Wunder, Gesellschaft, Autobiographie.
- Quote paper
- Daniela Kirchert (Author), 2006, Über Gottfried von Straßburgs "Tristan", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/134998