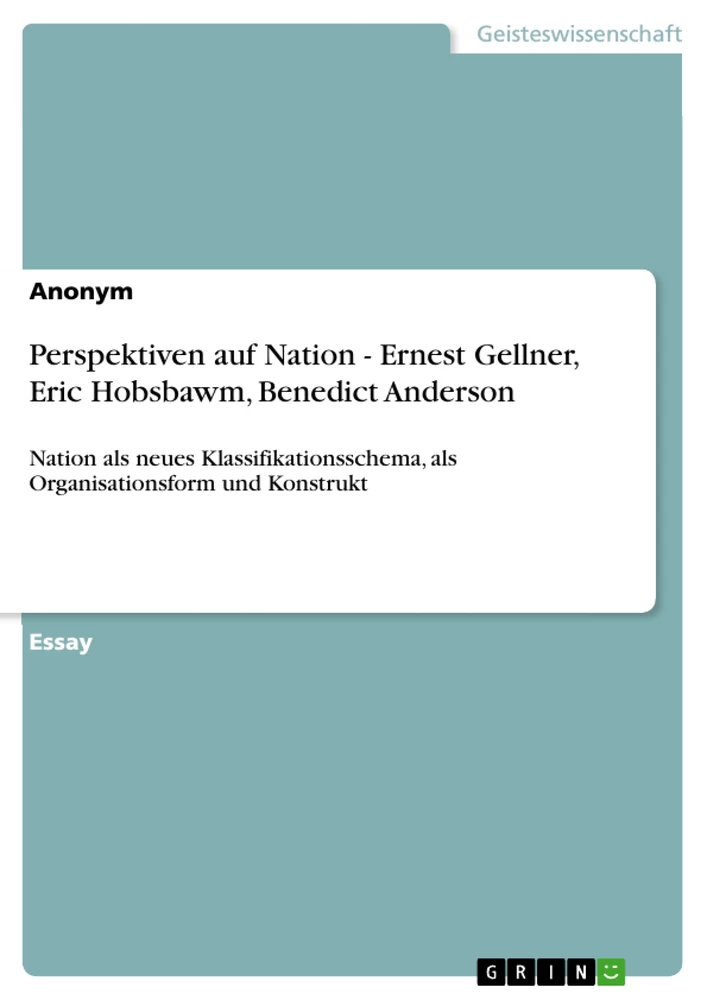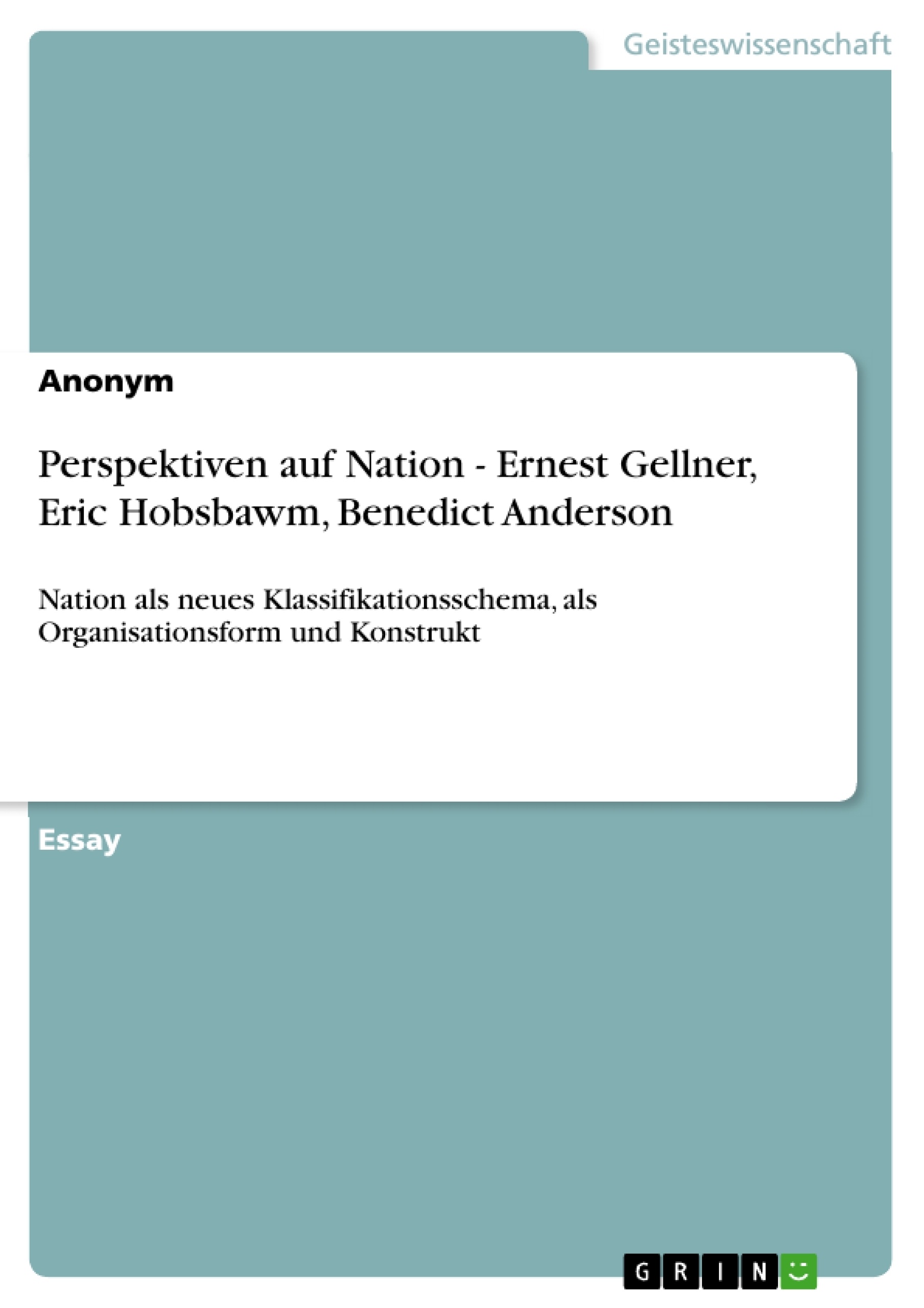Der Essay vergleicht die Perspektiven drei verschiedener Sozialwissenschaftler auf das Phänomen der Nation.
Perspektiven auf Nation: Nation als neues Klassifikationsschema, als Organisationsform und Konstrukt
Als „Nation-Building“ werden politische Unternehmungen bezeichnet, deren Ziel es ist, aus zersplitterten Gesellschaften handlungsfähige und stabile politische Einheiten zu schaffen. Solche Projekte zeitigten im 20. Jahrhundert höchst unterschiedliche Ergebnisse: Was im Nachkriegsdeutschland funktionierte, scheiterte in Vietnam und ist im gegenwärtigen Irak zumindest noch unsicher. Wohl auch vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen erfuhr die sozialwissenschaftliche Konzeption des Begriffs der „Nation“ im Laufe der letzten zwanzig Jahre eine „konstruktivistische Wende“[i]. Nationen wurden zunehmend nicht mehr als empirische Faktizitäten, die auf bestimmten objektiven Gemeinsamkeiten wie Rasse oder Sprache beruhten, gefasst. Man verstand sie vielmehr als soziale Gemeinschaften, die über kulturell vermittelte Konstruktion von Gemeinsamkeiten oder Traditionen ein kollektives Identitätsgefühl auszubilden in der Lage waren. Die drei vorliegenden Texte von Ernest Gellner, Eric Hobsbawm und Benedict Anderson stehen in dieser Tradition. Sie setzen sich von „naturalistischen“ (Gellner) Nationenbegriffen ab und verstehen diese vielmehr als konstruierte oder „vorgestellte“ (Anderson) Gemeinschaften - Gemeinschaften also, die weniger auf tatsächlichen Gemeinsamkeiten oder Kontinuitäten beruhen, sondern diese zu einem großen Teil „erfinden“ (Hobsbawm).
Hobsbawm, dessen Text der früheste von den dreien ist, beschreibt diesen Prozess von Nationalisierung vor dem Hintergrund seines Konzepts der „invented traditions“. Nach Zeiten sozialer Umbrüche – so seine Grundthese – sei zumeist eine Anpassung der gesellschaftsspezifischen Traditionen und Bräuche notwendig. Als eins der Grundprinzipien derartiger kultureller Adaption konstatiert er die „Erfindung von Traditionen“. Hierbei würden, so Hobsbawm, sozial erforderliche oder funktionale Praktiken etwa dadurch legitimiert, dass eine Kontinuitätslinie konstruiert werde, die das eigentliche Novum zur Tradition erkläre. Die künstliche Produktion von Vergangenheit wird hier also zum Legitimationsmittel für die Gegenwart. „All invented traditions, so far as possible, use history as a legitimator of action and cement of group cohesion“[ii], heißt es im Text. Das Prinzip der Nation gründet aus seiner Perspektive essentiell auf solchen artifiziellen Traditionslinien. Durch die Einführung von Symbolen und semi-rituellen Handlungen, die zumeist Neuschöpfungen seien, aber den Charakter von Tradition propagieren, würde bei den Mitgliedern moderner Gesellschaften ein staatsbürgerliches Bewusstsein ausgebildet. „Modern nations … generally claim to be the opposite of novel, namely rooted in the remotest antiquity, and the opposite of constructed, namely human communities so ´natural` as to require no definition tan self-assertion. Whatever the … continuities embedded in the modern concept of ´France`… these concepts themselves must include a constructed or ´invented` component”, schreibt Hobsbawm resümierend.
Die Texte von Anderson und Gellner knüpfen grundsätzlich an dieses Konzept an. „Die Erfindung der Nation“, heißt bezeichnender Weise Andersons Buch in der deutschen Übersetzung, was schon rein nominal eine Verbindung zu den „erfundenen Traditionen“ Hobsbawms impliziert.
Allerdings beschreibt Anderson – wie Gellner – Nationalismus als weitreichenderes identitätsstifendes Prinzip. Hobsbawm verortet nationale Traditionen und Symbole im öffentlichen Sektor einer Gesellschaft und stellt die These auf, privates Leben werde in modernen Gesellschaften weniger durch Kultur als vielmehr durch strukturelle Zwänge bestimmt und sei deshalb weniger symbolisch als vielmehr funktional geprägt. Nationalismus als kulturelle Ausprägung des Gesellschaftstyps Nation hat aus seiner Perspektive damit nur auf einen Teil modernen Lebens Auswirkung. Er dient hauptsächlich der Ausbildung eines staatsbürgerlichen Bewusstseins, das jedoch die Ebene des individuellen, persönlichen Lebens nicht elementar prägt. Anderson hingegen fasst Nationalismus als eins der „großen kulturellen Systeme“[iii], das er in Tradition von Religion und monarchischer Dynastie sieht und dem er damit grundsätzliche kulturelle Funktionen wie Sinnstiftung, Transzendenz und Herrschaftslegitimation zuschreibt. “Es ist das ´Wunder` des Nationalismus, den Zufall in Schicksal zu verwandeln“[iv], heißt es etwa an einer Stelle. Nationalismus ist für ihn also grundsätzlich ein kulturelles Orientierungssystem, das jedoch gegenüber denen der Vormoderne durch einen elementaren Bewusstseinswandel charakterisiert ist, der wie er es bezeichnet, eine „Relativierung“ und „Territorialisierung“ neuzeitlichen Denkens zur Folge hatte[v]. Er beschreibt wie wissenschaftlicher und technologischer Fortschritt und die damit einhergehende Säkularisierung eine Weltsicht konstituiert, die menschliches Leben nicht mehr in religiösen sondern in irdischen Maßstäben misst und es nicht mehr als Ausdruck einer religiös bestimmten Kosmologie sondern eines von physikalischen und historischen Gesetzmäßigkeiten auffasst. Diese Rationalisierung des Denkens wird begleitet von einem neuen Raum-Zeit-Bewusstsein. Durch das Aufkommen neuer Kommunikations- und Reisemittel erlebt sich der Mensch als Teil einer Gleichzeitigkeit, die nicht mehr durch die an der Apokalypse orientierte „überzeitliche Simultanität“ der Vormoderne sondern durch das Bewusstsein der gleichzeitig existierenden und handelnden Menschen geprägt ist. Dies ist für Anderson die Voraussetzung dafür, dass die Vorstellung von einer Gemeinschaft ausgebildet werden kann, die nicht mehr nur aus face-to-face-Beziehungen besteht. Hier erklärt sich sein Begriff der Nation als „vorgestellter Gemeinschaft“[vi]. Es ist eine Gesellschaft, die Vergemeinschaftung dadurch erfährt, dass sie eine Menge eigentlich anonymer, scheinbar unverbundener Menschen kulturell, also durch spezifische Imaginations- und Kommunikationsformen miteinander verknüpft. Voraussetzung solcher Bindungen seien jedoch, so Anderson, die Evidenz dieser Gemeinschaften, das heißt die „Gewissheit, dass die vorgestellte Welt sichtbar im Alltagsleben verwurzelt ist“[vii]. Erst eine solche Verankerung der Fiktion in der Wirklichkeit erzeuge „jenes bemerkenswerte Vertrauen in eine anonyme Gemeinschaft, das untrügliches Kennzeichen moderner Nationen ist“[viii].
[...]
[i] vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Nationalistisch.
[ii] Hobsbawm, S. 12.
[iii] vgl. Anderson, S. 20.
[iv] Anderson, S. 20.
[v] Anderson, S. 27.
[vi] vgl. den Originaltitel des Buches: „Imagined communities“.
[vii] S. 41.
[viii] S. 40.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet die "konstruktivistische Wende" im Nationenbegriff?
Nationen werden nicht mehr als natürliche Gegebenheiten (Rasse, Sprache) gesehen, sondern als soziale Gemeinschaften, die durch kulturelle Konstruktion entstehen.
Was versteht Eric Hobsbawm unter "erfundenen Traditionen"?
Hobsbawm meint damit Bräuche oder Symbole, die eine historische Kontinuität vortäuschen, um moderne nationale Identitäten zu legitimieren.
Wie definiert Benedict Anderson die Nation?
Anderson definiert die Nation als eine "vorgestellte Gemeinschaft" (imagined community), da die Mitglieder einander nie alle kennen, aber das Bild ihrer Gemeinschaft im Kopf tragen.
Welche Rolle spielt Ernest Gellner in dieser Debatte?
Gellner sieht Nationalismus als ein Prinzip, das politische und nationale Einheiten zur Deckung bringen will, oft bedingt durch die Anforderungen der industriellen Gesellschaft.
Warum ist Nationalismus laut Anderson ein kulturelles Orientierungssystem?
Er tritt an die Stelle früherer Systeme wie Religion oder Dynastie und bietet Sinnstiftung sowie eine Einordnung in Raum und Zeit.
Was ist der Unterschied zwischen Hobsbawms und Andersons Sichtweise?
Während Hobsbawm nationale Traditionen eher im öffentlichen Sektor verortet, sieht Anderson den Nationalismus als tief im individuellen Bewusstsein verwurzelt an.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2005, Perspektiven auf Nation - Ernest Gellner, Eric Hobsbawm, Benedict Anderson, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/135100