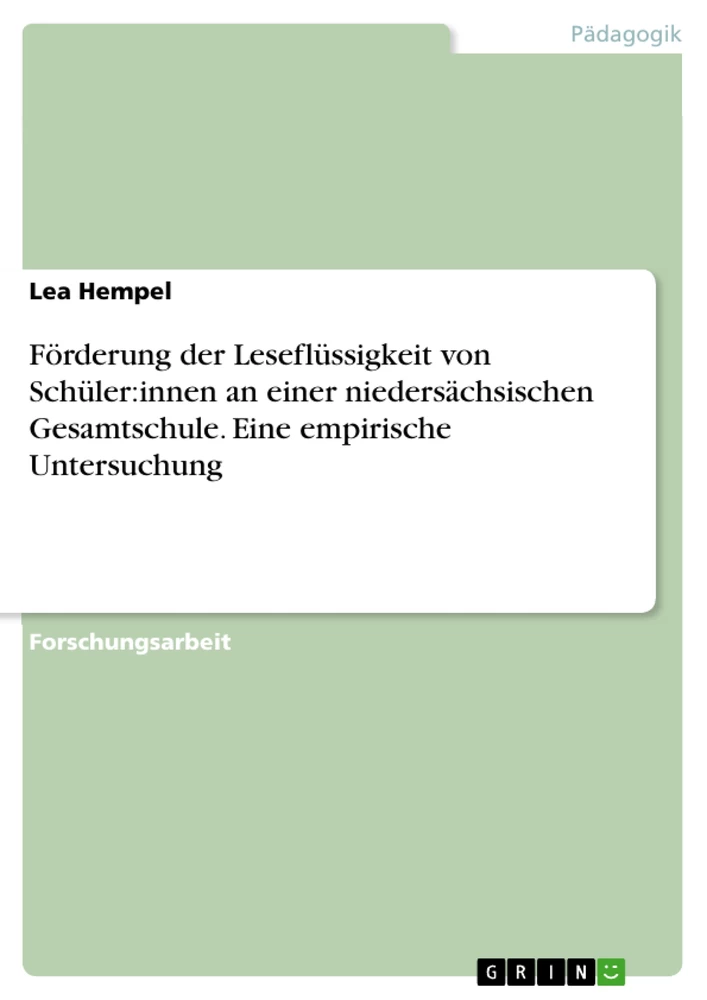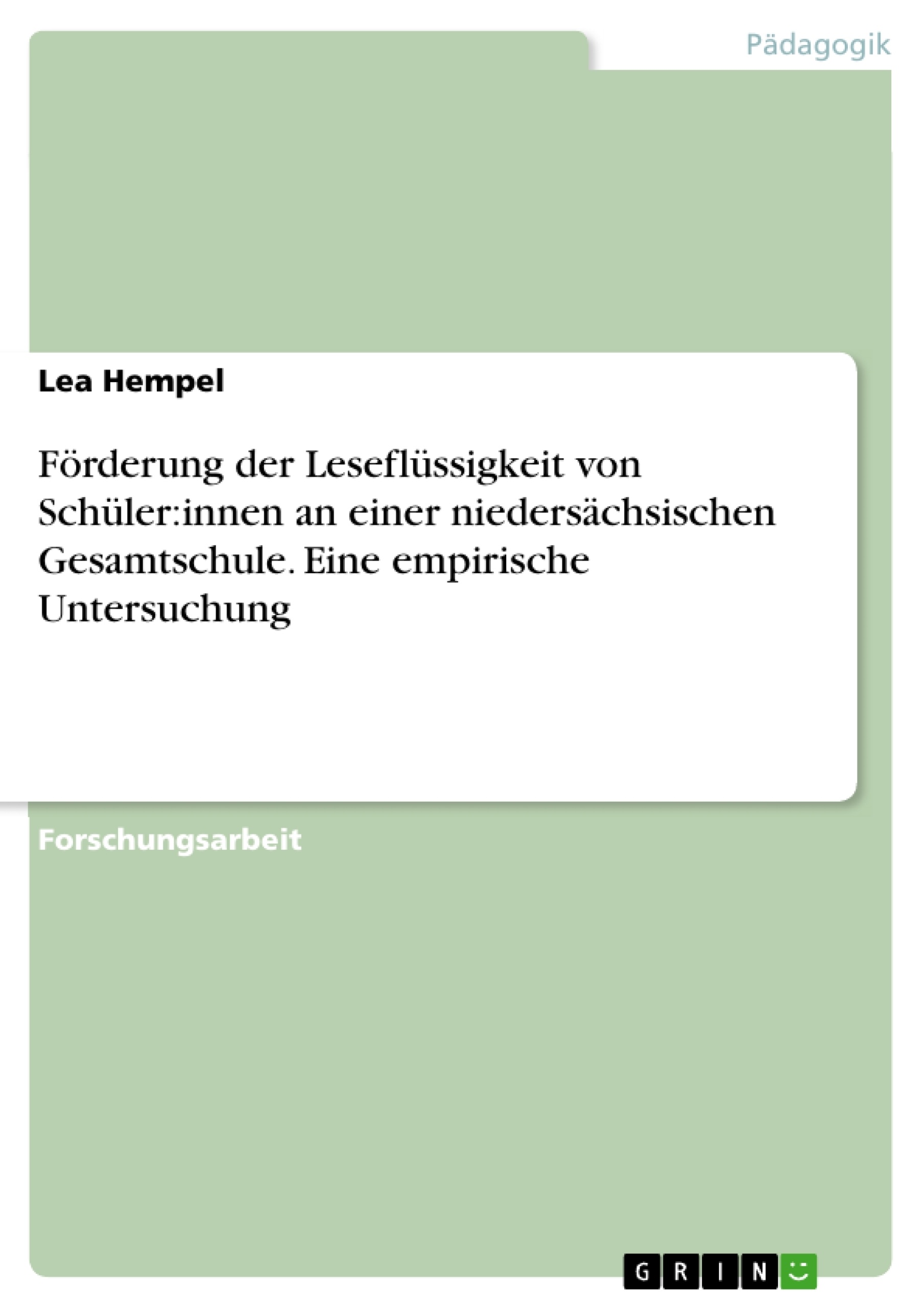Im Rahmen dieser Hausarbeit wird sich mit dem Themenkomplex der "Förderung der Leseflüssigkeit von Schüler:innen an einer niedersächsischen Gesamtschule" beschäftigt. Die Forschungsfrage lautet dabei wie folgt: "Inwiefern lässt sich die Leseflüssigkeit von Schüler:innen mithilfe der Methode des Lautlesetandems steigern?"
Dies soll empirisch mithilfe des Diagnoseinstrumentes "Salzburger Lese-Screening" untersucht werden, welches die Leseflüssigkeit von Schüler:innen aufzeigt. Daraufhin soll mit der Methode "Lautlesetandem" die Leseflüssigkeit der Schüler:innen gefördert werden und es soll darüber hinaus dargestellt werden, inwiefern eine Steigerung dieser möglich ist. Dafür werden die Schüler:innen anhand der Ergebnisse des Salzburger Lese-Screenings in Lautlesetandems eingeteilt und über einen Zeitraum von zehn Wochen mit individuellen Materialien versorgt. Nachfolgend wird eine erneute Messung der Leseflüssigkeit mithilfe des Salzburger Lese-Screenings durchgeführt, welche die Lernfortschritte der Schüler:innen überprüfen soll.
Zu Beginn der Arbeit wird der theoretische Hintergrund der zugrundeliegenden Forschungsfrage erörtert. Dabei werden zunächst die für die Thematik relevanten Begriffe definiert, bevor weiterführend die Förderung der Leseflüssigkeit erläutert wird. Im nachfolgenden dritten Kapitel (Empirische Forschung) wird dargelegt, welche methodischen Überlegungen im Laufe des Forschungsprozesses getätigt und welche Entscheidungen getroffen wurden. Dabei wird das gewählte Untersuchungsdesign benannt und die Anwendung begründet. Anschließend werden die Ergebnisse dargestellt und diskutiert, sowie ein resümierendes Fazit gezogen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Herleitung des Themas
- Vorgehensweise
- Theoretische Einbettung
- Salzburger Lese-Screening 2-9
- Leseflüssigkeit
- Förderung der Leseflüssigkeit
- Lautlesetandem
- Empirische Forschung
- Planung des Vorhabens
- Beschreibung der Lerngruppe
- Erste Durchführung des Salzburger Lese-Screenings und Ergebnisdarstellung
- Bildung und Durchführung der Lesetandems
- Zweite Durchführung des Salzburger Lese-Screenings und Ergebnisdarstellung
- Diskussion der Ergebnisse
- Reflexion
- Gelungenes und Chancen
- Herausforderungen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Forschungsarbeit befasst sich mit der Förderung der Leseflüssigkeit von Schüler*innen an einer niedersächsischen Gesamtschule. Die Arbeit untersucht, inwieweit die Methode des Lautlesetandems die Leseflüssigkeit von Schüler*innen steigern kann.
- Die Arbeit untersucht die Leseflüssigkeit von Schüler*innen und die Auswirkungen der Methode des Lautlesetandems auf deren Verbesserung.
- Sie analysiert das Diagnoseinstrument "Salzburger Lese-Screening 2-9" und seine Eignung zur Messung der Leseflüssigkeit von Schüler*innen.
- Die Arbeit befasst sich mit dem theoretischen Hintergrund der Leseflüssigkeit und den verschiedenen Förderansätzen.
- Die Arbeit untersucht die praktische Umsetzung des Lautlesetandems im Unterricht und die Entwicklung der Leseflüssigkeit der Schüler*innen über einen Zeitraum von zehn Wochen.
- Sie diskutiert die Ergebnisse der Studie und schließt mit einem Fazit über die Wirksamkeit des Lautlesetandems zur Förderung der Leseflüssigkeit.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Leseflüssigkeitsförderung ein und erläutert die Relevanz des Themas im Kontext der heutigen Gesellschaft. Sie beschreibt die Herausforderungen, die mit mangelnder Leseflüssigkeit verbunden sind, und die Notwendigkeit, Schüler*innen individuell zu fördern.
- Theoretische Einbettung: In diesem Kapitel werden die für die Forschungsfrage relevanten Begriffe definiert. Das Salzburger Lese-Screening 2-9 wird vorgestellt und die Methode des Lautlesetandems wird im Kontext der Leseflüssigkeitsförderung erklärt.
- Empirische Forschung: Dieses Kapitel beschreibt die Planung und Durchführung der empirischen Untersuchung. Es erläutert das gewählte Untersuchungsdesign und die Anwendung des Salzburger Lese-Screenings. Weiterhin werden die Bildung der Lautlesetandems, die Durchführung des Unterrichts und die Datenerhebung dargestellt.
- Diskussion der Ergebnisse: Hier werden die Ergebnisse der Untersuchung im Detail analysiert und in Bezug zum theoretischen Hintergrund gesetzt.
- Reflexion: In dieser Reflexion werden die Erfolgsfaktoren, die Herausforderungen und die Chancen der empirischen Untersuchung dargestellt.
Schlüsselwörter
Schlüsselbegriffe, die in dieser Arbeit eine zentrale Rolle spielen, sind Leseflüssigkeit, Lautlesetandem, Salzburger Lese-Screening 2-9, Lesekompetenz, Förderung, Schüler*innen, empirische Forschung, Diagnose, und Intervention.
Häufig gestellte Fragen
Wie funktioniert die Methode des Lautlesetandems?
Zwei Schüler bilden ein Team, wobei ein lesestärkerer „Tutor“ und ein leseschwächerer „Sportler“ gemeinsam laut lesen, um die Flüssigkeit zu trainieren.
Was ist das Salzburger Lese-Screening (SLS)?
Es ist ein Diagnoseinstrument zur Messung der Leseflüssigkeit, das in dieser Studie zur Vorher-Nachher-Messung der Lernfortschritte eingesetzt wurde.
Kann man die Leseflüssigkeit in zehn Wochen steigern?
Die empirische Untersuchung an einer Gesamtschule prüft genau diese Frage durch ein gezieltes Training über einen Zeitraum von zehn Wochen.
Warum ist Leseflüssigkeit für Schüler so wichtig?
Mangelnde Leseflüssigkeit behindert das Textverständnis und kann zu Schwierigkeiten in fast allen Schulfächern führen.
Was sind die größten Herausforderungen bei der Umsetzung von Lesetandems?
Die Arbeit reflektiert Herausforderungen wie die passende Einteilung der Tandems und die Bereitstellung individueller Materialien.
- Quote paper
- Lea Hempel (Author), 2023, Förderung der Leseflüssigkeit von Schüler:innen an einer niedersächsischen Gesamtschule. Eine empirische Untersuchung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1351697