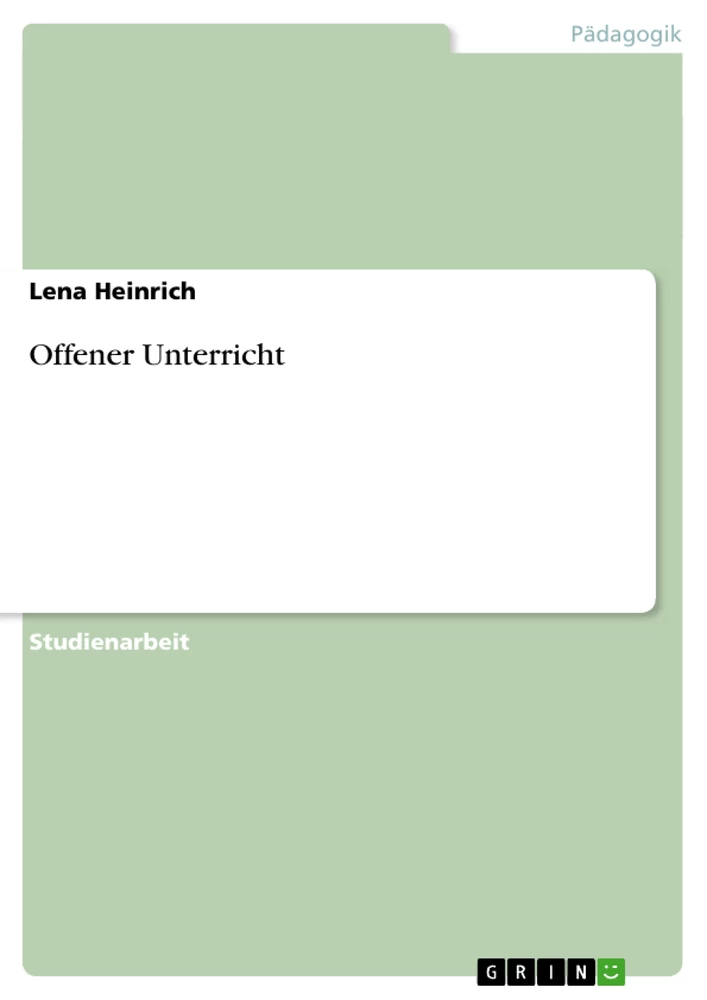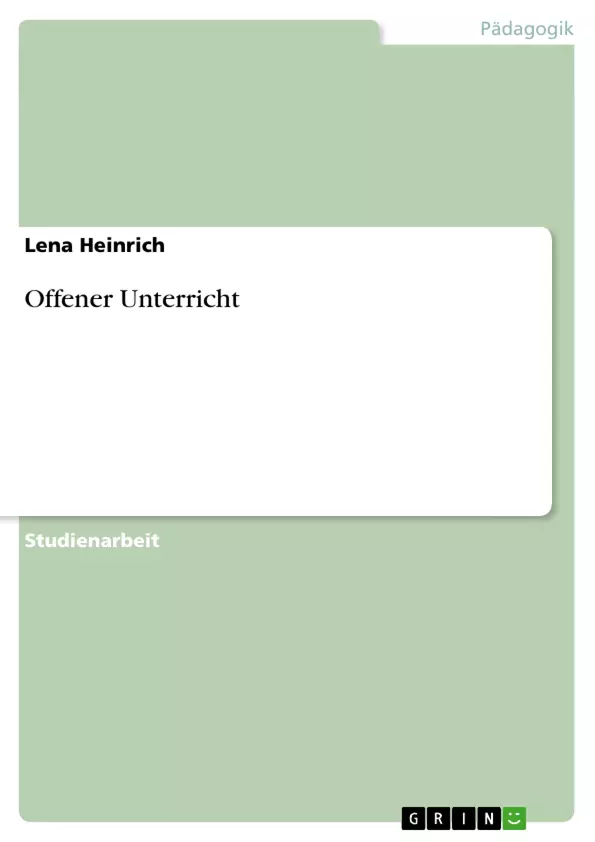Es spricht vieles dafür, offenen Unterricht zu praktizieren. Kinder, denen Selbständigkeit zugesprochen wird, lernen meist mit mehr Enthusiasmus, als Kinder, denen stur alles vorgegeben wird. Selbständig lernende Kinder fühlen sich ernst genommen. Soziale
Kompetenzen wie Kompromissbereitschaft, Kommunikationsfähigkeit
und die Fähigkeit in einer Gruppe zu arbeiten werden durch
den Offenen Unterricht gefördert...
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2 Was ist Offener Unterricht und was s pricht filr ihn?
3.. Offener Unterricht bei Hans Brilgelmann
4. Offener Unterricht bei Falko Peschel
5. Beis piel filr eine offene Lehr- und Lernform: die Stationenarbeit
6 Fazit
7 Literaturangaben
1. Einleitung
In dieser Ausarbeitung wird es darum gehen, welche Merkmale of-fene Lehr- und Lernformen ausmachen, warum es nfitzlich sein kann, diese Ideen in die eigene Unterrichts planung mit einzubezie-hen und warum viele Pädagogen der Meinung sind, dass dies sogar notwendig ist.
In erster Linie soll es um die Darstellung verschiedener Ansichten ausgewählter Pädagogen zum Thema „Offnung des Unterrichts" ge-hen. Wie sich Hans Bragelmann die Umsetzung eines offenen Unterrichtskonze ptes im Einzelnen vorstellt und wie sich die Leh-rerrolle darstellt, soll im folgenden thematisiert werden. Anschlie-lSend werden Falko Peschels Vorstellungen von offenem Unterricht näher erläutert.
Nach dieser Einführung in unterschiedliche Konze pte, wird die Sta-tionenarbeit als Beis piel far eine offene Unterrichtseinheit aufge-griffen und erklärt.
AbschlielSend werden die Ergebnisse noch einmal zusammengefasst und ein Fazit gezogen.
2. Was ist Offener Unterricht und was spricht fur ihn?
Zunächst einmal kann man sich fragen, warum offene Lehr- und Lernformen heutzutage sinnvoll sein können und welche Merkmale far offene Unterrichtsformen typisch sind.
Im Gegensatz zu früher besteht heute eine neue Situation: verän-derte Familienkonstellationen (allein erziehend, Patchworkfamilien etc.) sind far eine veränderte Kindheit verantwortlich. Es gibt Ein-zelkinder, die es gewohnt sind, dass man auf sie besonders eingeht und es gibt Kinder, die aus verschiedenen Grunden vollig auf sich allein gestellt sind.1 Hinzu kommt der Einfluss der Medien. Sie wir-ken in hohem MalSe auf die Erfahrungswelt der Kinder ein. Die Kinder erleben die Wirklichkeit immer weniger direkt, die Grundschule muss daher das Handeln und Erfahren der Schiller verstärken. Die Schule sollte Erfahrungen in der Gru ppe ermoglichen, aber auch jedem Kind Rackzug gewähren, wenn es dies wunscht.
Zu den eben genannten Gesichts punkten kommt die Tatsache hinzu, dass es kaum noch homogene Lerngru ppen gibt, die Hetero-genitat der Lernenden muss zunehmend berucksichtigt werden. „H eterogenit a t [ bezieht sich ] vor allem auf die unterschiedlichen Vor-aussetzungen, Muster, Erfahrungen der lernenden Kinder [ ... ] - es sind heute sowohl erhebliche kulturelle und soziale Unterschiede als auch gravierende sprachliche, kognitive und motivationale Entwick-lungsunterschiede zu konstatieren."2
Diese Sachlage stellt neue Anforderungen an den Unterricht. Ein lehrerzentrierter Unterricht allein kann dies kaum leisten, die I ntegration offener Arbeitsformen ist daher sinnvoll.
Dabei ist es auch sehr forderlich, die Kinder direkt an anstehenden Entscheidungen partizipieren zu lassen. Das heilSt, man sollte die Kinder an der Unterrichts planung mitbestimmen und mitwirken lassen.
Ursula Drews vertritt die Meinung, dass die I dee des Offenen Unter-richts von der Grundannahme ausgehe, dass das „ Lernen [...] ein natfirliches Bedfirfnis von Kindern [ sei ] , mehr fiber die Welt zu erfah-ren, also ffir sich zu lernen [...] und nicht ffir die Schule, die Noten, die Anerkennung der Erwachsenen."3
Daraus folgend kann man sagen, dass beim Offenen Unterricht eine Auseinandersetzung des Kindes mit individuellen Lernaufgaben im Vordergrund stehen sollte. Dadurch, dass der Lernende selbst bestimmen und mitreden kann, wird seine Lernmotivation enorm gesteigert. Auch Falko Peschel „ zielt im sozialen Bereich auf eine m o glichst hohe Mitbestimmung bzw. Mitverantwortung des Schfilers bezfiglich der Infrastruktur der Klasse, der Regelfindung [...] sowie der gemeinsamen Gestaltung der Schulzeit ab."4
Renate Heusinger halt es far erforderlich, auch bei offenen Unter-richtsformen, Regeln aufzustellen: Es sollte beis pielsweise far eine Arbeits phase festgelegt sein, dass man nur leise miteinander redet, seinen Mitschülern hilft und es sollte klar sein, dass man seinen Arbeits platz aufgerdumt verldsst. Auch Regeln zum Arbeitsverhalten
[...]
1 vgl. Lyding, Inge / Vogelsaenger, Wolfgang (o...T.): Handreichungen fur Lehrer zum offenen Unterricht: Ordnung ist das halbe Lernen. Hrsg. von ELBA Bilrosysteme, Wuppertal, S. 4
2 Drews, Ursula / Wallrabenstein, Wulf (Hrsg.) (2002): Freiarbeit in der Grundschule. Offener Unterricht in Theorie, Forschung und Praxis. Grundschulverband - Arbeitskreis Grundschule e.V., Frankfurt am Main, S. 19
3 Drews, S. 20
4 Peschel, Falko (2002): Offener Unterricht, Teil I: Allgemeindidaktische Uberlegungen, Hohengehren, S. 78
Häufig gestellte Fragen
Was ist "Offener Unterricht"?
Offener Unterricht ist ein pädagogisches Konzept, bei dem Schüler aktiv an der Planung und Gestaltung ihres Lernprozesses beteiligt werden und Inhalte sowie Methoden mitbestimmen können.
Warum ist offener Unterricht heute notwendiger als früher?
Die zunehmende Heterogenität der Schüler (kulturell, sozial, kognitiv) erfordert differenzierte Lernformen, die ein lehrerzentrierter Frontalunterricht allein nicht leisten kann.
Was versteht Hans Brügelmann unter Öffnung des Unterrichts?
Brügelmann betont die Veränderung der Lehrerrolle hin zum Begleiter und die Bedeutung von Lernumgebungen, die das natürliche Bedürfnis der Kinder nach Weltwissen fördern.
Wie funktioniert die "Stationenarbeit"?
Stationenarbeit ist ein Beispiel für offenes Lernen, bei dem Schüler verschiedene Aufgaben an unterschiedlichen Stationen in ihrem eigenen Tempo und oft in gewählter Reihenfolge bearbeiten.
Gibt es im offenen Unterricht noch Regeln?
Ja, Regeln sind sogar essenziell. Dazu gehören Absprachen über Lautstärke, gegenseitige Hilfe und Ordnung am Arbeitsplatz, damit das selbstständige Lernen funktioniert.
- Arbeit zitieren
- Lena Heinrich (Autor:in), 2007, Offener Unterricht, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/135170