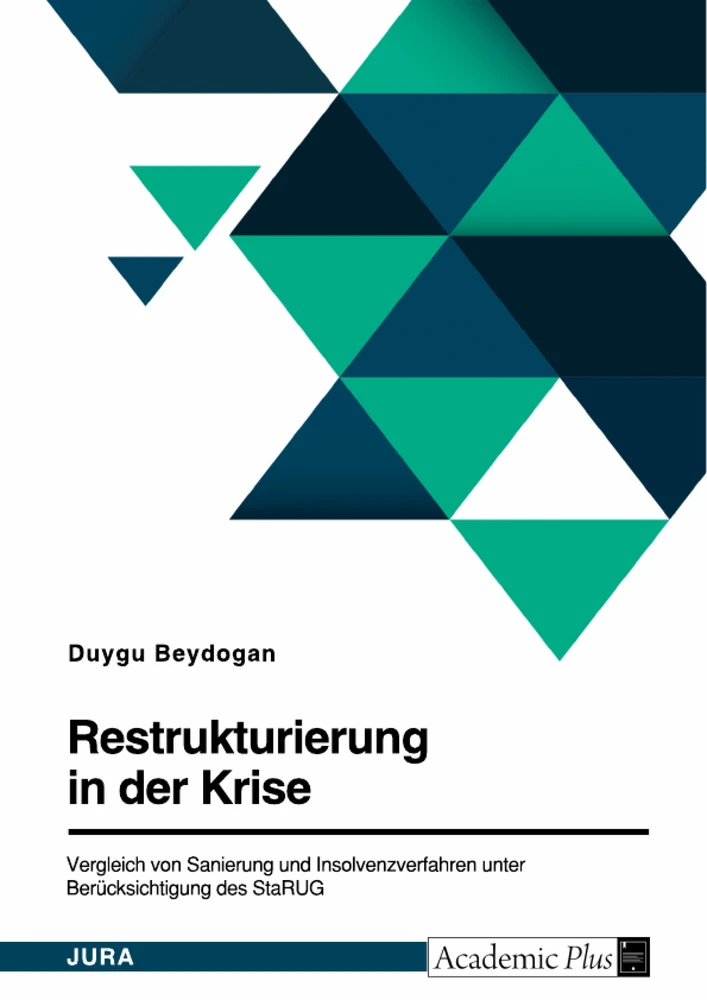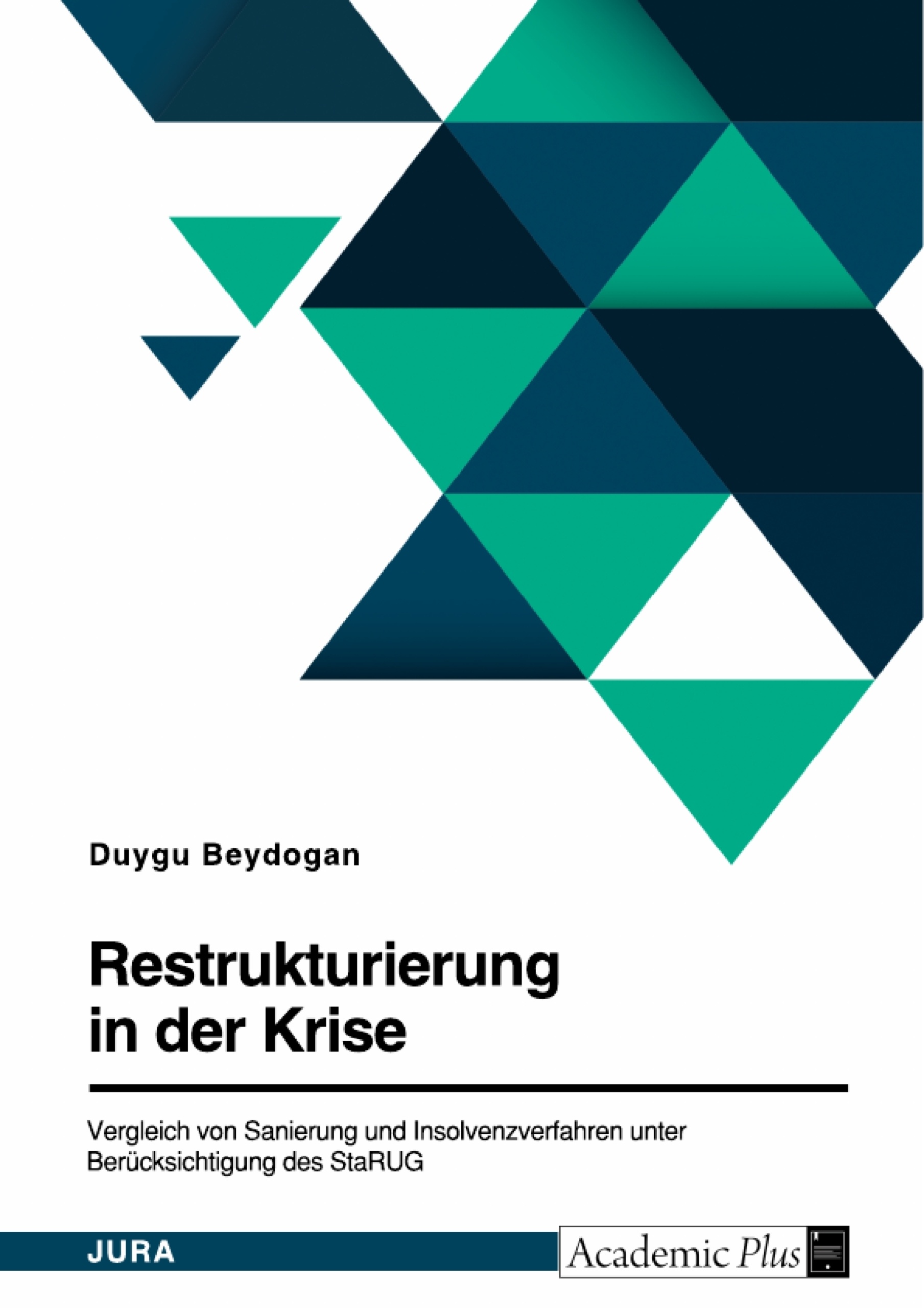Unternehmen in einem frühen Stadium der Krise haben demnach seit Jahresbeginn 2021 die Wahl zwischen zwei Verfahren der rechtsförmigen Restrukturierung, einer vorwiegend finanzwirtschaftlichen Restrukturierung durch das StaRUG oder der weiterreichenden Sanierung in einem Insolvenzverfahren. Die vorliegende Masterarbeit beleuchtet die Herausforderungen und Folgen im Restrukturierungsverfahren.
Ziel dieser Arbeit ist es daher, die Sanierung auf der Grundlage des Restrukturierungsverfahren dem Insolvenzverfahren gegenüberzustellen. Zunächst werden wichtige Grundlagen des Restrukturierungsplans dargelegt. Dabei wird auf eine "Krisensituation" eingegangen. Der Fall zeigt den ersten rechtskräftigen bestätigten Restrukturierungsplan in Deutschland und wie dieser präventive Restrukturierungsrahmen in geeigneten Fällen, die Lücke zwischen freier Sanierung und dem Insolvenzverfahren sicher schließen kann.
Wichtig für die vorliegende Arbeit sind die Sanierungsinstrumente und das Verfahren der Planabstimmung. Anders als im Insolvenzverfahren liegt das Schicksal der Sanierung in der Hand des restrukturierungsbedürftigen Schuldners, was durch die vorliegende Arbeit verdeutlicht werden soll. Dafür stellt das StaRUG dem Schuldner Instrumente zur Verfügung. Dabei bestimmt der Schuldner selbst, welche Gläubiger in den Restrukturierungsplan einbezogen werden sollen und inwieweit das Verfahren ausschließlich privatautonom umgesetzt oder das Restrukturierungsgericht involviert werden soll. Abschließend wird der Verfahrensablauf aus der Krisensituation dargestellt und in Bezug auf das Insolvenzverfahren bewertet.
Inhaltsverzeichnis
- A. EINLEITUNG
- I. PROBLEMAUFRISS
- II. ZUSAMMENFASSUNG
- B. DER RESTRUKTURIERUNGSPLAN
- I. DARSTELLUNG DES RESTRUKTURIERUNGSPLANS
- II. DIE RESTRUKTURIERUNG NACH DEM STARUG
- III. DIE KRISENSITUATION
- IV. DAS HERZSTÜCK DES STARUG
- 1. Die Trennung des Restrukturierungsplans.
- 2. Die Vorgaben zum Inhalt des darstellenden Teils
- a) Zweck............
- b) Vergleichsrechnung......
- aa) Liquidationsszenario.
- bb) nächstbestes Alternativszenario........
- cc) Ermittlung der Befriedungsaussichten .........
- dd) Geheimhaltung des Schuldners................
- c) Angriff in gruppeninterne Drittsicherheiten........
- 3. Die Folgen für die Planbetroffenen
- V. DIE BEKANNTMACHUNG BEIDER VERFAHREN
- C. DIE INSTRUMENTE...
- I. ALLGEMEINES ZUR INSTRUMENTENINANSPRUCHNAHME
- 1. Die Rechtshängigkeit der Restrukturierungssache
- 2. Die Antragsbedürftigkeit.
- 3. Die Verfahrensherrschaft.............
- 4. Das Antragsrecht liegt beim Schuldner.
- 5. Das Gericht entscheidet erst nach Zahlung..........\n
- II. DIE STABILISIERUNGSINSTRUMENTE
- 1. Die gerichtliche Planabstimmung nebst Vorprüfung.
- 2. Die Vorprüfung des Prüfungsgegenstands......
- 3. Die Stabilisierungsanordnung.
- 4. Die Planbestätigung.
- III. DEM STARUG VORBEHALTENE INSTRUMENTE
- IV. DER SCHUTZMECHANISMUS
- V. DIE ÜBERSCHNEIDUNG DER INSTRUMENTE ZWISCHEN STARUG UND INSO.
- D. DAS VERFAHREN DER PLANABSTIMMUNG
- I. DAS PLANGEBOT UND DIE PLANANNAHME
- 1. Planangebot...
- 2. Die Frist für die Annahme oder Ablehnung……………………………………….
- 3. Die Abstimmung für die Planbetroffenen
- II. DAS STIMMRECHT UND DIE ERFORDERLICHE MEHRHEIT…..……………………………………………………….
- 1. Das Verfahren der Abstimmung durch den Schuldner selbst.................
- 2. Das Stimmrecht entsprechend der Beträge..........\n
- 3. Die Erforderliche Mehrheit beträgt drei Viertel der Stimmrechte in der Gruppe
- III. VOR- UND NACHTEILE EINER GERICHTLICHEN UND AUBERGERICHTLICHEN PLANABSTIMMUNG ……………………….
- 1. Die Verfahrensrechtlichen Vorteile
- a) Der Zweifel an der ordnungsgemäßen Annahme.
- b) Die Wirkung des Restrukturierungsplans nur durch Zugang............
- 2. Die Schwierigkeit der Dauer bei beiden Verfahrensalternativen
- 3. Die Kosten..........\n
- 4. Die Akzeptanz des Restrukturierungsvorhabens
- 5. Die alleinige Haftung des Schuldners..........\n
- IV. DIE WIRKUNG DES RESTRUKTURIERUNGSPLANS........
- E. DER VERFAHRENSABLAUF IM FALL
- I. DIE ANZEIGE DES RESTRUKTURIERUNGSVORHABENS.
- II. DER GERICHTLICHE ERÖRTERUNGS- UND ABSTIMMUNGSTERMIN
- III. GERICHTLICHE BESTÄTIGUNG DES RESTRUKTURIERUNGSPLANS
- IV. VERGLEICHSMAẞSTAB ZUM INSOLVENZVERFAHREN
- F. FAZIT.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das neue Restrukturierungsrecht, das im StaRUG (Staatliche Restrukturierungs- und Insolvenzgesetz) verankert ist. Sie beleuchtet die Ziele des Gesetzes, die Relevanz für Unternehmen in Krisensituationen und die Praktikabilität der im Gesetz vorgesehenen Instrumente. Das Ziel der Arbeit ist es, einen umfassenden Überblick über das StaRUG zu geben und seine Anwendung in der Praxis zu analysieren.
- Die Bedeutung des StaRUG für die Restrukturierung von Unternehmen
- Die wichtigsten Instrumente des StaRUG
- Die praktische Umsetzung des Restrukturierungsplans
- Die rechtlichen Auswirkungen des StaRUG
- Die Vorteile und Nachteile des StaRUG im Vergleich zu anderen Verfahren wie der Insolvenz
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und erläutert den Problemhorizont des neuen Restrukturierungsrechts in Deutschland. Die Zusammenfassung gibt einen kurzen Überblick über die Inhalte der Arbeit.
Kapitel B befasst sich mit dem Restrukturierungsplan. Es werden die wesentlichen Elemente des Plans erläutert und der Prozess der Restrukturierung im Rahmen des StaRUG detailliert beschrieben. Besonderes Augenmerk wird auf die Krisensituation und die wichtigsten Instrumente des StaRUG gelegt, die zur Stabilisierung und Sanierung von Unternehmen eingesetzt werden können.
Kapitel C widmet sich den verschiedenen Instrumenten des StaRUG. Es wird erläutert, wie diese Instrumente in der Praxis angewendet werden können und welche rechtlichen Voraussetzungen für ihre Anwendung erforderlich sind. Darüber hinaus wird die Problematik der Überschneidung der Instrumente zwischen dem StaRUG und dem Insolvenzrecht behandelt.
Kapitel D befasst sich mit dem Verfahren der Planabstimmung. Es werden die verschiedenen Möglichkeiten der Abstimmung erläutert und die rechtlichen Rahmenbedingungen des Verfahrens analysiert. Die Kapitel befasst sich mit den Vorteilen und Nachteilen einer gerichtlichen und aubergerichtlichen Planabstimmung und beleuchtet die Wirkung des Restrukturierungsplans auf die beteiligten Parteien.
Kapitel E erläutert den Verfahrensablauf im Fall einer Restrukturierung unter Anwendung des StaRUG. Es wird die Anzeige des Restrukturierungsvorhabens, der gerichtliche Erörterungs- und Abstimmungstermin sowie die gerichtliche Bestätigung des Restrukturierungsplans beschrieben. Abschließend wird ein Vergleich mit dem Insolvenzverfahren gezogen.
Schlüsselwörter
Restrukturierung, Insolvenz, StaRUG, Restrukturierungsplan, Stabilisierungsinstrumente, Planabstimmung, gerichtliche Bestätigung, Verfahren, Unternehmenskrise, Krisenmanagement, Sanierung, Recht, Gesetz, Praxis, Vorteile, Nachteile, Vergleich, Insolvenzverfahren
- Arbeit zitieren
- Duygu Beydogan (Autor:in), 2022, Restrukturierung in der Krise. Vergleich von Sanierung und Insolvenzverfahren unter Berücksichtigung des StaRUG, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1351723