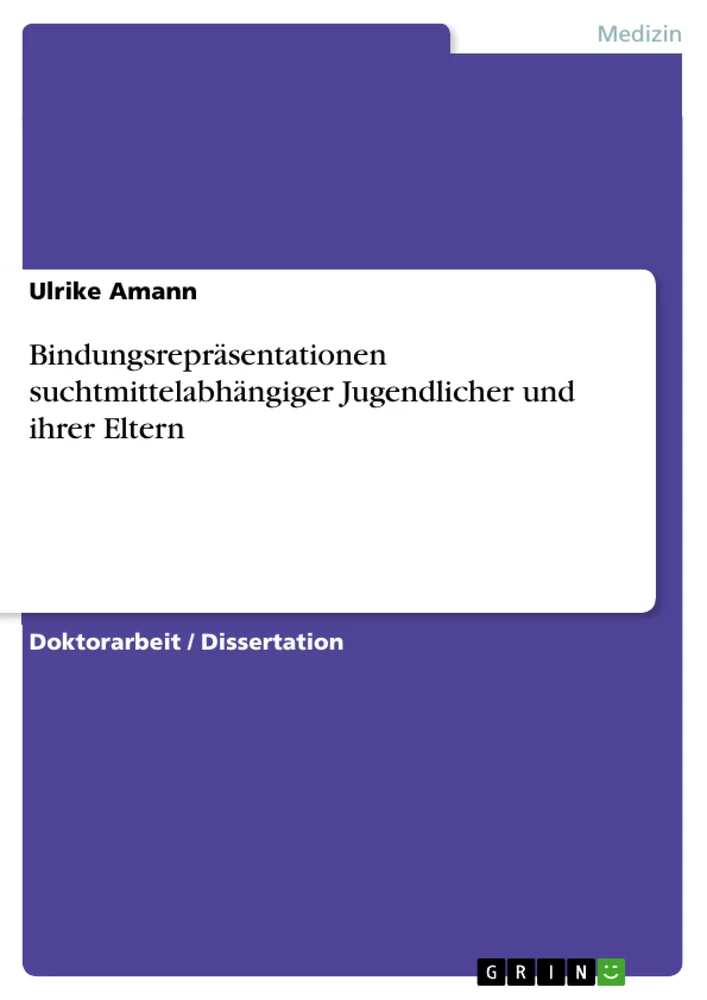Die Studie untersucht Bindungsrepräsentationen suchtmittelabhängiger Jugendlicher und ihrer Eltern anhand des Adult Attachment Interviews. Zustätzlich wurden das Junior Temperament and Character Inventory (JTCI) und der Adverse Childhood Experiences Score (ACE-Score) eingesetzt.
Es zeigte sich, dass bei einem sehr hohen Anteil der untersuchten Jugendlichen und noch häufiger bei deren Müttern ein hochunsicheres Bindungsmuster vorlag. Beim Großteil der erfaßten Probanden bestand durch multiple Risikofaktoren (z.B. Vernachlässigung, viele Wechsel im Bezugsumfeld) ein belastender, in vielen Fällen traumatisierender Entwicklungskontext. Dieser war ebenso für die untersuchten Mütter mit hochunsicheren Bindungsmustern und ähnlichen Biographien charakteristisch.
Bei fast allen untersuchten Jugendlichen bestand eine jugendpsychiatrische Komorbidität, neben den substanzbezogenen Störungen wiesen sie meist andere Störungsbilder auf. Hochunsicher gebundene Jugendliche erwiesen sich jedoch in der klinischen Einschätzung und im JTCI als auffälliger.
Die Ergebnisse des Vergleichs der Mutter-Kind-Dyaden, insbesondere die nach operationalisierten Kriterien erfolgte qualitative Einzelfallanalyse erlaubten Rückschlüsse auf protektive Faktoren hinsichtlich der Verhinderung einer Weitergabe hochunsicherer Bindungsrepräsentationen. Von besonderer Bedeutung waren hierbei korrigierende Beziehungserfahrungen. Vor allem das Vorhandensein mindestens einer kontinuierlichen und verlässlichen erwachsenen Bezugsperson(auch außerhalb der Kernfamilie) wirkte sich positiv auf die Bindungsentwicklung aus. Was die transgenerationale Weitergabe hochunsicherer Bindungsrepräsentationen angeht erwiesen sich eine aktuelle stabile Partnerschaft oder keine Partnerschaft nach wiederholten belasteten Beziehungserfahrungen, eine befriedigende Berufstätigkeit und sinnvolle Freizeitgestaltung sowie eigene psychotherapeutische/psychiatrische Behandlung der betroffenen Mütter als protektiv. Diese Faktoren trugen zur psychischen Stabilität und Zufriedenheit der Mütter bei, was die Jugendlichen vor Rollenumkehr und Parentifizierung schützte, ihnen Sicherheit und Kontinuität im sozialen Umfeld bot und alters angemessene Autonomie und Ablösung ermöglichte.
Die Ergebnisse erweisen sich als insofern klinisch relevant als sie wichtige Hinweise darauf geben, wie ein Behandlungssetting für suchtmittelabhängige Jugendliche unter Berücksichtigung ihrer Bindungsrepräsentationen gestaltet werden sollte.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung und Forschungsstand
1.1 Substanzkonsum im Jugendalter
1.2 Behandlung von substanzbezogenen Störungen im Jugendalter
1.3 Entwicklungspsychopathologie
1.4 Diagnostik und Konsummuster
1.4.1 Komorbidität und psychosoziale Belastung
1.5 Sucht und Familie
1.5.1 Familiäre Einflüsse und Risikofaktoren
1.5.2 Kinder suchtbelasteter und psychisch kranker Eltern
1.5.3 Systemische Erklärungsansätze
1.5.4 Systemische und familientherapeutische Interventionen
1.6 Psychoanalytische und psychodynamische Ansätze zur Erklärung der Sucht
1.7 Bindungstheorie
1.7.1 Grundgedanken der Bindungstheorie
1.7.2 Bindung im Jugendalter
1.7.3 Bindungsrepräsentationen Jugendlicher und Erwachsener
1.7.4 Transgenerationale Zusammenhänge
1.8 Bindung und Trauma
1.9 Bisherige Forschungsergebnisse
1.9.1 Bindung und Sucht
1.9.2 Transgenerationale Vermittlung von Bindung im klinischen Kontext
1.9.3 Transgenerationale Vermittlung von Bindung und Sucht
1.10 Fragestellung
1.11 Hypothesen
2. Material und Methodik
2.1 Ethikkommission
2.2 Probanden
2.3 Untersuchungsinstrumente
2.3.1 Adult Attachment Interview (AAI)
2.3.2 Junior Temperament und Character Inventory (JTCI)
2.3.3 ACE-Score: Adverse Childhood Experiences
2.3.4 Basisdokumentation
2.3.5 Statistik und quantitative Auswertungen
2.4 Durchführung
3. Ergebnisse
3.1 Beschreibung der Stichprobe
3.1.1 Alter, Geschlecht und Lebenskontext
3.1.2 Diagnosen und Einstiegsalter
3.1.3 Substanzmissbrauch/-abhängigkeit der Eltern
3.1.4 Andere psychiatrische Erkrankungen der Eltern
3.2 JTCI
3.3 Adverse Childhood Experiences (ACE-Score)
3.4 Wechsel im Bezugsumfeld
3.5 Bindungsklassifikationen: Auswertung der Adult Attachment Interviews
3.5.1 Allgemeine Ergebnisse und Auffälligkeiten
3.5.2 Jugendliche
3.5.3 Mütter
3.5.4 Mutter-Kind-Dyaden
3.5.5 Ergebnisse der Interviews mit Jugendlichen ohne Elternteile
3.6 Subgruppenvergleich: Unsicher vs. hochunsicher gebundene Jugendliche
3.7 Exkurs: Vertiefende Analyse weiterer bindungsrelevanter Lebensereignisse
3.8 Qualitative Darstellung der Ergebnisse der Mutter-Jugendlichen-Dyaden in Bezug auf bindungsrelevante Aspekte
3.8.1 Vorgehensweise
3.8.2 Mütter und Jugendliche mit unsicheren Bindungsrepräsentationen (Gruppe 1)
3.8.3 Mütter mit hochunsicheren, Jugendliche mit unsicherenBindungsrepräsentationen (Gruppe 2)
3.8.4 Mütter und Jugendliche mit hochunsicheren Bindungsrepräsentationen (Gruppe 3)
3.9 Zusammenfassung der Ergebnisse
4. Diskussion
4.1 Methodik
4.2 Methodische Beschränkungen der Arbeit
4.3 Ergebnisse
4.4 Relevanz der Ergebnisse
4.4.1 Kompensierende und protektive Faktoren
4.4.2 Klinische Relevanz der Ergebnisse: Bedeutung für die stationäre Entzugsbehandlung
4.5 Schlussfolgerung
4.6 Ausblick
5. Zusammenfassung
6. Literaturverzeichnis
7. Anhang
8. Danksagung
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Einleitung und Forschungsstand
1.1 Substanzkonsum im Jugendalter
Substanzkonsum von Jugendlichen ist in den letzten Jahren zunehmend in den Fokus von Politik und Gesundheitswesen getreten.
Der im Mai 2007 veröffentlichte Drogen- und Suchtbericht der Drogenbeauftragten der Bundesregierung berichtet einen Rückgang der Todesfälle durch illegale Drogen sowie einen Rückgang des Alkoholkonsums bei jungen Menschen, was unter anderem auf die Effektivität von Beratungs- und Behandlungsangeboten zurückgeführt wird. Gleichzeitig wird auf eine Risikogruppe Jugendlicher mit exzessivem und sehr früh begonnenem Alkoholkonsum aufmerksam gemacht sowie auf die Entwicklung neuer Konsummuster, die sich z.B. in der Zunahme von erstauffälligen Amphetamin- und Metamphetaminkonsumenten[1] und der Verbreitung neuer synthetischer Stoffe zeigt (Bundesministerium für Gesundheit 2007).
Nach dem Drogen- und Suchtbericht an die Bundesregierung 2008 (Bundesministerium für Gesundheit 2008) gaben 26 % aller 12-17 jährigen Jugendlichen „binge drinking“ (5 und mehr alkoholische Getränke kurz hintereinander) im Monat vor der Befragung an. 2-3 % der 14-17jährigen gehörten zu den regelmäßigen Cannabiskonsumenten. Laut Bericht von 2009 wurde bei 8,2% der 12-17jährigen Jugendlichen ein riskanter oder gefährlicher Alkoholkonsum festgestellt, die Zahl der Krankenhausaufnahmen in Folge von Alkoholintoxikationen stieg von 19 500 im Jahr 2007 auf 23 000 in 2008 an (Bundesministerium für Gesundheit 2009).
Cannabis, bei Jugendlichen nach wie vor die am weitesten verbreitete illegale Droge, wird von diesen immer früher konsumiert, das Einstiegsalter ist in den letzten Jahren erneut gesunken, im Jahr 2008 ist die Zahl der Konsumenten nur leicht rückläufig. Auch wird von einem zunehmend missbräuchlichen und abhängigen Konsum von Cannabisprodukten mit entsprechend problematischen Folgen, häufig als Mischkonsum in Verbindung mit anderen
Substanzen, berichtet. Dieser spiegelt sich in der höheren Inanspruchnahme von Beratungs- und Behandlungsangeboten durch diese jugendliche Personengruppe wider.
Die Erhebung der BZgA von 2008 zur Drogenaffinität Jugendlicher in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt diese Ergebnisse v.a. in Hinblick auf einen nach wir vor risikoreichen Alkoholkonsum von 6,2% der 12-17Jährigen (BZgA 2008).
In Deutschland wachsen mehr als 2,5 Millionen Kinder mit mindestens einem suchtkranken Elternteil auf. Diese sind in besonderem Maße gefährdet, selbst abhängig und/oder psychisch krank zu werden und leiden bei fehlender Unterstützung oft unter ungünstigen Entwicklungsbedingungen (Klein 2009, s. auch 1.5.2).
Tatsächlich wurde in den letzten Jahren immer wieder auf die transgenerationale Vermittlung von Sucht und negativer Bindungserfahrung hingewiesen (s.1.7). Im Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KIGGS) des Robert-Koch-Instituts Berlin (Erhart et al 2007) wird aktuell auf die Bedeutung familiärer Ressourcen als Schutzfaktor hingewiesen. Wo diese nicht vorhanden sind, ist das Risiko für Alkohol- und Drogenkonsum im Kindes- und Jugendalter stark erhöht (Erhart et al 2007).
1.2 Behandlung von substanzbezogenen Störungen im Jugendalter
Im vergangenen Jahrzehnt hat die Kinder- und Jugendpsychiatrie bundesweit spezialisierte Angebote zur ambulanten und stationären Behandlung für Suchtmittel missbrauchende und -abhängige, häufig komorbid erkrankte Kinder und Jugendliche geschaffen (zu den diagnostischen Kriterien s.u.1.4), es kann jedoch noch nicht von einer ausreichenden Versorgung dieser Klientel gesprochen werden. Die bisher vorgehaltenen Behandlungsstationen in Deutschland haben überwiegend einen höherschwelligen Zugang, was dem rechtzeitigen Erreichen der betroffenen Jugendlichen im Sinne einer Frühintervention entgegensteht (Thomasius et al 2008). Bundesweit existieren an 17 Kliniken spezialisierte Jugend-Suchtstationen unter kinder- und jugendpsychiatrischer Leitung mit insgesamt 201 Betten, d.h. in 12 % der vollstationären Einheiten existiert ein entsprechendes Angebot mit überregionaler Versorgung. Während diese Spezialangebote bereits einen Anteil von 3,9 % aller psychiatrischen Krankenhausbetten für Kinder und Jugendliche einnehmen, sind sie auf die Bundesländer sehr unterschiedlich verteilt, überdies integrieren einige Abteilungen die Langzeittherapie für Jugendliche und haben daher ein eher niedriges Fallzahlaufkommen (Fegert, Schepker 2009).
In Baden-Württemberg ist die Jugend-Drogenstation clean.kick der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie/-psychotherapie am Zentrum für Psychiatrie Weissenau[2] bislang die einzige spezialisierte Einrichtung zur qualifizierten Entzugsbehandlung für diese Altersgruppe[3]. In clean.kick werden 15 stationäre Behandlungsplätze zur Entgiftungs- und Motivationsbehandlung vorgehalten. Der Zugang ist niederschwellig, das heißt eine telefonische Anmeldung ohne vorherigen „Motivationsnachweis“ ist bei minderjährigen Patienten ausreichend[4]. Das Angebot richtet sich nicht nur an bereits abhängige oder komorbid erkrankte junge Menschen sondern auch an Substanzmissbraucher mit beginnenden negativen Konsumfolgen. Das multimodale Behandlungskonzept sieht eine neunwöchige Behandlung in mehreren Stufen vor. Hierbei spielt neben medizinisch-psychiatrischer Diagnostik und Behandlung sowie therapeutischen Einzel- und Gruppenangeboten und Erlebnistherapie die Beziehungs- und Bezugspersonenarbeit eine wichtige Rolle. Anders als in Einrichtungen der Suchthilfe für Erwachsene werden hier Entwicklungsaspekte berücksichtigt und dementsprechend pädagogische Interventionen ergänzend zu suchttherapeutischen Ansätzen besonders gewichtet. Angehörige, insbesondere Eltern(teile) und andere Sorgeberechtigte, aber auch Verantwortliche aus Jugend- und Suchthilfe werden in die Behandlung und Perspektivenplanung miteinbezogen. Die geplanten neun Wochen werden von den Jugendlichen häufig in mehreren Abschnitten durchlaufen (Intervallbehandlung), wenn es zu Abbrüchen von Seiten der Jugendlichen oder Behandlungsunterbrechungen aufgrund von Regelverstößen kommt. Diese Jugendlichen kommen in der Summe auf durchschnittlich längere Behandlungszeiten (Fetzer 2008). Von den im Jahr 2006 behandelten Jugendlichen durchliefen 57% nur eine Behandlungsepisode, 13% wurden in drei oder mehr Intervallen behandelt. Die durchschnittliche Verweildauer pro Episode betrug 31 Tage.
Für das Jahr 2010 ist eine Erweiterung des stationären Angebots um fünf Plätze geplant und genehmigt. Damit wird eine Altersdifferenzierung ermöglicht mit dem Ziel, die zunehmend jüngeren Drogen konsumierenden Kinder und Jugendlichen im Alter von 12-15 Jahren in einer baulich getrennten Einheit zu behandeln, um so ihren besonderen Bedürfnissen entwicklungsspezifisch gerecht zu werden und sie vor den Szeneeinflüssen älterer Jugendlicher zu schützen.
Die bisherige Erfahrung mit drogenabhängigen Jugendlichen in qualifizierter stationärer Entzugsbehandlung zeigt, dass ihre Vorgeschichte häufig geprägt ist von multiplen Beziehungsabbrüchen und Trennungserlebnissen. Damit sind bei vielen betroffenen jungen Menschen Bindungsunsicherheiten und dysfunktionales Verhalten verbunden. Die Anzahl komorbider jugendpsychiatrischer Erkrankungen ist bei dieser Personengruppe sehr hoch (80% nach den Auswertungen der Basisdokumentation clean.kick 2006, s.a. 1.4.1), so dass von einer insgesamt hohen psychosozialen Belastungssituation auszugehen ist.
Die Evaluation der Behandlungsverläufe in clean.kick ergab, dass bei mehr als 50% (2002-2004) bis 60% (2006) der behandelten Jugendlichen mindestens ein Elternteil von einer Sucht- oder anderen psychischen Erkrankung betroffen war (Bernhardt et al 2004, BADO 2006). Bei 72% der Jugendlichen war eine psychische Erkrankung in der Familie bekannt. Gleichzeitig lebten nur etwa ein Viertel der behandelten Jugendlichen bei beiden Elternteilen, alle anderen soweit nicht in Einrichtungen der Jugendhilfe untergebracht, lebten überwiegend bei der Mutter. Immer wieder wechselnde Partnerschaften und instabile Paar- und Elternkonstrukte sind ein weiteres häufiges Merkmal in den Familienzusammensetzungen. In stationärer Jugendhilfe lebten im Jahr 2006 24% der behandelten Jugendlichen (BADO 2006).
Auch aufgrund dieser Risikokonstellationen fällt es den beschriebenen Jugendlichen oft schwer, sozialen Übereinkünften zu vertrauen, verlässliche Beziehungen einzugehen und alterstypische Entwicklungsaufgaben angemessen zu bewältigen, so dass sich hier Folgen von Substanzkonsum und Sozialisationsbedingungen vermischen bzw. gegenseitig verstärken.
1.3 Entwicklungspsychopathologie
Aus entwicklungspsychologischer Sicht ist davon auszugehen, dass das Experimentieren mit Risiko- und Grenzerfahrungen und in diesem Zusammenhang auch erste Erfahrungen mit Suchtmitteln für Jugendliche typische Verhaltensweisen sind. Daraus entsteht jedoch vor allem bei denjenigen Jugendlichen ein problematischer Missbrauch oder eine Abhängigkeitsentwicklung, die ohnehin schon durch verschiedene individuelle, familiäre oder soziale Risikofaktoren belastet sind (Silbereisen 1998, Jordan u. Sack 2009). Folgen sind neben psychischen und somatischen Erkrankungen häufig Schwierigkeiten in der Aufnahme tragfähiger sozialer Beziehungen inklusive Paarbeziehungen sowie in der Entwicklung und Initiierung beruflicher Perspektiven, da bereits häufig ein Scheitern in der Schule das Erlangen der entsprechenden Voraussetzungen erschwert. Auch die Ablösung vom Elternhaus im Sinne einer alters angemessenen bezogenen Individuation[5] kann meist nicht funktional bewältigt werden. Dies zeigt sich teils in verstrickten, engen Bindungen mit fehlender Ablösung, teils in einem gänzlichen Kontakt- und Beziehungsabbruch mit massiven, oft gegenseitigen Abwertungen und unverarbeiteten Kränkungen.
Silbereisen (1998) nennt unter familiären Risiken, die den Drogenkonsum im Jugendalter begünstigen v.a. ein durch Desinteresse und Instabilität gekennzeichnetes häusliches Milieu.
Der Suchtmittelkonsum scheint in diesen Konstellationen häufig ein Bewältigungsversuch derjenigen Jugendlichen zu sein, die wenig funktionale Copingstrategien und eine geringe Selbstwirksamkeitserwartung aufweisen. Bewältigt werden müssen neben der Erfahrung von Unsicherheit und mangelnder Verlässlichkeit in der Herkunftsfamilie auch ein meist sich fortsetzendes Scheitern in anderen Beziehungen und Lebensbereichen, traumatische Erlebnisse von Missbrauch/Misshandlung sowie häufig daraus resultierende oder vorbestehende psychische Beeinträchtigungen.
Die Mannheimer Risikokinderstudie, eine vor 20 Jahre begonnene prospektive Längsschnittstudie, benennt zwei wichtige Resilienzfaktoren als besonders relevant für eine gesunde psychische Entwicklung: Erfahrungen gelungener Bewältigung sowie positive Bindungsbeziehungen (Laucht 2006). Als Risikofaktoren für eine Suchtentwicklung im Jugendalter wurden externale Störungen (ADHS, Störung des Sozialverhaltens), die meist mit einem früheren Konsum von Nikotin und Alkohol verbunden sind, benannt. Weiterhin spielt der Einfluss einer sozial auffälligen Gleichaltrigengruppe eine bedeutende Rolle, da davon ausgegangen wird, dass sie den Zugang zu Suchtmitteln erleichtern kann und deren Konsum positiv bewertet. Dies wirkt sich vor allem bei Jugendlichen aus, die wenig Selbstwirksamkeitserwartung aufweisen (Laucht 2007). Die Studie konnte außerdem genetische Faktoren im dopaminergen Neurotransmittersystem nachweisen, die die Entstehung und Aufrechterhaltung von Sucht im Jugendalter begünstigen (Laucht 2007).
Zahlreiche weitere Studien haben sich in den letzten Jahren mit Schutz- und Risikofaktoren für eine Suchtentwicklung befasst (Loxley et al 2004, Kaplow et al 2002, Clark et al 2005, Brook et al 2001). Vor allem Kinder aus suchtbelasteten Familien gelten als besonders gefährdet (Klein 2003 und 2009), worauf unter 1.5.2 noch näher eingegangen wird.
1.4 Diagnostik und Konsummuster
Die Diagnostik der suchtmittelbezogenen Störungen im Jugend-Drogenentzug erfolgt nach den Kriterien des ICD 10. Da diese Kriterien jedoch die alterstypischen Spezifika der Substanzstörungen im Jugendalter nicht berücksichtigen, wurden von Schepker, Barnow und Fegert (2009) zwei weitere Kriterien ergänzend vorgeschlagen, die entwicklungspsychologische Aspekte in dieser Altersgruppe spezifisch betonen. Dies sind die Inkaufnahme erheblicher sozialer Nachteile und Folgen des Substanzkonsums sowie das Nichtbewältigen altersangemessener Entwicklungsschritte, wie z.B. Schulabschluss und berufliche Weichenstellung, Verantwortungsübernahme im Bereich Selbstfürsorge, angemessener Umgang mit finanziellen Mitteln. Andere für die Diagnose einer Abhängigkeit im Erwachsenenalter relevantere Kriterien sind dagegen bei der Diagnosestellung im Jugendalter weniger zu gewichten. So sind Kontrollverlust, Toleranzentwicklung und ein körperliches Entzugssyndrom bei Jugendlichen noch schwächer ausgeprägt bzw. je nach konsumierter Substanz kaum vorhanden, auch dann, wenn in der Gesamteinschätzung bereits von einer Abhängigkeitsentwicklung auszugehen ist (Stolle et al 2007).
Auch unterscheiden sich die Konsummuster Jugendlicher in der Regel deutlich von denen suchtmittelabhängiger Erwachsener. Während bei adulten Patienten im stationären Drogenentzug bisher ein Konsummuster mit Opiatabhängigkeit häufig war, ist im Jugendalter eher von einem wahllosen und unkritischen Mischkonsum verschiedenster Substanzen auszugehen[6] (Graß 2003, Fetzer 2008). Opiatkonsum und daraus entstehende Abhängigkeit spielen im Jugendalter in den letzten Jahren eine weniger bedeutende Rolle. Der Anteil opiatabhängiger Jugendlicher auf der Station clean.kick betrug im Jahr 2006 lediglich 1,6% (2 Jugendliche). Die Zahl erstauffälliger Konsumenten von Heroin in Deutschland ist in den Jahren 1997 bis 2006 von 8771 auf 4385, also um etwa die Hälfte gesunken (Stempel 2008). Auch der Drogen- und Suchtbericht 2009 stellt eine zunehmend größere Bedeutung von Amphetaminen, Ecstacy und Kokain gegenüber Opiaten, deren Konsum auch bei Erwachsenen leicht rückläufig ist, fest und benennt die Notwendigkeit, dies in Präventions- und Behandlungsangeboten zu berücksichtigen (Bundesministerium für Gesundheit 2009).
Typisch für Jugendliche ist ein abhängiger Konsum von Cannabisprodukten kombiniert mit einem Missbrauch anderer psychotroper Substanzen v.a. den sog. Partydrogen Ecstasy, Amphetaminen, LSD etc. Auffallend ist die zunehmende Bedeutung des Alkoholkonsums in den letzten zwei bis drei Jahren, der inzwischen bereits von einem Teil sehr junger Jugendlicher exzessiv betrieben wird und schnell zu einer Abhängigkeit führt, während insgesamt ein Rückgang des durchschnittlichen Alkoholkonsums in dieser Altersgruppe verzeichnet wurde (BzGA 2008). Der Anteil Jugendlicher mit einer Alkoholabhängigkeit auf der Jugend-Drogenstation clean.kick hat sich vom Jahr 2005 (4,7%) bis 2006 (10,2%) mehr als verdoppelt. (BADO 2005, 2006)[7].
Auch gewinnen immer wieder andere synthetische Substanzen an Bedeutung. Außerdem bestehen regionale Unterschiede bzgl. aktuell vorwiegend konsumierter Drogen. So ist beispielsweise die Verbreitung von GHB/GBL (Liquid Ecstacy) regional sehr unterschiedlich, ähnliches gilt für immer wieder auf den Markt kommende neue Party-Drogen.
Insgesamt scheinen v.a. der wahllose und unkritische Konsum verschiedener Substanzen z.B. auch von Inhalanzien und verschiedensten Medikamenten sowie der Mischkonsum, der sich aus dem gerade verfügbaren Angebot ergibt, typisch für jugendliche Konsumenten mit gefährlichem Konsumverhalten zu sein (Fetzer 2008, Graß 2003). Von den in der Studie von Fetzer (2008) untersuchten Jugendlichen der Jugend-Drogenstation clean.kick konsumierten 65% der Patienten mehr als eine Substanz.
1.4.1 Komorbidität und psychosoziale Belastung
In einer aktuellen Erhebung zu Lebenssituation und Verhalten von Jugendlichen, in der fast 6000 Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg befragt wurden (Haffner et al 2006) zeigte sich ein deutlicher Zusammenhang zwischen Substanzkonsum und anderen Problem- und Symptombelastungen. Rowe et al (2004) stellten einen Zusammenhang zwischen schwerer komorbider Erkrankung, dysfunktionalen familiären Bedingungen, weiblichem Geschlecht und jüngerem Alter bei Aufnahme in eine Behandlung fest. Mädchen hatten häufiger eine Kombination aus externalisierenden und internalisierenden Störungen. Multipel komorbid belastete Jugendliche profitierten anfangs von der Behandlung, der positive Effekt hielt jedoch nach der Behandlung nicht an. Nach einem Jahr war das Ausmaß des Substanzkonsums wieder wie zuvor. Dies legt nahe, dass für diese Jugendliche spezialisierte Interventionen erforderlich sind (Rowe et al 2004).
Die Frage ob die meist bestehenden jugendpsychiatrischen Störungen überwiegend dem Suchtmittelmissbrauch vorausgehen oder nachfolgen ist noch nicht ausreichend erforscht. Dies scheint nach bisherigen Erkenntnissen abhängig von Konsummuster, Primärpersönlichkeit und Art der Störung (Schepker 2003).
Substanzkonsum ist bei Jugendlichen häufig mit (weiterem) selbst schädigendem Verhalten wie Selbstverletzung und Suizidversuchen sowie mit psychischen Belastungen und sozialen Auffälligkeiten assoziiert. Jugendliche mit regelmäßigem Substanzkonsum zeigten insgesamt im YSR (Youth Self Report) mehr Symptombelastung (Haffner et al 2006). Sie hatten geringere Erfolge in der Schule und lebten seltener als andere Jugendliche bei beiden Elternteilen. Es wird insgesamt von behandlungsbedürftigen
komorbiden psychischen Störungen bei mehr als 60% der Kinder und Jugendlichen mit substanzbezogenen Störungen ausgegangen (Stolle et al 2007).
Dies entspricht auch den Erfahrungen in der stationären Entzugsbehandlung. Im Zeitraum von 2002 bis 2005 wiesen 63% der behandelten Jugendlichen zusätzlich eine nicht-substanzbezogene komorbide Diagnose aus dem ICD 10 Spektrum F2-F9 auf. Im Jahr 2006 waren dies mit 80% noch deutlich mehr (BADO 2006). Dies hängt vermutlich damit zusammen, dass Jugendliche mit einer ausgeprägten komorbiden Erkrankung, für die spezialisierte Einrichtungen bisher fehlten, erst nach und nach an diese vermittelt wurden unabhängig von der Frage welche Störung aktuell im Vordergrund steht.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Anteil clean.kick Patienten mit zusätzlicher nicht substanzbezogener jugendpsychiatrischer Diagnose (2006)
Was die Verteilung der komorbiden jugendpsychiatrischen Diagnosen angeht, handelt es sich bei der Mehrzahl der jugendlichen Patienten um Diagnosen des F9 Spektrums der ICD10, also um Störungen des Sozialverhaltens, häufig in Verbindung mit emotionalen Störungen (F92) oder Aufmerksamkeitsdefizitstörungen (F90).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2 : Komorbide Diagnosen bei clean.kick Patienten nach Diagnosegruppen (2006)
Jugendliche mit stationär behandlungsbedürftigem Substanzmissbrauch oder –abhängigkeit sind also meist multipel belastete junge Menschen mit gravierenden psychischen Belastungen und schwierigen Entwicklungsbedingungen.
1.5 Sucht und Familie
1.5.1 Familiäre Einflüsse und Risikofaktoren
Die Entstehung von Substanzkonsum und –abhängigkeit im Jugendalter wird von verschiedenen familiären Faktoren beeinflusst, die wiederum in Wechselwirkung zu Einflüssen der Peers sowie individuellen, genetischen und gesellschaftlichen Faktoren stehen (Pinquart, Silbereisen 2005). Als relevant wurde dabei die Vorbildfunktion der Eltern, d.h. insbesondere deren Konsumverhalten und deren Einstellung zum Konsum sowie die Qualität der Eltern-Kind-Beziehung erkannt (Kandel 1996). Positive familiäre Prozesse und intrafamiliäre Kontrollfaktoren (Regeln, Beaufsichtigung der Kinder, Bindung) wirkten sich nach Oxford et al (2000) auf die Peer-Kontakte insofern aus, als weniger dissoziale Kontakte gesucht wurden und Jugendliche dadurch seltener durch Gleichaltrige an Drogenkonsum herangeführt wurden. Auch hier zeigte sich ein Zusammenhang zwischen intrafamiliären Bedingungen und Peer-Kontakten, die wiederum Einfluss auf Beginn, Art und Umfang des Substanzkonsums haben (Oxford et al 2000).
Weitere wichtige Studien zum Einfluss von Familienstruktur und Bindungsqualität auf die Entwicklung von Substanzkonsum im Jugendalter sind unter 1.9.3 aufgeführt.
1.5.2 Kinder suchtbelasteter und psychisch kranker Eltern
Substanzkonsumierende Kinder und Jugendliche kommen überdurchschnittlich häufig aus suchtbelasteten Familien (Merikangas, Avenevoli, 2000; Kumpfer, Bluth 2004). Kinder suchtbelasteter Eltern stellen die größte Risikogruppe hinsichtlich einer eigenen Suchtentwicklung dar (Klein 2003, 2009). Häufig sind sie, bedingt durch multiple Stressfaktoren von anderen jugendpsychiatrischen Störungen belastet (Klein 2003, Barnow et al 2002). Bei Kindern suchtkranker Eltern wurde in einer Familienstudie ein geringeres Ausmaß an elterlicher Wärme und Unterstützung gefunden (Barnow et al 2002). Vor allem bei männlichen Jugendlichen wurden mehr psychische Störungen wie ADHS, Ängste, Depressionen und Alkoholmissbrauch als in der Kontrollgruppe nachgewiesen. Auch Clark et al (2004) fanden einen Zusammenhang zwischen elterlichen Substanzstörungen und jugendpsychiatrischen Störungen, wobei die elterlichen komorbid auftretenden oder früher vorhandenen psychischen Störungen und nicht die Suchterkrankung der wesentliche Prädiktor für die spezifischen Störungen bei den Nachkommen waren.
Besondere Risikokonstellationen für Kinder aus suchtbelasteten Familien sind frühe und unbehandelte Verhaltensauffälligkeiten und psychische Störungen, das Fehlen verlässlicher Bezugspersonen oder ein häufiger Wechsel derselben sowie eigene Gewalterfahrungen und/oder Zeugenschaft bei innerfamiliären Gewalthandlungen (Klein 2003). Die Gefährdung ist dann besonders groß, wenn die Eltern weder selbst Hilfen zur Suchtbewältigung in Anspruch nehmen noch entsprechende Angebote dem Kind verfügbar machen (Klein 2009).
Laut Wolin und Wolin (1995) bleiben ein Drittel der Kinder suchtbelasteter Eltern psychisch gesund. Die Autoren beschreiben sieben intrapsychische Resilienzfaktoren: Einsicht, Unabhängigkeit, Beziehungsfähigkeit, Initiative, Kreativität, Humor und Moral. Auch das Vorhandensein von Selbstwirksamkeitserwartung gilt als protektiver Faktor dieser Kinder (Klein 2009).
Ein Großteil der Kinder aus suchtbelasteten Systemen ist dagegen von Gefühlen der Hilflosigkeit und Ohnmacht betroffen, die aus der Unberechenbarkeit des elterlichen Verhaltens resultieren (Klein 2009). Sie leiden häufig unter dem inkonsistenten Erziehungsverhalten der Eltern sowie unter Loyalitäts- und Ambivalenzkonflikten (Klein 2009). Schuldgefühle und Rollenumkehr durch Verantwortungsübernahme für die betroffenen Eltern(teile) gehören ebenfalls häufig zum Alltag (Klein 2009) und stellen für die Kinder eine Belastungssituation dar, die die eigene Entwicklung massiv behindert.
Auch Kinder von Eltern mit anderen psychischen Erkrankungen gelten als besonders gefährdet hinsichtlich eigener psychischer Erkrankung, wobei nicht nur das spezifische Risiko für die gleiche Erkrankung erhöht ist sondern auch das allgemeine Risiko für psychische Erkrankungen insgesamt (Mattejat, Remschmidt 2008, Mattejat 2005), so dass auch von einer größeren Belastung durch substanzbezogene Störungen der Kinder psychisch kranker Eltern ausgegangen werden kann, was die klinische Erfahrung bestätigt (BADO 2006, s.1.2) Umgekehrt erwiesen sich substanzbezogene Störungen mit einem Anteil von 20% als die am häufigsten auftretende psychiatrisch relevante Erkrankung bei den Eltern von kinder- und jugendpsychiatrischen Patienten (Mattejat, Remschmidt 2008).
1.5.3 Systemische Erklärungsansätze
Systemische Ansätze zum Thema Sucht beschreiben ein Ineinandergreifen biologischer, psychologischer und kommunikativ-sozialer Prozesse (Schweitzer, v. Schlippe 2007). Süchtiges Verhalten wird in engem Zusammenhang mit den Reaktionen und Bewertungen der Umwelt gesehen und durch diese verstärkt oder abgeschwächt. Die teils als etikettierend empfundene Sichtweise der Ko-Abhängigkeit in Familien wird immer häufiger durch die Sichtweise, dass Suchtverhalten ein ganzes System betrifft und folglich auch Letzteres Unterstützung benötigt, ersetzt (Schweitzer, v. Schlippe 2007).
Stierlin (1980) beschrieb Sucht als dysfunktional entgleisenden Ablösungsprozess Adoleszenter von ihren Eltern. Dieser zeige sich entweder in extremer Verwöhnhaltung (Bindungsmodus) oder im Gegenteil in Vernachlässigung (Ausstoßungsmodus). Der Drogenkonsum dient nach Stierlin im ersten Fall der Unterdrückung von aggressiven Impulsen und Liebeswünschen, die von Gleichaltrigen nicht wie von den Eltern erfüllt werden und verhindert eine bezogene Individuation[8]. Bei vernachlässigten Adoleszenten erfüllt der Konsum dagegen kompensatorisch die Funktion von ersehnter, in der Realität aber vorenthaltener Zuwendung und Geborgenheit (Stierlin 1980). Was die Beziehungsmuster in Suchtfamilien angeht, hat sich gezeigt, dass es die typische suchtspezifische Familienstruktur nicht gibt (Schwertl 1998).
Sucht wird bei Klein (2002) als nicht vollzogener Übergangsprozess gesehen, der dann auftritt, wenn Menschen sich aufgrund von belastenden Vorerfahrungen den Herausforderungen einer Veränderung nicht gewachsen sehen. Der Suchtmittelkonsum entlastet dann von den damit verbundenen Unsicherheiten. Das dadurch ausgelöste Kontrollverhalten in der Unwelt führt häufig zum dysfunktionalen Versuch, durch Fortsetzung des Konsums die Autonomie zu wahren. Mit dieser Art symmetrischer Eskalation geht meist auch ein vermehrtes Fürsorgeverhalten von Familie und Helfersystem einher: „Das süchtige Trinken lädt also zu einer Beziehungsform ein, bei der gleichzeitig Bindung und Autonomie gelebt werden, auf der Basis einer strikten Spaltung zwischen Trinker, Ko-Abhängigem und Umwelt“ (Schweitzer, v. Schlippe 2007, S.202).
1.5.4 Systemische und familientherapeutische Interventionen
Die beschriebenen komplexen Zusammenhänge und Entstehungsbedingungen von substanzbezogenen Störungen bei Jugendlichen legen therapeutische Interventionen nahe, die nicht nur auf das Individuum - den Symptomträger - ausgerichtet sind, sondern die Familie und unter Umständen weitere Systeme (z.B. relevante Bezugspersonen aus Jugendhilfe und Suchthilfe) einbeziehen.
In den USA wurden verschiedene systemische und/oder familienzentrierte Ansätze untersucht und mit anderen Behandlungsverfahren verglichen. Für die multisystemische Therapie, die auf Interventionen bewährter familientherapeutischer und anderer Verfahren aufbaut, konnten positive Effekte bei suchtmittelabhängigen und sozial auffälligen Jugendlichen nachgewiesen werden, die sich vor allem in der Verbesserung bezüglich psychosozialer Begleiterscheinungen wie Schulbesuch (Brown et al 1999) und Delinquenz (Henggeler et al 2002) zeigten, schwächer ausgeprägt auch in der Reduktion des Substanzkonsums. Liddle et al (2007) wiesen für die Multidimensionale Familientherapie eine Überlegenheit gegenüber einer anderen erfolgreich evaluierten Gruppenintervention nach. Diese zeigte sich in einem häufigeren Abschluss der Behandlung und einer signifikant höheren Abstinenzrate im 12-Monats-Follow-Up.
Auch Diamond et al (1996) zeigten, dass die Einbeziehung der Eltern und insbesondere eine dadurch erreichte Verbesserung des Erziehungsstils sich auf Behandlungsergebnisse jugendlicher Suchtpatienten positiv auswirkten.
In Deutschland schlagen Küstner et al (2009) insbesondere für die Frühintervention suchtgefährdeter Kinder und Jugendlicher ein ambulantes familientherapeutisches Setting vor. Systemische Familientherapie bei suchtmittelabhängigen Jugendlichen gilt als gut evaluiert und effektiv, dies wurde in verschiedenen Studien nachgewiesen (Thomasius 2004, Thomasius et al 2005, v. Sydow et al 2006). In der Eppendorfer Suchtambulanz in Hamburg wird Familientherapie in einem mehrphasigen Modell (Klärungsphase, Veränderungsphase, Neustrukturierung) bei jüngeren Suchtpatienten angewendet, die sozial und v.a. familiär gut integriert sind (Küstner et al 2005). Systemisch-familientherapeutisches Vorgehen ist den Autoren zufolge in diesem Rahmen vor allem dann angebracht, wenn der Suchtmittelkonsum in Zusammenhang mit Abgrenzungskonflikten des Jugendlichen oder der Familienmitglieder einhergeht, Generationengrenzen zu durchlässig sind und der Jugendliche in Rollenumkehr als Elternersatz, als Partnerersatz oder als ewiges Kind gebunden bleibt (Thomasius et al 2002).
Aufgrund der unter 1.5.2 beschriebenen Loyalitäts- und Ambivalenzkonflikte, denen Kinder in suchtbelasteten Systemen oft ausgesetzt sind (Klein 2009), soll das Ziel familientherapeutischer Interventionen sein, dysfunktionale Loyalitätsbindungen, die zu Krisen und Konflikten führen, zu erkennen und altersangemessene Ablösungsprozesse und eine „emotionale Individuation“ (Boszormenyi-Nagy, Spark 1998) zu unterstützen. Erst wenn diese unsichtbaren Loyalitätsverpflichtungen gelockert werden und eine Versöhnung mit den realen oder verinnerlichten Eltern stattfinden kann, sind Ablösung und das Eingehen neuer Beziehungen ohne Schuldgefühle möglich (Boszormenyi-Nagy, Spark 1998). Delegationen[9] und Parentifizierungen[10] innerhalb der Familien zu identifizieren kann dabei ein erster, entlastender Schritt sein.
Von Sydow (2002) verglich systemische und bindungstheoretische Ansätze und stellte die Ähnlichkeiten (z.B. Fokus auf Familienbeziehungen, Beschäftigung mit normalen und abweichenden Entwicklungsverläufen) wie auch Unterschiede (Defizit-Orientierung der Bindungstheorie vs. Ressourcenorientierung der systemischen Theorie; Fokus auf Vergangenheit und Gegenwart vs. Gegenwart und Zukunft; dyadische vs. triadische Sichtweise) zusammen. Sie leitet daraus den integrativen Vorschlag einer systemischen Bindungstheorie ab. Diese betont sowohl die intrapsychischen wie auch die interpersonalen Dimensionen von Bindung und deren wechselseitige Beeinflussung. Sie schlägt für therapeutisches Vorgehen einen ressourcenorientierten Fokus vor, der sich auf die Gegenwart und Zukunft richtet, dabei jedoch Vergangenes - insbesondere Erfahrungen von Trauma und Verlust - berücksichtigt.
Stachowske (2002, 2004) sieht im Drogenkonsumverhalten der heutigen Zeit eine Fortsetzung früherer Drogenepidemien und stellt einen Zusammenhang zu verdrängten Themen unserer Kultur, insbesondere zu den Auswirkungen der Kriege des 20. Jahrhunderts her. In der von ihm geprägten Mehrgenerationentherapie geht es vor allem darum, die Funktion des Symptoms Drogenkonsum aus der Familiengeschichte heraus zu verstehen. Dabei spielt die Genogrammarbeit eine große Rolle.
1.6 Psychoanalytische und psychodynamische Ansätze zur Erklärung der Sucht
Psychodynamische Ansätze beschreiben das Phänomen der Sucht überwiegend auf der Grundlage der Objektbeziehungstheorie. Bilitza (1993) formuliert drei Thesen, die sich auf die Bedeutung des Suchtmittels für den konsumierenden Menschen beziehen. So kann das Suchtmittel als Objekt-Ersatz, als Partialobjekt oder als Übergangsobjekt gesehen werden. Sucht könnte also als „pathologisches Endergebnis einer unbewältigten Beziehungs geschichte[11] verstanden werden“ (Bilitza 1993, S. 163). Die Funktion als Objekt-Ersatz kommt jedoch nur dann in Frage, wenn Ganzobjektsbeziehungen ausgebildet wurden, z.B. beim neurotischen Problemtrinker. Für einen großen Teil suchtkranker Menschen hat nach Bilitza (1993) das Suchtmittel Partialobjektcharakter, was dazu führt, dass es als „nur gut“ oder „nur böse“ gesehen wird.
Neuere psychodynamische Ansätze (Rost 2005, Rost 2007, Voigtel 2000) unterscheiden verschiedene Gruppen süchtiger Menschen, ebenfalls ausgehend von der Bedeutung des Suchtmittels, wobei beide die interpersonelle und innerpsychische Dynamik berücksichtigen.
Ähnlich wie Bilitza sieht auch Rost (2007) die Sucht auf neurotischer Grundlage als die am wenigsten stark ausgeprägte Störung innerhalb des Suchtspektrums. Hier spielen v.a. die Bewältigung von Schuldgefühlen oder Identifikation mit einem abhängigen Elternteil eine Rolle, was mitunter dazu führt, dass die Betroffenen stellvertretend oder in der Hoffnung, diese nahe stehenden Menschen zu retten therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen. Eine bedeutendere Rolle spielen nach Rost Suchtstörungen auf der Grundlage einer narzisstischen oder Borderline-Persönlichkeitsstörung. Aufgrund der mit diesen Störungen zusammenhängenden Ich-Schwäche wird das Suchtmittel nicht zum Genuss, sondern zur Unlustvermeidung konsumiert, weil die Betroffenen es sich nicht selbst gut gehen lassen können (Rost 2007). Sie weisen meist eine geringe Affekt- und Frustrationstoleranz auf und können Affekte nur unzureichend differenzieren. Das Suchtmittel wird hier als Selbstheilungsmittel gesehen, das defizitäre Ich-Funktionen ersetzt und defizitäre Ich-Strukturen stärkt. Es wird zum „zentralen Bezugs- und Liebesobjekt“ (Rost 2007, S. 44), was in einem Teufelskreis zur Verstärkung der Symptome und Aufrechterhaltung der Sucht führen kann. Eine dritte von Rost genannte Gruppe leidet an einer basalen Störung der Identität. Während Menschen der zweiten beschriebenen Gruppe ein Urvertrauen und die Identifikation mit der primären Bezugsperson entwickeln konnten, wurde bei den Betroffenen dieser Gruppe aufgrund wiederholter traumatisierender Erfahrungen in der Kindheit kein Urvertrauen ausgebildet. Je nach Ausprägung, die auch von der genetischen Konstitution abhängt, werden Störungen, z.B. eine Suchtstörung, entwickelt, die die Funktion der Selbstzerstörung erfüllen. Suchtmittelkonsum kann dann als Versuch ein verinnerlichtes böses Objekt zu vergiften gesehen werden. Dies beinhaltet die Gefahr eines Symptomwechsels bei Wegnahme des Suchtmittels, z.B. Suizidalität, der im Rahmen einer Suchttherapie daher besondere Beachtung geschenkt werden muss (Rost 2007).
Rost sieht die „Droge als Liebesobjekt, (das) wichtiger ist als jeder Mensch“ (Rost 2005, S.151). Er weist ausdrücklich auf die Familienperspektive hin, die zu berücksichtigen in der therapeutischen Arbeit mit suchtmittelabhängigen Menschen unerlässlich ist (Rost 2005). Charakteristisch für suchtbelastete Familien sind nach Rost dysfunktionale Beziehungen, die oft von einer Nähe-Distanz-Problematik, fehlenden Generationengrenzen und Rollenumkehr gekennzeichnet sind. In diesen Konstellationen werden Kinder häufig zur Stabilisierung der Eltern missbraucht, was ihnen altersangemessene Ablösungsschritte und Abgrenzung erschwert. Die Verweigerung eines Kindes oder Jugendlichen in der Therapie kann in diesem Zusammenhang auch als Loyalität mit den Eltern gesehen werden (Rost 2007). Umgekehrt kann die Psychotherapie betroffener Elternteile dem Kind oder Jugendlichen neue Entwicklungsmöglichkeiten bieten und zu seiner Entlastung beitragen (Rost 2007).
Voigtel (2000) unterscheidet je nach Ursache und Funktion des Suchtmittels fünf verschiedene Suchtformen: Den ersten drei Formen (adaptive, symbiotische und masochistische Sucht) liegen – ähnlich wie in Rosts zweiter Gruppe – ich-strukturelle Störungen zugrunde (Voigtel 2000). Die symptomatische Form erfüllt dagegen im Rahmen anderer psychischen Krankheiten die Funktion der Abwehr bestimmter Affekte. Die fünfte Form schließlich, von Voigtel (2000) als reaktive Sucht bezeichnet, wird häufig bei traumatisierten Menschen angetroffen und dient der Bewältigung besonderer Belastungssituationen, die mit starker Verzweiflung, Angst und Schmerz einhergehen.
Den psychoanalytischen Theorien zur Sucht ist gemeinsam, dass sie frühe aversive Erfahrungen mit der primären Bezugsperson für die Entstehung einer Suchtkarriere (mit)verantwortlich machen. Suchtmittel werden als Ersatz für reale zwischenmenschlichen Beziehungen gesehen und vermitteln in diesem Sinne auch das Gefühl, von anderen unabhängig und ohne Verantwortung zu sein. Substanzbezogene Störungen treten in diesem theoretischen Kontext meist im Zusammenhang mit anderen psychischen Störungen auf und erfüllen vor allem die Funktion der Bewältigung unangenehmer Affekte (Rost 2005/2007, Voigtel 2000). Für die Suchttherapie bedeutet dies nach Ebi (zitiert in Sonnenmoser 2003), dass Erscheinungsbild und Verhalten von Suchtpatienten häufig zu aggressiven Gegenübertragungen und unangenehmen Gefühlen der Leere und Ohnmacht, aber auch der Verschmelzung und des Vereinnahmtwerdens auf Seiten der Behandler führen mit der Gefahr, die Behandlung und somit die Beziehung abzubrechen. Ebi führt die damit einhergehenden Gegenübertragungsempfindungen auf die Trennungsproblematik dieser Patienten zurück, die eine innere Eigenständigkeit nicht entwickeln konnten. „Auf Trennungserlebnisse (vom Behandler)[12] reagieren diese Patienten oft mit Rückfällen oder sogar mit Therapieabbruch“ (Sonnenmoser 2003).
Bei jugendlichen Suchtpatienten, die aufgrund ihres früh begonnenen Substanzkonsums die Entwicklungsschritte der Identitätsfindung noch nicht absolviert haben, dürfte sich erst im Laufe eines längeren Behandlungsprozesses herausstellen, ob eine „basale Störung der Identität“ nach Rost vorliegt, oder ob es sich um eine retardierte Entwicklung handelt. Das Ausmaß der ich-strukturellen Defizite ist kaum zu Beginn einer Suchtbehandlung Jugendlicher feststellbar.
1.7 Bindungstheorie
1.7.1 Grundgedanken der Bindungstheorie
Die Ansätze der Bindungstheorie liefern für das Verständnis kinder- und jugendpsychiatrischer Störungen wichtige Grundlagen, die in neuerer Zeit zunehmend in den Fokus der Therapieforschung rücken (Schindler 2001/2005/2009, Laucht 2006, Hüther 2006).
Grundgedanke der auf Bowlby zurückgehenden Theorie ist die Bedeutung der primären Bezugsperson, meist der Mutter, als „sichere Basis“ für das Kind, die ihm Fürsorge und Verlässlichkeit vermittelt und dadurch eine angemessene Exploration der Umwelt ermöglicht. Bei Angst oder Bedrohung wird das Bindungsverhalten aktiviert, das Explorationsverhalten zurückgestellt. Mit Bindungsverhalten ist von Bowlby ausgehend (Bowlby 1969) ein Verhaltenssystem gemeint, das unter anderem einen biologischen Zweck erfüllt. Durch das Aufsuchen der Nähe zur Bindungsperson werden Sicherheit, Schutz vor bedrohlichen Menschen und Situationen sowie Nahrung und andere für das Überleben wichtige Voraussetzungen gewährleistet. Bindungsverhaltensweisen umfassen positive Signale (z.B. Lächeln) und aversive Verhaltensweisen (Schreien), die die Aufmerksamkeit der Fürsorgeperson erregen, sowie Fortbewegungsaktivitäten, die es ermöglichen sich dieser anzunähern (Fonagy 2006). Ziel des Bindungsverhaltens ist nach Fonagy (2006) jedoch nicht ein Objekt (Bezugsperson), sondern ein Gefühlszustand. Für dessen Erlangung sind vor allem der Lebenskontext und die Reaktion der Fürsorgeperson von Bedeutung.
Das Bindungsverhalten ist eng mit dem Explorationsverhalten verknüpft. Dieses ist ein erkundendes Verhaltenssystem, das dem Kind ermöglicht, Neues zu Lernen sowie Autonomie und Selbstständigkeit zu entwickeln. Bei drohender Gefahr (insbesondere Trennung von der Fürsorgeperson) wird durch physiologische Prozesse (innere Erregung mit Anstieg der Herzfrequenz) das Bindungssystem[13] aktiviert, das das Kind zum Aufsuchen der Schutz bietenden Bezugsperson anregt (Spangler, Grossmann 1993).
Bindungsbeziehungen unterscheiden sich qualitativ im Ausmaß, in dem sie Sicherheit vermitteln (Grossmann, Grossmann 2005). Die Bindungsqualität kann in der Kindheit in Bezug auf verschiedene Bindungspersonen unterschiedlich aussehen, sie ist also spezifisch für jede individuelle Beziehung und kein Merkmal des Kindes als Person (Grossmann, Grossmann, 2007).
Für die Entwicklung sicherer Bindungsmuster ist die elterliche Feinfühligkeit von besonderer Bedeutung. Damit ist die auf die jeweilige Befindlichkeit abgestimmte Unterstützung bei der physiologischen, emotionalen und Verhaltensregulation des Kindes im Sinne einer „externen Regulationshilfe“ gemeint (Ziegenhain 2009). Feinfühliges Verhalten von Eltern steht in Zusammenhang mit deren eigener sicherer bzw. autonomer Bindungsrepräsentation (s.1.7.3). Diese setzt eine weitgehende Verarbeitung und Integration unangenehmer bindungsrelevanter Erfahrungen und Erlebnisse voraus.
Erst das Vorhandensein einer sicheren Basis in Form einer verlässlichen Bindungsperson ermöglicht das für die Entwicklung notwendige Explorationsverhalten. Das Gleichgewicht von Bindungs- und Explorationsverhalten ist somit Voraussetzung für die Entwicklung von Bindungssicherheit (Ziegenhain 2009). Das Erleben und Erlernen von Selbstregulation und Selbstwirksamkeit, die für eine angemessene Autonomieentwicklung notwendig sind, sowie ein schützendes Umfeld mit wichtigen emotionalen Beziehungen sind wichtige frühkindliche Erfahrungen und für eine gesunde Bindungsentwicklung des Individuums relevant (Hüther 2006).
Die Fähigkeit intuitiv anderen Menschen mentale Prozesse, also Wünsche, Phantasien, Absichten etc., zu unterstellen, wird in der Bindungstheorie als theory of mind bezeichnet (Fonagy et al 2004). Sie wird von sicher gebundenen Kindern schneller erworben und führt dazu, dass diese empathischer sind, da sie früh gelernt haben, die Welt als hinlänglich einschätzbar zu begreifen. Dies wiederum wirkt sich positiv auf die sozialen Kompetenzen aus. Kinder feinfühliger Eltern lernen durch verlässliches Reagieren der Bindungsperson früh, dass ihr Verhalten Wirkung hat, was maßgeblich zur Entwicklung der eigenen Selbstwirksamkeitserwartung beiträgt. Sie verfügen über bessere Problemlösestrategien, da sie ausgehend von einer sicheren Basis in Neugier und Explorationsverhalten bestärkt
wurden. Die damit verbundenen Erfahrungen erfolgreichen Bewältigens tragen zu einer positiven Entwicklung des Selbstkonzepts bei. Diese Kinder zeigen einen kompetenteren Umgang mit Stress und flexiblere Bewältigungsmöglichkeiten (Schleiffer 2007).
Die Qualität der primären Bindungen beeinflusst somit Vertrauen in andere und Selbstvertrauen, die Bereitschaft, bei emotionaler Belastung Hilfe anzunehmen und Anderen Hilfe zu geben sowie die Fähigkeit neue Beziehungen und Bindungen aufzubauen (Grossmann, Grossmann 2007). Wo diese Sicherheit in der zwischenmenschlichen Bindung fehlt, ist die gesunde psychische Entwicklung des Kindes und später des Jugendlichen beeinträchtigt.
1.7.2 Bindung im Jugendalter
Analog zu den Strategien sicherer bzw. unsicherer Bindung im Kindesalter, sind im späteren Jugend- und Erwachsenenalter Bindungsrepräsentationen erkennbar, die als interne Arbeitsmodelle und Organisation von Bindung zu verstehen sind. Der Begriff der inneren Arbeitsmodelle wurde in diesem Zusammenhang erstmals von Bowlby (1969) eingeführt. Diese Modelle werden aus den Interaktionsmustern und -erfahrungen, die als Kind mit den primären Bindungspersonen gemacht wurden, aufgebaut (Bowlby 1969). Sie ermöglichen es das eigene Bindungsverhalten sowie das der Bezugspersonen und die damit verbundenen Gefühle und Gedanken zu regulieren, zu interpretieren und vorauszusagen. Sie entsprechen einem Verarbeitungsstatus der bindungsrelevanten Lebenserfahrungen und beinhalten eine Gedächtnisorganisation, die den Zugang zu diesen Informationen erleichtern oder erschweren kann (Main, Kaplan, Cassidy 1985). Sie bilden also die Bewertung und emotionale Integration der Bindungserfahrungen, nicht diese selbst ab (Zimmermann, Becker-Stoll 2001) und sind bei Jugendlichen deutlich differenzierter als Bindungsmodelle bei Kleinkindern (Bretherton 2001).
Es wird davon ausgegangen, dass die Bindungsentwicklung in den ersten fünf Lebensjahren sehr von Umgebungsfaktoren beeinflusst ist und während der gesamten Kindheit und Jugendzeit sensibel auf Veränderungen im Umfeld reagiert. Unter bestimmten Bedingungen kann von einer Stabilität und Vorhersagbarkeit des Bindungstyps über die ersten 18 Lebensjahre hinweg ausgegangen werden. (Van Ijzendoorn 1995a; Van Ijzendoorn, Bakermans-Kranenburg 1997). Eine signifikante Übereinstimmung von Bindungsqualität in den ersten beiden Lebensjahren und Bindungsrepräsentation im Jugendalter konnte jedoch nicht durchgängig nachgewiesen werden. Es ist davon auszugehen, dass sich sowohl sehr frühe Einflüsse im Entwicklungsverlauf wie auch solche im Jugendalter, Erfahrung von Unterstützung, emotionaler Zuwendung bzw. Zurückweisung sowie die Bindungsrepräsentation der primären Bezugsperson selbst auf die Bindungsrepräsentationen Jugendlicher auswirken (Bowlby 1980, Zimmermann, Becker-Stoll 2001). Welche Rolle dabei Temperament und Persönlichkeitsfaktoren spielen ist noch nicht vollständig geklärt (Van Ijzendoorn 1995a). Die spätere Bindungsrepräsentation wird also nicht allein durch das Bindungsmuster der ersten Lebensjahre bestimmt. Ihre Qualität resultiert vielmehr aus der Gesamtheit der bindungsrelevanten Erfahrungen mit den Eltern bis zum Jugendalter (Zimmermann, Becker-Stoll 2001; Van Ijzendoorn, Bakermans-Kranenburg 1997). Diese Erfahrungen von emotionaler Zuwendung oder Zurückweisung haben einen starken Einfluss auf die Entwicklung im Jugendalter. Dies zeigt sich im Umgang mit Belastungen, in der Art der Emotions- und Verhaltensregulation und dem Vorhandensein funktionaler Copingstrategien. Aber auch Selbstbild und Identität des Jugendlichen sowie soziale Kompetenzen und die Art der Beziehungsgestaltung stehen maßgeblich mit diesen Erfahrungen und der daraus resultierenden Bindungsrepräsentation in Zusammenhang (Zimmermann, Becker-Stoll 2001). Bei suchtmittelabhängigen Jugendlichen fällt klinisch oft eine deutliche Beeinträchtigung der Selbstregulation von Emotionen und Verhalten auf, was einen Zusammenhang mit unsicherer Bindungsentwicklung nahe legt, sofern man nicht die Substanzwirkung selbst dafür verantwortlich machen kann[14].
Frühe unsichere Bindungserfahrungen erhöhen außerdem die Vulnerabilität für psychische Störungen (Rosenstein, Horowitz 1996, Strauß 2006). Insbesondere aus klinisch relevanten Bindungsstörungen und hochunsicherer Bindung[15] resultieren im Jugendalter oder frühen Erwachsenenalter häufig Persönlichkeitsstörungen (Ziegenhain 2009).
Eine mangelnde emotionale Bindung hinterlässt auch neuroradiologisch nachweisbare Veränderungen im Gehirn (Hüther 2006). Mittlerweile gibt es auch Erkenntnisse über die Auswirkungen frühkindlicher Trennungserfahrungen in Form von langfristigen Veränderungen in den Reifungsprozessen des zentralen Nervensystems sowie in der basalen Cortisolreaktion, also die allgemeine Stressreaktion betreffend (Hüther 2006).
Insbesondere kritische Lebensereignisse wie Trennung von den Eltern, Verlust eines Elternteils durch Tod, Erfahrungen von Misshandlung und Missbrauch zeigen im Jugendalter Auswirkungen auf die internen Bindungskonzepte, wobei auch hier Faktoren wie z.B. die gute Beziehung zu einer verlässlichen anderen Person protektiv wirken können (Grossmann, Grossmann, 2005; Van Ijzendoorn, Bakermans-Kranenburg 1997)[16]. Umgekehrt „besteht die allgemeine Überzeugung, dass sichere Bindungen zu einem generalisierten Gefühl von Kompetenz und Selbstachtung führen“ (Fonagy 2006, S.55). Während das Experimentieren mit Suchtmitteln im Jugendalter aus bindungstheoretischer Sicht zunächst als alterstypisches Risikoverhalten gesehen werden kann, das die Autonomieentwicklung vorantreibt (Schleiffer 2007), ist v.a. dann von einer Gefährdung auszugehen, wenn protektive Faktoren, zu denen auch und in besonderem Ausmaß eine ausreichend sichere Bindungsentwicklung gehört, fehlen. Auch wenn davon ausgegangen wird, dass Bindungsrepräsentationen beständiger und fester verankert sind als die frühen Bindungsmuster, können sie durch andere, korrigierende Beziehungserfahrungen - auch im Zusammenhang von Therapie - im Jugend- und Erwachsenenalter beeinflusst werden (Ziegenhain 2001). Solche durch spätere Verarbeitung und Integration erworbene Bindungssicherheit wird in den Bindungsklassifikationen auch als earned secure bezeichnet.
Unter dem Aspekt der möglichen Veränderung ist die Erfassung von Bindungsrepräsentationen in klinischen Stichproben insofern relevant, als die Ergebnisse in die Ausdifferenzierung von Therapiekonzepten und Behandlungsprozessen einbezogen werden können.
1.7.3 Bindungsrepräsentationen Jugendlicher und Erwachsener
Die Klassifikation der Bindungsrepräsentationen Jugendlicher und Erwachsener erfolgt analog zu den in der Kindheit durch die Fremde Situation[17] erfassten Bindungsmustern, wobei erstere eine allgemeine mentale Organisationsstrategie der Bindungserfahrungen - auch als „current state of mind with respect to attachment“ zitiert (Gloger-Tippelt 2001a, Buchheim 2005) - beschreiben, während die Bindungsmuster der Kindheit sich auf die Beziehung zu einer bestimmten Person (meist der Hauptbezugsperson) beziehen.
Tabelle 1 stellt die Bindungsmuster der Kindheit den entsprechenden Bindungsrepräsentationen Jugendlicher und Erwachsener gegenüber.
Tab. 1: Bindungsmuster im Kleinkindalter und Bindungsrepräsentationen Jugendlicher und Erwachsener
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Als sicher-autonom (F ree-autonomous) klassifizierte Jugendliche und Erwachsene zeichnen sich durch eine „gelungene Integration von Autonomie und emotionaler Verbundenheit“ (Ziegenhain 2001, S. 172) aus. Sie verfügen meist über gute soziale Kompetenzen und ein höheres Selbstwertgefühl sowie insgesamt über eine gute seelische Gesundheit.
Personen mit unsicher-distanzierenden Bindungsrepräsentationen (D ismissing), die sich meist aus wenig liebevollen bis ablehnenden Beziehungserfahrungen in der Kindheit entwickeln (Gloger-Tippelt 2001b) neigen in Problemsituationen eher zu sozialem Rückzug und suchen selten Rat und Unterstützung von Freunden (Zimmermann, Becker-Stoll 2001). Es besteht ein Zusammenhang nicht nur zu Trennungserfahrungen sondern auch zu mangelnder emotionaler Responsivität der Eltern, die zur Verdrängung des Bindungswunsches als Abwehr der damit verbundenen negativen Gefühle führt. Unsicher-distanzierende Bindungsmodelle treten laut bisherigem Forschungsstand seltener in klinischen Stichproben auf als unsicher-präokkupierte. Es liegen jedoch Ergebnisse über Zusammenhänge zwischen unsicher-distanzierender Bindungsrepräsentation und Essstörungen sowie über gehäuftes Auftreten bei Jugendlichen mit Drogengebrauch und Verhaltensstörungen vor (Cole-Detke, Kobak 1996).
Unsicher-präokkupierte Bindungsrepräsentationen (E nmeshed/ entangled) entstehen in der Regel aus widersprüchlichem Erziehungsverhalten, das sich selten in offener Zurückweisung zeigt. Meist wurde vom Kind eine erhöhte Aufmerksamkeit für die Bedürfnisse der Eltern gefordert, altersangemessene Abgrenzung und Ablösungsschritte im Jugendalter werden dadurch erschwert. Typisch ist auch eine Überforderung durch Rollenumkehr und Parentifizierung, die z.B. bei Kindern mit einem psychisch kranken Elternteil gehäuft auftritt (Gomille 2001). Der präokkupierte Bindungsstatus tritt häufig bei klinischen Probanden auf, oft auch in Kombination mit einem unverarbeiteten. Er wirkt sich meist in einem negativen Selbstbild, mangelndem Vertrauen in Beziehungen sowie Schwierigkeiten bei der Emotionsregulation aus (Gomille 2001). Menschen mit einem solchen Bindungsstatus haben gelernt, ihre Bindungsbedürfnisse übersteuert zum Ausdruck zu bringen und sind oft unsicher bzgl. interpersonaler Grenzsetzungen. Hohe Anteile präokkupierter Bindungsrepräsentationen finden sich bei Menschen mit Persönlichkeitsstörungen, v.a. bei Borderline-Patienten (Fonagy et al 1996).
Ein unverarbeiteter Bindungsstatus (U nresolved) ist in der Regel mit einschneidenden Erfahrungen von Trauma und Verlust verbunden. Neben Misshandlung und sexuellem Missbrauch spielen hierbei längere oder häufige Trennung von oder der Tod einer Bindungsperson eine für die Entstehung relevante Rolle. Entscheidend für die Zuordnung ist jedoch nicht die Erfahrung für sich, sondern das Ausmaß der Verarbeitung bzw. Traumatisierung (Hauser 2001). Frühe Traumatisierung führt meist zu einer Einschränkung der Fähigkeit zur Selbstreflexion sowie einer erhöhten Vulnerabilität v.a. für eine Borderline-Störung und dissoziative Symptomatik (Hauser 2001). Sie ist mit einer hohen Wahrscheinlichkeit der Weitergabe traumatischer Erfahrungen an die eigenen Kinder verbunden (Oliver 1993). Immer wieder ist dabei auch die eigene Ernnerungsfähigkeit an das traumatische Ereignis eingeschränkt (partielle Amnesie) oder abgespalten (Dissoziation). Besteht trotz traumatischer Bindungserfahrungen eine stabile, sichere Bindung zu einer weiteren Person, so kann sich dies als protektiv für die weitere Bindungsentwicklung auswirken (Hauser 2001).
Hesse (1996) schlug später eine weitere Klassifikation vor, die als „nicht klassifizierbar“ (cannot classify - CC) bezeichnet wurde und die überwiegend in klinischen Stichproben auftritt (Gloger-Tippelt 2001b, Hesse 1996). Zur Kategorie cannot classify (CC) wird zugeordnet, wenn keine einzelne der beschriebenen Repräsentationen vorherrschend ist oder ein genereller Zusammenbruch in der Diskursstrategie im Gegensatz zu einem partiellen beim unverarbeiteten Bindungsstatus (U) erkennbar wird (Hesse 1996). Dieser ist gekennzeichnet durch eine sehr geringe Kohärenz des Erzählten.
Häufig ist hier ein Wechsel zwischen den beiden inkompatiblen oder widersprüchlichen Kategorien vermeidend und präokkupiert (Hesse 1996). Andere Jugendliche oder Erwachsene, die als CC klassifiziert werden, zeigen dagegen keinerlei Strategie mit bindungsrelevanten Themen umzugehen. Die Kategorie cannot classify kommt vor allem bei Menschen mit psychiatrischen Krankheitsbildern, psychisch kranken Straftätern und sexuell missbrauchten Frauen vor und sollte daher nicht als „Abfalleimer für seltene Fälle“ (Hesse 1996, Übersetzung d. Verfasserin) gesehen werden.
Bisher noch nicht vollständig geklärt ist, unter welchen Umständen traumatische Erfahrungen in einer unverarbeiteten (U) versus einer cannot classify (CC) Bindungsrepräsentation resultieren. Bezüglich der CC-Klassifikation vermuten Steele und Steele (2001, S.333): „Den Fällen gemeinsam scheint eine schwerwiegende und wiederholte traumatisierende Erfahrung zu sein“.
Die Klassifikationen unsicher-distanzierend und unsicher-präokkupiert werden als organisierte Formen unsicherer Bindung gesehen, die häufig mit gewissen Beeinträchtigungen bis hin zu psychischen Störungen verbunden sind, jedoch ist nicht immer von einer klinischen Relevanz auszugehen. Sie sind eher als Risikofaktoren zu sehen, die die Entwicklungsrisiken eingeschränkter sozialer oder emotionaler Kompetenzen bergen (Green, Goldwyn, 2002).
Der unverarbeitete Bindungsstatus und die Kategorie cannot classify dagegen werden als hochunsichere Bindungsrepräsentationen bezeichnet, die mit erheblichen Störungen in der seelischen Entwicklung verbunden und daher überwiegend in klinischen Populationen vorzufinden sind. Wie die im ICD-10 und DSM-IV beschriebenen Bindungsstörungen sind sie entwicklungspsychopathologisch relevant und ähneln diesen im Erscheinungsbild häufig. Im Gegensatz zu den in der Nosologie psychischer Störungen beschriebenen Bindungsstörungen handelt es sich bei der hochunsicheren Bindung um ein entwicklungspsychologisches Konzept. Beide beschreiben jedoch Bindungsverhaltensweisen, die stark von den erwarteten Verhaltensweisen abweichen (Ziegenhain 2009).
Schleiffer (2007) fand in einer Erhebung unter Jugendlichen in Heimerziehung einen Anteil hochunsicherer Bindungsrepräsentationen (U/CC) bei 55% der Befragten, wobei auch hier ein starker Zusammenhang mit psychiatrischer Auffälligkeit erkennbar war.
Als gängiges Verfahren zur Erfassung von Bindungsrepräsentationen Jugendlicher und Erwachsener wird das Adult Attachment Interview (George, Kaplan, Main, 1984/1985/1996) verwendet. Empfohlen wird der Einsatz des Verfahrens bei Jugendlichen ab 16 Jahren, da ab diesem Alter eine distanziertere Betrachtung von Bindungserfahrungen mit den Eltern und ihre Bewertung möglich sind (Zimmermann; Becker-Stoll 2001). Inhalt, Durchführung und Auswertung des Interviews, das auch in der vorliegenden Studie verwendet wurde, werden im Kapitel 2 (Methodik) näher beschrieben.
Verschiedene Autoren befürworten den klinischen Einsatz des AAI auch zu diagnostischen Zwecken (Steele, Steele 2001, Fonagy et al 1996). Sie fanden heraus, dass sich im Therapieverlauf die Reflexionsfähigkeit der Patienten verbessert und diese Veränderung vor allem bei anfangs als unsicher-distanzierend klassifizierten Patienten eintritt.
Neben verschiedenen Fragebögen, Selbsteinschätzungs- und Ratingskalen, die sich auf bewusste Erlebnisinhalte beziehen und auf die hier nicht näher eingegangen wird, gibt es in der Bindungsforschung weitere inzwischen klinisch-diagnostisch und zu Forschungszwecken angewandte Instrumente, die die inneren Arbeitsmodelle von Bindung erfassen (Buchheim 2005).
Die neben dem AAI inzwischen am häufigsten angewandte Methode ist das Adult Attachment Projective (George; West 2001, Buchheim 2005). Das AAP ist ein projektives Verfahren, bei dem den Probanden acht Umrisszeichnungen, sieben davon mit bindungsbezogenen Inhalten, vorgelegt werden. Diese zeigen bindungsrelevante Situationen wie Trennung, Krankheit, Bedrohung etc. Die Erzählungen der Probanden zu den einzelnen Szenen werden wie im AAI wörtlich transkribiert und unter den Aspekten Inhalt, Abwehrprozesse und Diskurs kodiert (Buchheim 2005). Sie ermöglichen eine Zuordnung zu den Kategorien des AAI. Insofern ist das AAP eine ökonomischere Variante, da sowohl Durchführung wie auch Auswertung weniger komplex sind (George;
West 2001). Es wurde eine hohe Übereinstimmung mit dem AAI festgestellt (Buchheim 2005). Jedoch erfasst das AAP keine autobiographischen Fakten, die vor allem bei klinischen Stichproben und Untersuchungen, die sich auf entwicklungspsychologische Fragestellungen beziehen, relevant sind. So ist je nach Fragestellung zu entscheiden, ob sich der Einsatz des aufwändigeren AAI lohnt.
1.7.4 Transgenerationale Zusammenhänge
Verschiedene Studien zeigten eine hohe Korrelation zwischen der Bindungsqualität von Kindern in der Fremden Situation und der ihrer Mütter (Van Ijzendoorn 1995a, Grossmann und Grossmann 2005; Main 2001; Fonagy et al 1991). Die Responsivität der Bezugsperson als Fähigkeit, die kindlichen Bedürfnisse und Signale zu erkennen und angemessen zu beantworten spielte dabei eine entscheidende Rolle. Eine Weitergabe desselben Bindungsmusters an die folgende Generation erfolgte häufiger durch die Mütter als durch die Väter. (Van Ijzendoorn, Bakermans-Kranenburg 1997, Holmes 2002). Dennoch kommt auch den Vätern in der Bindungsentwicklung eine große Bedeutung zu: Grossmann und Grossmann (2007) gehen davon aus, dass diese eher das Explorationsverhalten des Kindes fördern, anleiten und unterstützen, während den Müttern häufiger die Rolle der sicheren Basis zukommt.
In einer Studie von Benoit und Parker (1994) wurde die intergenerationale Vermittlung von Bindungmustern über drei Generationen hinweg (Großmütter, Mütter und Kinder) untersucht und ein signifikanter Zusammenhang nicht nur zwischen Müttern und Kindern, sondern auch zwischen Großmüttern und Enkeln festgestellt (Benoit, Parker 1994).
Van Ijzendoorn (1995b) untersuchte in einer Metaanalyse die spezifische Weitergabe der einzelnen Bindungsklassifikationen und stellte dabei eine hohe Prädiktivität für alle Klassifikationen fest (Van Ijzendoorn 1995b). Diese war für die präokkupierte Bindungsrepräsentation allerdings nur dann stark ausgeprägt, wenn der unverarbeitete Bindungsstatus nicht berücksichtigt wurde. Es wurde jedoch festgestellt, dass die Kontinuität dieser Entwicklung durchaus von Kontextfaktoren beeinflusst werden konnte. So wirkten sich insbesondere spätere Bindungserfahrungen mit Eltern, nahen Freunden, Partnern oder auch Therapeuten aus (Van Ijzendoorn, Bakermans-Kranenburg 1997). Eine Diskontinuität des Bindungsmusters stand häufig in Zusammenhang mit bindungsrelevanten negativen Lebensereignissen wie Verlust eines Elternteils, Scheidung, lebensbedrohlicher Erkrankung, psychischer Störung eines Elternteils sowie sexuellem
Missbrauch. Insbesondere Beziehungsabbrüche im nahen Bezugsumfeld wirkten sich hier aus. Eine Kontinuität des kindlichen Bindungsmusters bestand vor allem unter weitgehend gleich bleibenden Bedingungen (Van Ijzendoorn, Bakermans-Kranenburg 1997).
Therapeutische Interventionen zur Verbesserung der Feinfühligkeit von Müttern erwiesen sich als wirksam auf der Verhaltensebene. Dies wirkte sich positiv auf die Bindungsentwicklung des Kindes und dessen Bindungsmuster aus, wenngleich sich die Bindungsrepräsentation der Mütter dabei meist nicht veränderte (Van Ijzendoorn, Bakermans-Kranenburg 1997).
Zusammenfassend ist also von einer transgenerationalen Weitergabe von Bindungsqualität auszugehen, die jedoch im Entwicklungsverlauf von multiplen Faktoren modifiziert werden kann.
1.8 Bindung und Trauma
Sowohl die transgenerationale Weitergabe traumatischer Erfahrungen (s. 1.9.2) wie auch ein eigenes Erleben traumatischer Situationen entweder in Form eines Monotraumas oder auch als traumatisierender Entwicklungskontext wirken sich auf die Art der Bindungsrepräsentationen aus.
Besonders gravierend sind die Folgen intrafamiliärer Traumatisierung, weil hier eine potenziell schützende Bezugsperson Verursacher der erlebten Traumata ist, was in der Regel mit der Entwicklung hochunsicherer Bindungsmuster bzw. schwerwiegender Bindungsstörungen verbunden ist (Main u. Hesse 1990, Schechter 2006, Brisch 2006). Eine große Rolle dabei spielt die permanente Erfahrung von Furcht in der Beziehung zu einer nahen Bezugsperson (Main u. Hesse 1990). Daraus entsteht für das Kind das Dilemma, dass einerseits durch die Furcht sein Bindungssystem aktiviert wird, gleichzeitig die Bindungsperson, dessen Nähe es sucht, diese auslöst. Dies führt zu einem Kollabieren der Verhaltensstrategien wie es für Kinder mit einem desorganisierten Bindungsmuster typisch ist.
Neben der eigenen oft chronischen Traumatisierung von Kindern und Jugendlichen, die sich in der Bindungsentwicklung auswirkt, wird davon ausgegangen, dass sich auch unverarbeitete elterliche traumatische Erfahrungen auf die Bindungsqualität der Kinder auswirken können und zu desorganisierten Bindungsmustern führen. Dabei spielen sowohl die Angst des Kindes vor der Bezugsperson, wie die Angst der traumatisierten Bezugsperson, die sich in der Interaktion auf das Kind überträgt, eine zentrale Rolle (Main, Hesse 1990, Brisch 2006, Schechter 2006).
Schechter (2006) fand in einer klinischen Studie mit durch Gewalterfahrungen traumatisierten Müttern und ihren Kleinkindern heraus, dass traumatisierte Bezugspersonen ihr traumatisches Erlebnis in der Interaktion mit dem Kind in Handlung und Sprache vermittelten. Die Reinszenierung des Traumas in der Mutter-Kind-Beziehung wirkte sich auf die Psyche von beiden aus und beeinflusste die Entwicklung der Affektregulation des Kindes (Schechter 2006). Posttraumatisch belastete Mütter hatten - bedingt durch physiologische Fehlregulationen - bei entsprechenden Auslösern (z.B. Wutanfällen des Kindes) Schwierigkeiten, das Kind zu beruhigen, die Belastung zu lindern und dem Kind durch gegenseitige Affektregulierung und vereinte Aufmerksamkeit in kritischen Entwicklungsphasen beizustehen. Sie erlebten sich häufig als überfordert und waren nicht in der Lage, das, was in ihnen und ihrem Kind in derartigen Situationen vorgeht, zu reflektieren (Schechter, Coates, First 2006).
Wie Schäfer (2006) treffend beschreibt, spielen im Falle einer frühen interpersonalen Traumatisierung neben sexuellem Missbrauch und körperlicher Misshandlung (und auch ohne deren Vorhandensein) vor allem Lebensbedingungen eine Rolle, die in Form von Vernachlässigung, psychischer Gewalt und dem Fehlen einer verlässlichen emotional bedeutsamen Bezugsperson einen traumatisierenden Entwicklungskontext darstellen. Schäfer spricht hier von „Beziehungs-“ oder „Bindungstraumata“[18] (Schäfer 2006, S.13). Abhängig von der Konstellation und Kumulation dieser und weiterer Risikofaktoren und dem Vorhandensein protektiver Faktoren erhöht sich dadurch die Wahrscheinlichkeit einer späteren psychischen Erkrankung unter Umständen immens.
Die von Terr (1991) als Typ 2 –Traumata beschriebenen chronischen Traumatisierungen mit den (altersabhängigen) Folgen komplexerer psychischer Beeinträchtigungen und Komorbidität wurden von Van der Kolk (2005; van der Kolk, Pynoos 2009) und seiner
Arbeitsgruppe[19] weiterentwickelt. Dabei wurden besonders Entwicklungsaspekte beachtet. Die Diagnosekategorie der „Developmental Trauma Disorder“ beschreibt die komplexen kindlichen Traumafolgestörungen, für die die gängigen Klassifikationssysteme ICD 10 und DSM IV noch keine eigenständige Kategorie entwickelt haben. Dabei wird deutlich, dass die Symptomausprägungen, die in Tabelle 2 dargestellt werden, häufig denen anderer jugendpsychiatrischer Störungsbilder ähneln, die sich in Dysregulation von Verhalten und Emotionen zeigen (Störungen des Sozialverhaltens, ADHS etc.). Es ist daher davon auszugehen, dass traumatisierte Kinder und Jugendliche bisher häufig nicht als solche erkannt und die Auswirkungen ihrer Erfahrungen auf ihre Entwicklung, Verhaltens- und Emotionsregulation diagnostisch nicht angemessen eingeordnet wurden.
Tab. 2: Diagnosekriterien für komplexe Traumafolgestörungen im Kindesalter (Developmental Trauma Disorder) nach Van der Kolk (2005), deutsche Version Landolt (2008)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Mittlerweile wurde die hier dargestellte Version erweitert und so ausdifferenziert, dass sie für die Einarbeitung in das DSM-V verwendet werden kann. Eine entsprechende Ausarbeitung der in Validität und Reliabilität überprüften Kriterien der Developmental Trauma Disorder wurde im Februar 2009 der American Psychiatric Association (APA) und anderen amerikanischen Fachgesellschaften vorgelegt (van der Kolk, Pynoos 2009). Sie beinhaltet Erweiterungen der hier beschriebenen Kriterien und genaue Vorgaben wie viele der genannten Items in jeder Gruppe vorliegen müssen, um die Diagnose einer Developmental Trauma Disorder zu rechtfertigen. Hinzu kommt, dass als zusätzliches Kriterium das Vorhandensein einzelner, jedoch nicht aller Symptome der PTSD verlangt wird. Außerdem wurde die Dauer der Störung mit mindestens sechs Monaten benannt.
Van der Kolk und Pynoos (2009) benennen drei Problemfelder bzgl. der bisherigen diagnostischen Erfassung von komplex traumatisierten Kindern und Jugendlichen: Erstens werde häufig keine Diagnose gestellt, da die betroffenen Kinder andere als die das Vollbild einer PTSD erfüllenden Symptome zeigen, wie z.B. bindungsbezogene Störungen, Verhaltens- und Lernprobleme (Pynoos et al 2008). Zweitens erfolgten häufig ungenaue diagnostische Zuordnungen aufgrund der Hauptsymptomatik (ADHS, Sozialverhaltensstörungen, bipolare Störung). Drittens erfüllten immer wieder auch Kinder und Jugendliche die diagnostischen Kriterien einer PTSD, was dann jedoch meist zu einer rein traumafokussierten Behandlung führt, die die anhaltenden Beeinträchtigungen im Entwicklungsverlauf, insbesondere der Affekt- und Verhaltensregulation sowie bindungsbezogene Schwierigkeiten außer acht lässt (Van der Kolk, Pynoos, 2009).
Häufiger als bei traumatisierten Kindern und Jugendlichen, die nicht die diagnostischen Kriterien einer DTD erfüllen, lagen bei den von dieser Störung betroffenen Jugendlichen Substanzmissbrauch oder –abhängigkeit vor, die in diesem Zusammenhang als maladaptives Verhalten zur Selbstberuhigung gesehen wird (Van der Kolk, Pynoos 2009, Dorard et al 2008). Mit der Einführung des Konzepts der Developmental Trauma Disorder erhoffen sich die Autoren eine entsprechende Berücksichtigung der Entwicklungsaspekte und –folgen chronisch traumatisierter Kinder und Jugendlicher in der Diagnostik sowie eine entsprechende Anpassung von Behandlungskonzepten an die besonderen Bedürfnisse dieser Personengruppe.
1.9 Bisherige Forschungsergebnisse
1.9.1 Bindung und Sucht
Verschiedene Studien, die sich in der Vergangenheit mit den Zusammenhängen von Bindung und Suchterkrankungen befasst haben, wurden überwiegend mit erwachsenen Probanden durchgeführt. Die Zunahme von Suchtmittelmissbrauch und –abhängigkeit im Jugendalter, bedingt durch den immer früher einsetzenden Konsum von legalen und illegalen Substanzen, ist ein Phänomen, das erst im letzten Jahrzehnt in den Fokus jugendpsychiatrischer Forschung getreten ist. Es liegen daher noch wenige Forschungsergebnisse vor.
In einer Studie von Fonagy et al (1996) wurden erwachsene psychiatrische Patienten mit dem AAI untersucht, von denen eine Untergruppe zusätzlich einen Substanzmissbrauch aufwies. Die Untersuchung wurde einmal mit der Kategorie unverarbeiteter/desorganisierter Bindungstyp und einmal unter Ausschluss derselben durchgeführt und führte entsprechend zu unterschiedlichen Ergebnissen: Bei Einschluss der Kategorie wurde ein großer Teil der Probanden dem desorganisierten Bindungstyp zugeordnet (28 von 37), während im Design, das diesen nicht berücksichtigte, der unsicher-präokkupierte Typ dominierte. Unklar in dieser Studie ist jedoch Art und Ausmaß des Suchtmittelkonsums im Verhältnis zur psychiatrischen Hauptdiagnose, da dieser nicht systematisch erfasst wurde.
Caspers et al (2006) untersuchten nicht nur den Zusammenhang von Substanzmissbrauch und Bindungsstil mit dem AAI, sondern berücksichtigten auch denjenigen zwischen Bindungstyp und der Inanspruchnahme therapeutischer Angebote. Vor allem die Gruppe der Probanden mit unsicher-distanzierenden Bindungsrepräsentationen wies einen hohen Anteil an Substanzmissbrauch oder -abhängigkeit bei geringer Inanspruchnahme von Behandlungsangeboten auf. Die Autoren schließen daraus, dass im Behandlungsprozess die Bindungsrepräsentation eine besondere Beachtung finden sollte. Die Probanden, die hier im Rahmen einer umfassenden Adoptionsstudie untersucht wurden, wiesen zum Zeitpunkt dieser Erhebung allerdings ein Durchschnittsalter von 39 Jahren (24-66J.) auf. Auch wurde in der Auswertung nicht zwischen Substanzmissbrauch und –abhängigkeit unterschieden.
In einer australischen Fragebogenstudie (Thorberg u. Lyvers 2006) berichteten erwachsene Probanden, die sich in einem Suchtbehandlungsprogramm befanden, eine höhere Bindungsunsicherheit sowie größere Angst vor Nähe und Intimität als die Teilnehmer der Kontrollgruppe. Außerdem wurde bei ihnen eine niedrigere Selbstdifferenzierung (self-differentiation) festgestellt, wobei sich der Begriff der Selbstdifferenzierung auf ein Konzept von Bowen (1978) bezieht, das die Fähigkeit, sowohl Nähe zu anderen wie auch Autonomie zu leben, beschreibt. Menschen mit geringer Selbstdifferenzierung leiden nach Bowen häufiger an chronischer Angst, dysfunktionalem Stress und psychischen sowie somatischen Symptomen. Offen bleibt den Autoren zufolge in dieser Studie die Frage, ob unsichere Bindung, Angst vor Nähe und geringe Selbstdifferenzierung als Risikofaktor für eine Substanzstörung oder als Folge chronischen Substanzmissbrauchs zu sehen sind. Auch welche Rolle die Herkunft und familiäre Vorbelastung mit Sucht möglicherweise in diesem Zusammenhang spielt, empfehlen Thorberg und Lyvers weiter zu erforschen.
Eine Untersuchung erwachsener Alkoholabhängiger mit und ohne ADHS kam zu dem Ergebnis, dass unsichere Bindungsstile mit Alkoholismus assoziiert waren (Johann et al 2004). Während die Probanden der Subgruppe ohne ADHS häufiger dem unsicher-distanzierenden Typ (D) zugeordnet wurden, wiesen die Teilnehmer mit ADHS-Symptomatik häufiger einen unsicher-präokkupierten Bindungsstil (E) auf.
1.9.2 Transgenerationale Vermittlung von Bindung im klinischen Kontext
Transgenerationale Bindungsforschung gewinnt im Zusammenhang mit unterschiedlichen Störungsbildern zunehmend an Interesse.
In einer Studie von Ward et al (2001) wurden an Anorexie erkrankte Jugendliche (N=20) und einige ihrer Mütter (N=12) mit dem AAI untersucht. Es ergaben sich dabei aussagekräftige Ergebnisse: 95% der Töchter und 83% der Mütter wurden einem unsicheren Bindungstyp, in den meisten Fällen dem unsicher-distanzierenden zugeordnet. Bei den Müttern zeigte sich zudem häufig ein unverarbeiteter Verlust. Sowohl Mütter wie auch Töchter wiesen ein geringes Reflexionsvermögen, eine hohe Idealisierung und
Schwierigkeiten im emotionalen Ausdruck auf. Diese bindungsrelevanten Merkmale schienen sich von den Müttern auf die Töchter zu übertragen.
Cassibba und Mitarbeiter (Cassibba et al 2004) untersuchten 60 an Asthma leidende italienische Kinder im Alter von 2-5 Jahren und ihre Mütter und kamen zu dem Ergebnis, dass die erkrankten Kinder im Vergleich zu den gesunden der Kontrollgruppe häufiger einen unsicheren Bindungsstil aufwiesen. Auch ihre Mütter, bei denen das Adult Attachment Interview durchgeführt wurde, zeigten einen höheren Anteil unsicherer Bindungsrepräsentationen als die Vergleichsgruppe. Auffällig dabei war, dass die Weitergabe des Bindungstyps offenbar nicht mit dem präklinischen Zustand der Kinder zusammenhing. Die Autoren schlossen daraus eine genetische und soziale transgenerationale Vermittlung unsicherer Bindungsstile in von Asthma betroffenen Familien.
Wie die Studie von Cassibba et al untersuchen zahlreiche andere Arbeiten die transgenerationale Vermittlung von Bindungsstilen an Müttern und Kleinkindern. So untersuchten z.B. Schleiffer und Müller (2002) im Rahmen ihrer umfangreichen Forschungsarbeit zu Bindungsrepräsentationen von Jugendlichen in Heimerziehung eine Subgruppe jugendlicher Mütter und ihrer Kinder mit dem AAI und der Fremden Situation. Hier zeigte sich überwiegend eine Weitergabe unsicherer und hochunsicherer Bindungsstile.
Studien zu Bindungsrepräsentationen von Eltern und ihren jugendlichen oder adoleszenten Kindern sind dagegen seltener zu finden (z.B. Kanemasa 2007 an einer nicht klinischen Gruppe).
Zwar nicht mit transgenerationaler Weitergabe im engeren Sinne, jedoch mit den Auswirkungen der therapeutischen Beziehung auf Bindungsstile befasst sich eine prospektive Studie (Zegers et al 2006). Dabei wurden 88 Jugendliche und 33 professionelle Bezugspersonen einer Therapieeinrichtung für Jugendliche mit dem AAI untersucht. Es stellte sich heraus, dass nach einer dreimonatigen Behandlungszeit keine Veränderungen der Bindungsrepräsentationen der Jugendlichen erkennbar waren. Bei denjenigen Jugendlichen, die jedoch länger in der Einrichtung verblieben, wurde zunehmend deutlich, dass sie ihre Mentoren als sichere Basis nutzten und ihr Kontakt vermeidendes Verhalten
abnahm, sie also immer mehr Bindungssicherheit entwickelten. Bindungssichere Mentoren wurden dabei zunehmend als für die Jugendlichen erreichbar wahrgenommen. Darüber hinaus zeigten unterschiedliche Konstellationen der Bindungsrepräsentationen von Mentoren und Jugendlichen unterschiedliche Auswirkungen.
1.9.3 Transgenerationale Vermittlung von Bindung und Sucht
Viele Forschungsarbeiten befassen sich inzwischen mit den Auswirkungen elterlicher Substanzabhängigkeit auf die Kinder (Steinhausen et al 2006, Suchman, Luthar 2000, Klein 2003 und 2009). Nur ein Teil davon geht jedoch auf den Aspekt der Bindung ein (Suchman et al 2006, Kuendig, Kuntsche 2006, Kelley et al 2005, Trost et al 2004). Von diesen Studien wurden wiederum nur wenige mit einem spezialisierten und operationalisierten Instrument zur Erfassung von Bindungsrepräsentationen durchgeführt.
In bisherigen transgenerationalen Studien, die sich mit dem Thema Bindung und Sucht befassten, geschah dies meist mit dem Fokus auf Drogen oder Alkohol konsumierende Eltern(teile) und zielte darauf ab, die Auswirkungen auf ihre Kinder zu erfassen.
Suchman et al (2006) untersuchten das Erziehungsverhalten Drogen konsumierender Mütter und fanden heraus, dass dies stark von den inneren Repräsentationen ihrer eigenen Bindungserfahrungen abhängt. Allerdings bedient sich die Studie verschiedener Fragebögen und Messskalen (z.B. Parental Bonding Instrument), die keine ähnlich differenzierte Erfassung der Bindungsrepräsentationen ermöglichen wie das AAI.
Im deutschsprachigen Bereich führten Trost et al (2004) eine sehr umfangreiche und aussagekräftige Forschungsarbeit mit verschiedenen diagnostischen Verfahren zu drogenabhängigen Müttern und ihren Babys durch und fanden heraus, dass betroffene Mütter weniger Kohärenz im Bindungsverhalten zeigten, weniger Freude am Kind, dafür mehr Schuldgefühle und Ängste ausdrückten als andere Mütter. Gleichzeitig wurden die Kinder häufig als Chance zur Veränderung gesehen, was gleichermaßen Hoffnung vermittelte wie auch Risiken barg.
Kündig und Kuntsche (2006) untersuchten in der Schweiz Jugendliche mit exzessiv trinkenden Eltern(teilen) und fanden heraus, dass in diesen Familien die Intensität der familiären Bindung (bonding) negativ mit der Häufigkeit des Alkoholkonsums der Kinder korrelierte. Hier ist jedoch mehr der Aspekt der Zuwendung und des Zusammenhalts gemeint (z.B. gemeinsam verbrachte Zeit, Zuhören etc.) als Bindung (attachment) im Sinne von inneren Repräsentationen und Bindungstypen.
Was jugendlichen Substanzkonsum angeht, so liegen v.a. Studien vor, die diesen im Zusammenhang mit Familienstruktur (McArdle et al 2002; Barrett, Turner 2006; Ledoux et al 2002) und Sozialisationserfahrungen (Hellandsjobu et al 2002) betrachten, nicht aber mit Bindung im engeren Sinne.
McArdle et al (2002) kamen in ihrer europäischen Studie zu Familienstruktur und jugendlichem Substanzgebrauch zu dem Ergebnis, dass weniger das Zusammenleben mit beiden Elternteilen als vielmehr qualitative Aspekte, v.a. die Qualität der Bindung zur Mutter dabei eine bedeutende Rolle spielten. Barrett und Turner (2006) stellten einen signifikant höheren problematischen Substanzgebrauch bei Kindern alleinerziehender Eltern fest. Ledoux et al (2002), die französische und britische Teenager aus sog. nicht-intakten Familien untersuchten, betonen ebenfalls die Beziehungs qualität: Diejenigen Jugendlichen, die mit der Beziehung zu Mutter oder Vater unzufrieden waren und diejenigen, die weniger beaufsichtigt waren, erwiesen sich als gefährdeter bzgl. eines schädlichen Substanzgebrauchs.
Es liegen nur wenige Studien vor, die Suchtmittel konsumierende Jugendliche und junge Erwachsene mit Instrumenten der Bindungsforschung erfassen.
Rosenstein und Horowitz (1996) untersuchten die Bindungsstile jugendlicher psychiatrischer Patienten, die zusätzlich einen Substanzmissbrauch undefinierten Ausmaßes aufwiesen und diejenigen ihrer Mütter mit dem AAI. Sie fanden eine hohe Übereinstimmung zwischen Müttern und Jugendlichen (81%). Wie in der o.e. Studie von Fonagy et al (1996, s. Kap. 1.5.1) wurde auch hier die Zuordnung einmal in drei Kategorien und ein weiteres Mal in vier Kategorien (mit desorganisierter Kategorie) analysiert. Es zeigte sich ein deutlicher Zusammenhang zwischen Verhaltensstörungen und abweisendem Bindungsstil sowie affektiven Störungen und präokkupiertem Bindungsstil. Die Kombination in Form einer Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen (ICD10: F92.0 - F92.8) war häufiger mit unsicher-distanzierenden Bindungsrepräsentationen verbunden. In der Subgruppe mit Substanzmissbrauch trat der unsicher-distanzierende Bindungsstil zweimal so häufig auf wie in der Restgruppe. Vor allem bei komorbidem Auftreten von Substanzstörung und Verhaltensstörung war dieser vorherrschend.
Insgesamt erwies sich Substanzmissbrauch jedoch als weniger starker Prädiktor für den unsicher-distanzierenden Bindungsstil als eine Verhaltensstörung. Über das Vorkommen der hochunsicheren Bindungsrepräsentationen (U und CC) bei Jugendlichen mit Substanzgebrauch werden keine Ergebnisse dargestellt. Die Ergebnisse der Jugendlichen-Mütter-Dyaden sind nicht nach Diagnosen aufgeschlüsselt.
Schindler (2001, 2005) untersuchte erstmals im deutschsprachigen Raum den Zusammenhang von Suchtmittelkonsum und Bindung in einer transgenerationalen Studie. Diese führte er mit 71 Opiate konsumierenden Jugendlichen und jungen Erwachsenen durch, die mit ihren Angehörigen ambulant familientherapeutisch behandelt wurden. Er verwendete in seiner Studie Verfahren wie z.B. das Attachment Interview Coding System von Bartholomew und Horowitz (1991), die Familienanamnese nach Cierpka (2003) und die Einschätzung anhand der Operationalisierten Psychologischen Diagnostik (Arbeitskreis OPD 1996).
Schindler (2005) sieht Suchtmittelkonsum als Bewältigungsversuch im Umgang mit erfahrener Zurückweisung und der Angst vor erneuter Zurückweisung. „Mit zunehmender Abhängigkeit wird das Suchtmittel wichtiger als jede zwischenmenschliche Beziehung“ (Schindler 2005, S.97). Es verhindere die Aufnahme neuer, potenziell positiver Beziehungen und verfestige damit vorbestehende Bindungsunsicherheit. Suchtmittelabhängige Menschen deaktivieren laut Schindler ihr Bindungssystem mithilfe des Suchtmittels. Er betont in diesem Zusammenhang die besondere Wirksamkeit von Opiaten. Schindler berücksichtigte zwar in weiteren Studien wichtige Aspekte der Suchtforschung, z.B. durch Einsatz des Addiction Severity Index (Gsellhofer et al 1993), jedoch aus einem Blickwinkel der Erwachsenenpsychiatrie, der weder entwicklungspsychologische noch epidemiologische Faktoren (z.B. typische Konsummuster) der jugendlichen Altersgruppe berücksichtigt.
Ausgehend von den vier Bindungsstilen nach Bartholomew und Horowitz, die neben dem sicheren und dem anklammernden (präokkupierten) einen ängstlich-vermeidenden von einem abweisenden (ablehnenden, vermeidenden) Bindungsstil unterscheiden, kam Schindler zu dem Ergebnis, dass drogenabhängige Menschen überwiegend einen ängstlich-vermeidenden Bindungsstil aufwiesen, dessen Ausprägung signifikant mit der Schwere der Drogenabhängigkeit korrelierte (Schindler 2005). Darüber hinaus beschreibt er typische Familienkonstellationen mit anklammernder Mutter und abweisendem Vater, die er bei zwei Dritteln der untersuchten Familien vorfand. Im restlichen Drittel fanden sich dagegen Konstellationen, bei denen entweder ein großer Unterschied in der Bindungssicherheit von
Vater und Mutter oder eine sehr hohe Bindungsunsicherheit aller Familienmitglieder erkennbar waren.
1.10 Fragestellung
Die vorliegende Studie zielt darauf ab, den Zusammenhang von Bindungsvorerfahrungen und den daraus resultierenden internen Bindungsrepräsentationen bei Drogen konsumierenden Jugendlichen und die transgenerationale Vermittlung von Bindungsqualität durch ihre Eltern zu erfassen. Interessant ist dabei die Frage inwieweit Bindungsrepräsentationen von Eltern(teilen) weitergegeben werden. Auch soll der Frage nachgegangen werden, ob und in welchem Ausmaß Bindungsrepräsentationen mit Persönlichkeitsfaktoren der Jugendlichen und bindungsrelevanten Lebensereignissen assoziiert sind. Die Ergebnisse sollen ausgewertet und diskutiert werden mit dem Ziel, Aufschluss darüber zu gewinnen, welche Bedeutung und Funktion dem Suchtmittelkonsum im Zusammenhang mit den beschriebenen Lebensereignissen zukommt.
Da von einer Beeinflussbarkeit von Bindungsrepräsentationen durch korrigierende positive Bindungserfahrungen und therapeutische Prozesse ausgegangen wird, werden von der Untersuchung derselben Hinweise für die Weiterentwicklung von Behandlungsansätzen und therapeutischen Umgangsformen erwartet.
Bisherige Studien haben die komplexen Zusammenhänge von Sucht, komorbider psychischer Störung und Bindungsrepräsentationen bei Jugendlichen noch nicht systematisch untersucht. Aus diesem Grund ist eine überwiegend qualitative Herangehensweise geeignet, um die hierfür relevanten biographischen Zusammenhänge zu erfassen und darzustellen. Auch die Frage, welchen Einfluss die Suchterkrankung und welchen die komorbide psychische Störung und traumatisierende Lebensereignisse auf die Bindungsentwicklung nehmen, ist noch nicht ausreichend beantwortet. Die überwiegend qualitative Annäherung an das Thema über die Analyse der Lebensgeschichte der befragten Jugendlichen und ihrer Eltern(teile) ermöglicht es, Informationen über das Ausmaß von Beeinträchtigung und Ressourcen sowie deren biographischen Ursachen zu gewinnen. Die Ergebnisse sollen Aufschluss über die Entstehungszusammenhänge der sich häufig in der Komorbidität der Jugendlichen ausdrückenden eingeschränkten Fähigkeiten zur Impulskontrolle, Verhaltens- und Emotionsregulation geben und zeigen, inwieweit diese möglicherweise mit belastenden oder traumatisierenden Entwicklungsbedingungen in Zusammenhang stehen. Insofern ist die vorliegende Untersuchung vor allem als neue Fragestellungen und Hypothesen generierende Grundlagenstudie zu sehen.
1.11 Hypothesen
1. Bei suchtmittelabhängigen Jugendlichen sind mehrheitlich unsichere oder hochunsichere Bindungsmuster vorzufinden. Mit sicheren Bindungsmustern ist bei der untersuchten Personengruppe nicht oder äußerst selten zu rechnen.
2. Da hochunsichere Bindung überwiegend in klinischen Gruppen anzutreffen ist, ist in der Probandengruppe, die eine hohe Komorbidität von Sucht und anderen jugendpsychiatrischen Erkrankungen aufweist, mit einem überdurchschnittlich häufigen Auftreten zu rechnen.
3. Bei den unsicher gebundenen Jugendlichen der Probandengruppe ist entsprechend der wenigen vorliegenden Ergebnisse eher mit unsicher-distanzierenden Bindungsmustern zu rechnen. Diese scheinen häufiger als andere mit Substanzkonsum in Verbindung zu stehen.
4. Es ist mit unsicheren und hochunsicheren Bindungsrepräsentationen auch bei den primären Bezugspersonen zu rechnen.
5. Bestimmte bindungsrelevante Lebensthemen wie Verlust, Trennung, Krankheit, Veränderung des Beziehungsumfelds durch Umzüge, Schulwechsel, Änderung der Familienzusammensetzung, aber auch traumatisierende Entwicklungskontexte, d.h. eine Kumulation potenziell traumatischer Erfahrungen treten bei den Probanden gehäuft auf.
2. Material und Methodik
2.1 Ethikkommission
Vor Beginn der Untersuchung wurde ein Antrag auf Genehmigung des Forschungsvorhabens bei der Ethikkommission der Universität Ulm gestellt. Hierin wurden Ziel, Methodik und voraussichtlicher Ablauf der Studie dargestellt und insbesondere die Notwendigkeit der wissenschaftlichen Untersuchung am Menschen begründet. Die Ethikkommission erteilte am 07.02.2006 ein positives Votum.
Die am 28.03.2007 eingereichte Abänderung des ursprünglich geplanten Designs, wurde am 03.04.2007 zustimmend bewertet, so dass der geplante Vergleich mit einer nicht-klinischen Kontrollgruppe wegfällt. Aufgrund der zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Daten schien eine qualitative biographische Auswertung zielführender und somit das Heranziehen weiterer Probanden erlässlich.
2.2 Probanden
Bei den untersuchten jugendlichen Probanden handelt es sich um Patienten der oben beschriebenen Jugend-Drogenentzugsstation clean.kick. Die Station ist der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie/-psychotherapie der Südwürttembergischen Zentren für Psychiatrie zugeordnet.
Die Jugendlichen waren zum Zeitpunkt der Durchführung der Interviews alle in stationärer Entzugsbehandlung, die Interviews mit den Elternteilen wurden bis auf eine Ausnahme ebenfalls auf der Behandlungsstation durchgeführt. Eine Mutter wurde im Zeitraum zwischen zwei stationären Behandlungsabschnitten ihres Sohnes zuhause aufgesucht.
In die Erhebung eingeschlossen wurden Jugendliche mit einer Diagnose aus dem Spektrum der Substanzabhängigkeit (ICD10: F10.2-F19.2) im Alter von 16-18 Jahren (16;1 - 18;1J), bei denen nach klinischem Eindruck ein Intelligenzquotient von >85 vorhanden und somit von einer ausreichenden Verbalisations- und Reflektionsfähigkeit auszugehen war[20]. Da die Station niederschwellig aufnimmt, das heißt auch Jugendliche mit den Diagnosen F1x.1 in Sinne einer Frühintervention behandelt, wurden für diese Untersuchung die besonders schwer erkrankten Jugendlichen selektiert.
Ausgeschlossen wurden Jugendliche mit Migrations- und/oder Adoptionshintergrund, da bei diesen von anderen Voraussetzungen hinsichtlich der Bindungsentwicklung auszugehen ist. Im Jahr 2006 betrug der Anteil der Jugendlichen mit der Muttersprache Deutsch 85% (BADO 2006), wobei bei einer weit größeren Anzahl von einem Migrationshintergrund mindestens eines Elternteils auszugehen ist. 2,4% der Jugendlichen lebten in einer Adoptivfamilie (BADO 2006).
Auch akut psychotische Jugendliche wurden nicht in die Untersuchung einbezogen, da zum einen das Verfahren beim Vorhandensein von Denkstörungen nicht durchführbar ist, zum anderen die betroffenen Jugendlichen nicht durch das sehr lange Interview belastet werden sollten. Drogeninduzierte und schizophrene Psychosen (ICD10: F1x.5 bzw. F20) kamen bei 4,8% der im Jahr 2006 behandelten Jugendlichen vor (BADO 2006).
Sofern diese verfügbar und dazu bereit waren, wurde auch mit den Eltern der beteiligten Jugendlichen ein AAI durchgeführt. Bis auf eine Ausnahme, bei der beide Elternteile interviewt werden konnten, standen jeweils nur die Mütter zur Verfügung[21]. Die Probanden lebten überwiegend bei einem leiblichen Elternteil (s. 3.1.1). Dies entspricht den Ergebnissen von Haffner et al (2006), die feststellten, dass Jugendliche die nicht bei beiden Elternteilen leben, häufiger von Substanzabhängigkeit betroffen sind (Haffner et al 2006) sowie den Ergebnissen unserer eigenen Evaluation (Bernhardt 2004, Fetzer 2008, BADO 2006, siehe S. 9).
[...]
[1] Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit die maskuline Form verwendet, auch wenn ausdrücklich auf beide Geschlechter Bezug genommen wird.
[2] Seit 2009: ZfP Südwürttemberg
[3] Die Eröffnung einer zweiten Station nach demselben niederschwelligen Konzept ist in Nordwürttemberg am Zentrum für Psychiatrie Weinsberg für Herbst 2009 geplant.
[4] Bei 18-20jährigen Adoleszenten erfolgt eine vorherige ambulante Abklärung zur Einschätzung, ob die Behandlung in jugendspezifischem Rahmen noch gerechtfertigt ist, was aufgrund meist noch nicht bewältigter alterangemessener Entwicklungsschritte häufig der Fall ist.
[5] Stierlin (Stierlin et al 1980) prägte den in der systemischen Familientherapie verwendeten Begriff der bezogenen Individuation. Er beschreibt die Fähigkeit sich abzugrenzen, eigene Ziele und Ideale zu verfolgen und gleichzeitig Teil eines familiären Gefüges und in Beziehung zur Herkunftsfamilie zu bleiben.
[6] Die Folgen davon – junge Erwachsene mit ähnlichen Konsummustern – machen sich in den letzten Jahren zunehmend in der Suchtbehandlung Erwachsener bemerkbar. Um ihren besonderen Bedürfnissen gerecht zu werden, wurden die Konzepte ambulanter und stationärer Beratung und Behandlung entsprechend erweitert und angepasst.
[7] Hier wurden nur die Diagnose F10.2 (Alkholabhängigkeit) berücksichtigt, nicht die Diagnose F19.2 (Abhängigkeit von multiplen Substanzen).
[8] Siehe Fußnote Seite 10.
[9] Delegationen beschreiben bewusste oder unbewusste Aufträge, die oft generationenübergreifend weitergegeben werden. Sie können sowohl von eng gebundenen wie auch von ausgestoßenen Familienmitgliedern erfüllt werden. Schädlich für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sind sie dann, wenn sie die Fähigkeiten übersteigen und somit überfordern oder wenn verschiedene sich widersprechende Aufträge bestehen (Stierlin 1978).
[10] Als besondere Form der Delegation beschreibt die Parentifizierung eine Rollenumkehr, in der Kinder für ihre Eltern die Funktion eines Partners oder Elternteils übernehmen (Boszormenyi-Nagy, Spark 1998).
[11] Kursivschrift auch im Original
[12] Klammer von der Verfasserin ergänzt
[13] Während die meisten Autoren von einer Aktivierung des Bindungssystems ausgehen, spricht Fonagy in diesem Zusammenhang, vom Furchtsystem als drittem regulierendem Verhaltenssystem, das zur angemessenen Regulation zwischen Bindungs- und Explorationsverhalten beiträgt, was aufgrund der physiologischen Erregung schlüssig ist (Fonagy 2006).
[14] Zu unterscheiden ist hier die Einschränkung der Selbstregulation durch akute Substanzeinwirkung, die je nach Substanz unterschiedlich sein kann, von einer durchgängigen Beeinträchtigung, die in möglichem Zusammenhang mit unsicherer oder hochunsicherer Bindung steht.
[15] Auf die Begrifflichkeiten hochunsichere Bindung versus Bindungsstörung wird in 1.5.3 eingegangen
[16] Hier wird erneut die Analogie zu Risiko- und Schutzfaktoren für jugendlichen Suchtmittelkonsum deutlich.
[17] Die „Fremde Situation“ ist ein von Ainsworth (Ainsworth, Bell 1970) entwickeltes strukturiertes Beobachtungsverfahren, das bei Kindern im Alter von ca. 12 Monaten angewandt wird, um deren Bindungsmuster zu erfassen.
[18] Anführungszeichen im Originaltext
[19] Van der Kolk gehört dem National Child Traumatic Stress Network an, das u.a. mit der Entwicklung und Evaluation der Diagnosekriterien der komplexen kindlichen Traumafolgestörungen für das DSM V beschäftigt ist.
[20] 82% der behandelten Jugendlichen in 2006: IQ>85 (nach Testung od. klinischem Eindruck)
[21] Ein interviewter Vater musste aus der Auswertung ausgeschlossen werden, da sich herausstellte, dass er, bei dem der Sohn jetzt lebte, anders als seine geschiedene Frau in den frühen Kindheitsjahren weniger Kontakt zu ihm hatte, obwohl er jetzt die Hauptbezugsperson darstellte.
Häufig gestellte Fragen
Wie hängen Bindungsmuster und Sucht bei Jugendlichen zusammen?
Ein hoher Anteil suchtmittelabhängiger Jugendlicher weist hochunsichere Bindungsmuster auf, die oft durch traumatische Entwicklungskontexte und Vernachlässigung geprägt sind.
Was bedeutet „transgenerationale Weitergabe“ von Bindungserfahrungen?
Es beschreibt den Prozess, bei dem unsichere Bindungsrepräsentationen der Eltern (insbesondere der Mütter) an die Kinder weitergegeben werden, was das Risiko für Sucht und psychische Störungen erhöht.
Welche Faktoren wirken schützend (protektiv) gegen unsichere Bindung?
Kontinuierliche Bezugspersonen außerhalb der Kernfamilie, stabile Partnerschaften der Mütter sowie psychotherapeutische Behandlungen können die Weitergabe verhindern.
Was ist der ACE-Score?
Der ACE-Score (Adverse Childhood Experiences) misst belastende Kindheitserfahrungen, die in der Studie als wesentlicher Faktor für Suchtentwicklung identifiziert wurden.
Welche klinische Relevanz haben die Ergebnisse für die Suchttherapie?
Sie geben Hinweise darauf, dass Behandlungssettings Bindungsaspekte stärker berücksichtigen und Bezugspersonenarbeit sowie pädagogische Interventionen integrieren müssen.
- Quote paper
- Dr. Ulrike Amann (Author), 2009, Bindungsrepräsentationen suchtmittelabhängiger Jugendlicher und ihrer Eltern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/135249