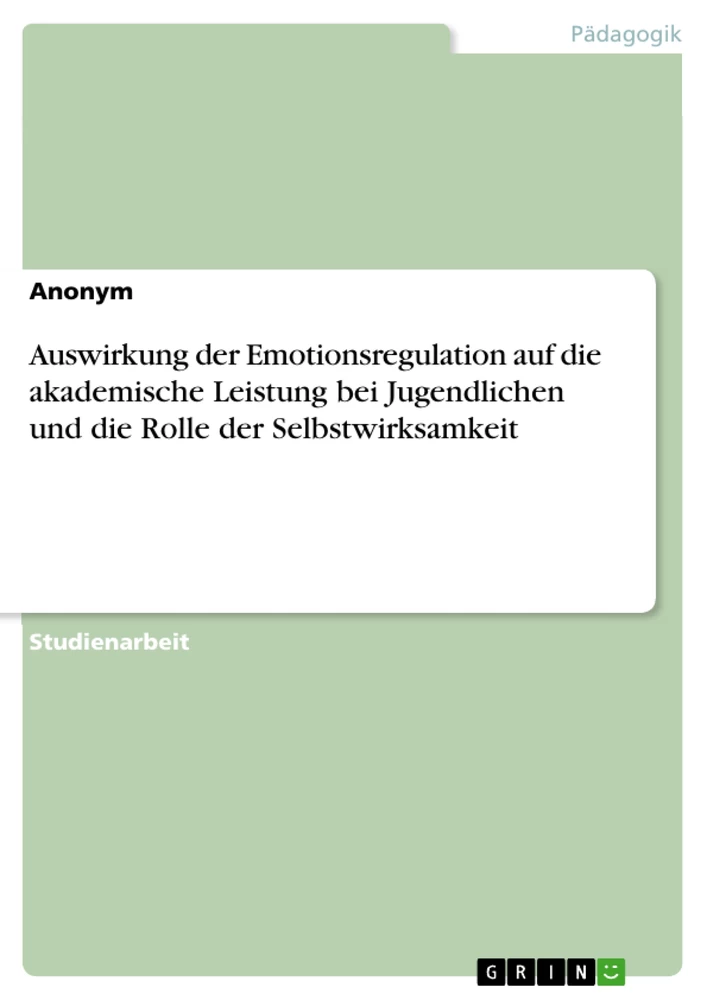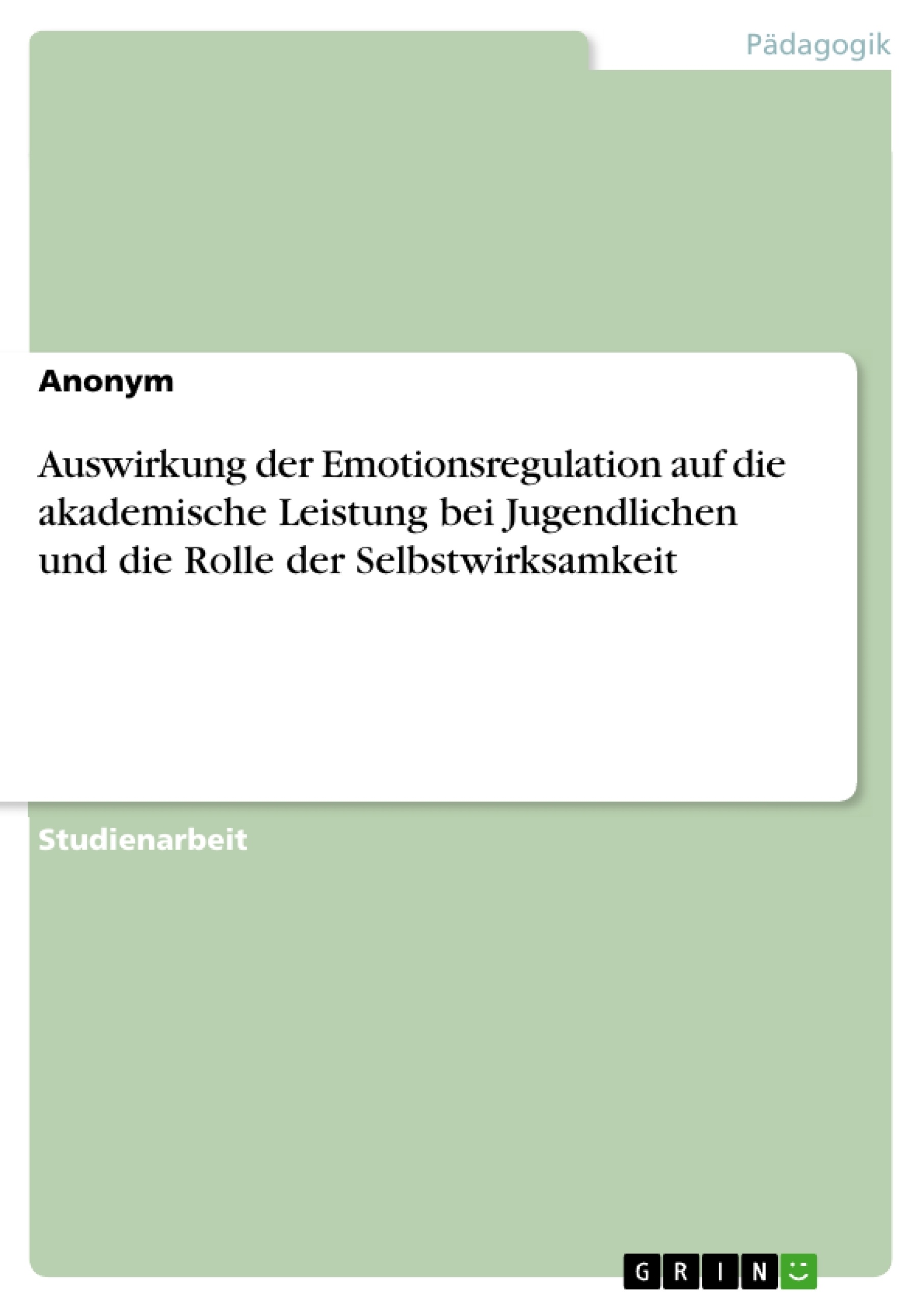Wie wirken sich Emotionsregulationsstrategien insgesamt auf die akademische Leistung bei Jugendlichen aus und welche Rolle spielt dabei das Konzept der Selbstwirksamkeit? Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, diesen Fragen nachzugehen, indem der Prozess der Emotionsregulation aufgezeigt und das Konstrukt „Selbstwirksamkeit“ beschrieben wird. Schließlich werden zwei Untersuchungen zu deren Effekten auf die akademische Leistung bei Jugendlichen veranschaulicht und miteinander verglichen.
Kinder und Jugendliche empfinden ihren Schulalltag in den letzten Jahren als zunehmend belastend. Zur Untersuchung der psychischen Belastung durch den Schulalltag für Kinder und Jugendliche in Deutschland liegen eine große Anzahl an Untersuchungen wie etwa die “Health Behaviour in School-aged Children 2017/18“ vor. Es handelt sich hierbei um eine im Auftrag der World Health Organization (WHO) durchgeführte Erhebung, in der 25 Prozent der befragten Kinder und Jugendlichen angegeben hatten, sich „einigermaßen stark“ oder „sehr stark“ durch die schulischen Anforderungen belastet zu fühlen. Die effektive Bewältigung dieser Anforderungen stärkt das eigene Gefühl, akademischen Herausforderungen gewachsen zu sein, steigert das eigene Selbstwirksamkeitsgefühl und erhöht die Wahrscheinlichkeit für die Erbringung akademischer Leistungen, was wiederum beim Eintritt ins Erwachsenenleben mit gelungener Integration auf dem Arbeitsmarkt in Form einer Berufsausbildung oder eines Hochschulstudiums einhergehen kann.
Neben Ursachen wie beispielsweise sozioökonomischer Status, Geschlecht oder Migrationshintergrund liefern vielfältige wissenschaftliche Untersuchungen Hinweise für das Vorliegen eines Zusammenhangs zwischen schulischer Leistung und der Emotionsregulation bei Heranwachsenden.
In früheren Jahren konnte bereits gezeigt werden, dass Lernvorgänge und Emotionen miteinander konnotiert sind, so wiesen etwa Reinhard Pekrun, Stephanie Lichtenfeld, Herbert W. Marsh, Kou Murayama und Thomas Goetz in ihrer wissenschaftlichen Arbeit einen Zusammenhang zwischen Emotionen und der Lernleistung bei Schüler*innen nach.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretische Grundlagen
- 2.1 Emotion
- 2.2 Emotionsregulation
- 2.3 Gross und Thompson's Prozessmodell der Emotionsregulation (2007)
- 2.4 Selbstwirksamkeitsüberzeugung und akademische Leistung
- 3 Emotion, Emotionsregulation und Lernen
- 3.1 Studie „Investigating the relationship between emotion regulation strategies and self-efficacy beliefs among adolescents: Implications for academic achievement“ (2021)
- 3.2 Studie „Emotional Regulation and Academic Performance in the Academic Context: The Mediating Role of Self-Efficacy in Secondary Education Students“ (2021)
- 4 Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Bedeutung von Emotionsregulation und Selbstwirksamkeit für die akademische Leistung von Jugendlichen. Die zentrale Frage ist, wie Emotionsregulationsstrategien die akademische Leistung beeinflussen und welche Rolle Selbstwirksamkeit dabei spielt. Dabei werden zwei Studien vorgestellt, die die Beziehung zwischen Emotionsregulation, Selbstwirksamkeit und akademischer Leistung untersuchen.
- Der Einfluss von Emotionsregulationsstrategien auf die akademische Leistung von Jugendlichen
- Die Rolle von Selbstwirksamkeit bei der Bewältigung akademischer Herausforderungen
- Die Untersuchung der Beziehung zwischen Emotionsregulation, Selbstwirksamkeit und akademischer Leistung in zwei aktuellen Studien
- Die Relevanz von Emotionsregulation und Selbstwirksamkeit im Bildungskontext
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung
In diesem Kapitel wird der aktuelle Forschungsstand zu den Herausforderungen und Belastungen im Schulalltag von Kindern und Jugendlichen in Deutschland beleuchtet. Es wird auf die Bedeutung der Bewältigung dieser Anforderungen für die akademische Leistung, die Entwicklung des Selbstwirksamkeitsgefühls und die Integration in das Berufsleben hingewiesen. Der Zusammenhang zwischen Emotionsregulation und schulischer Leistung wird hervorgehoben und die Forschungsfrage nach dem Einfluss von Emotionsregulationsstrategien auf die akademische Leistung bei Jugendlichen und der Rolle von Selbstwirksamkeit wird formuliert.
2 Theoretische Grundlagen
Dieses Kapitel erläutert grundlegende Begriffe und Modelle, die für die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Emotionsregulation, Selbstwirksamkeit und akademischer Leistung relevant sind. Es werden die Definitionen von Emotionen und Emotionsregulation sowie die Rolle der Selbstwirksamkeitsüberzeugung im Hinblick auf die Erbringung akademischer Leistungen dargestellt.
3 Emotion, Emotionsregulation und Lernen
Dieses Kapitel beleuchtet zwei aktuelle Studien, die die Beziehung zwischen Emotionsregulation, Selbstwirksamkeit und akademischer Leistung untersuchen. Es werden die Studiendesigns, die methodischen Vorgehensweisen und die wichtigsten Ergebnisse der beiden Studien beschrieben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen Emotionsregulation, Selbstwirksamkeit und akademische Leistung im Kontext der Bildung. Die Analyse von Studien beleuchtet die Beziehung zwischen diesen drei Aspekten und zeigt die Bedeutung von Emotionsregulationsstrategien für die Bewältigung akademischer Herausforderungen und die Entwicklung von Selbstwirksamkeit bei Jugendlichen. Die Forschungsergebnisse liefern wichtige Erkenntnisse für das Verständnis von Lernprozessen und den Umgang mit emotionalen Belastungen im Schulalltag.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst Emotionsregulation die schulische Leistung?
Effektive Emotionsregulationsstrategien helfen Jugendlichen, mit Schulstress umzugehen, was wiederum die akademische Leistungsfähigkeit positiv beeinflussen kann.
Welche Rolle spielt die Selbstwirksamkeit beim Lernen?
Selbstwirksamkeit – der Glaube an die eigenen Fähigkeiten – stärkt die Bereitschaft, akademische Herausforderungen anzunehmen und beharrlich Ziele zu verfolgen.
Fühlen sich Kinder heute durch die Schule stärker belastet?
Laut WHO-Studien fühlen sich etwa 25 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland stark durch schulische Anforderungen belastet.
Was besagt das Prozessmodell der Emotionsregulation von Gross?
Das Modell beschreibt verschiedene Zeitpunkte, an denen Emotionen reguliert werden können, von der Situationsauswahl bis zur Modifikation der emotionalen Reaktion.
Warum ist Emotionsregulation für den Arbeitsmarkt wichtig?
Gute Leistungen in der Schule, gefördert durch emotionale Kompetenz, erleichtern den Übergang in Berufsausbildung oder Studium und somit die Integration in den Arbeitsmarkt.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2023, Auswirkung der Emotionsregulation auf die akademische Leistung bei Jugendlichen und die Rolle der Selbstwirksamkeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1353321