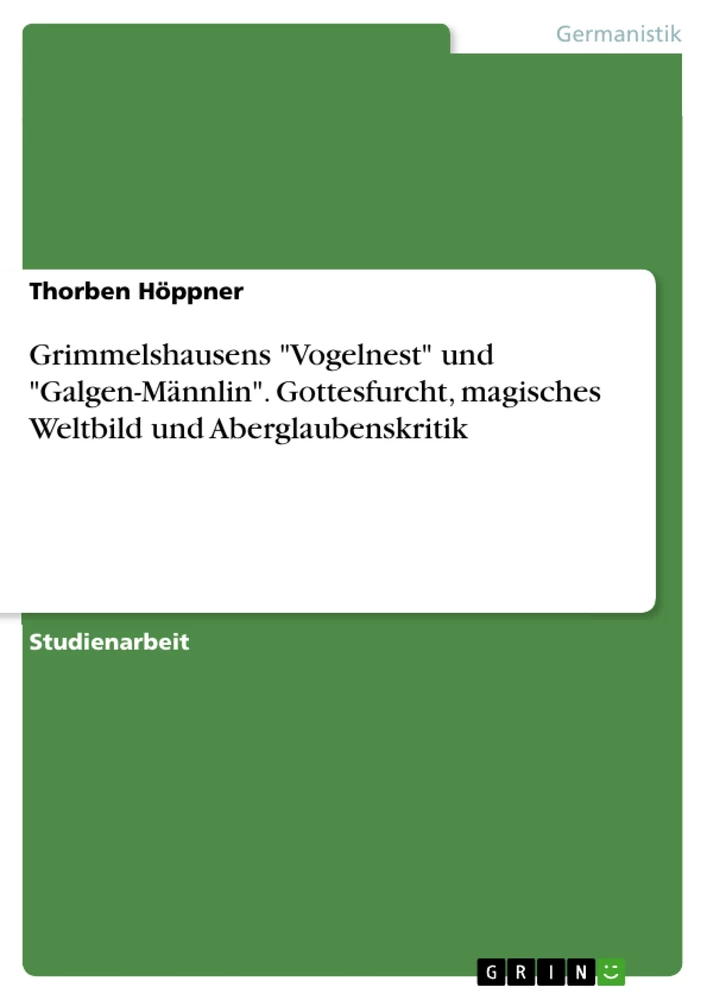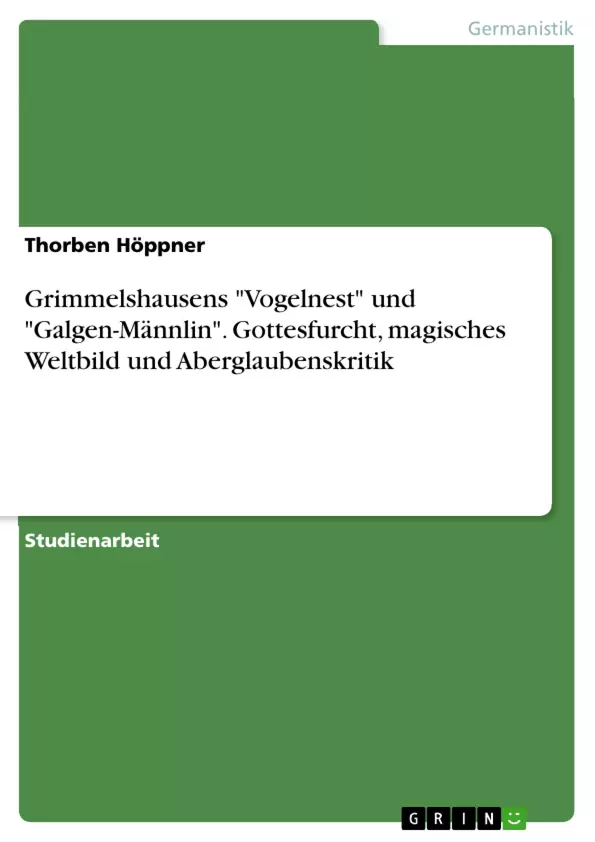Eine trennscharfe Unterscheidung zwischen Glauben und Aberglauben, zwischen Religion und Volksmagie, ist in der Frühen Neuzeit nicht ganz einfach. Auch der literarische Umgang mit dem Spannungsfeld zwischen Glauben und Aberglauben im ersten Teil von Grimmelshausens Vogelnest bedarf noch einer genaueren Untersuchung. Es ergeben sich die Fragen, ob und inwiefern der Text hier letztlich eine trennscharfe Unterscheidung anbieten kann und inwiefern dieses Spannungsfeld zwischen Glauben und Aberglauben womöglich auch für die satirischen und lehrhaften (Bekehrungs-)Zwecke des Romans instrumentalisiert wird. Diesem Diskurs über Glauben und Aberglauben mitsamt dem darin enthaltenen definitorischen ‚Vakuum‘ soll diese Arbeit nachgehen. Dazu soll der Glaubens-Aberglaubens-Diskurs zunächst historisch-kulturell kontextualisiert werden, bevor dieser im ersten Teil von Grimmelshausens Vogelnest einer näheren Analyse unterzogen wird. Schließlich wird diese Arbeit ein besonderes Augenmerk auf Grimmelshausens Aberglaubenskritik legen und zu diesem Zweck auch einen knappen Blick in den zweiten Teil des Vogelnest-Romans sowie in Grimmelshausens "Galgen-Männlin" werfen.
Der fiktive Erzähler und Besitzer des Vogelnests macht im ersten Teil von Grimmelshausens Schelmenroman "Das Wunderbarliche Vogelnest" keinen Hehl daraus, dass er seiner Leserschaft etwas "beybringen" möchte; dass es ihm lieb sei, wenn der Leser "demselben was ich ihn hierinn zu lehren bedacht / nachzukommen sich befleist". Was das für Lehren sind, liegt dabei auf der Hand: In einem satirischen Spiel mit den soziokulturellen Umständen der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg verleiht der fiktive Erzähler wieder und wieder dem Postulat ‚christlichen‘ Handelns Nachdruck. Dass bei den erwähnten "sozikulturellen Umständen" im 17. Jahrhundert ein profunder Aberglaube und volksmagische Überzeugungen eine prominente Rolle spielen; dass mit dem unsichtbar machenden Vogelnest gar ein "magischer" Gegenstand zum zentralen Handlungselement wird, führt zu einem interessanten Wechselspiel zwischen Religion und Magie in Grimmelshausens Vogelnest-Roman. Während der Erzähler sich bereits eingangs eindeutig positioniert – er verunglimpft magische Gegenstände, die "extraordinari Gluͤks Stuͤke", als Unglücksbringer – "spielt" der Vogelnest-Roman in der Folge doch auch mit dem Verhältnis von Glauben und Aberglauben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Grimmelshausens Vogelnest und das Spiel mit der Magie - Zwischen Religion und Aberglauben
- Volksmagie in der Frühen Neuzeit: Von der magischen Aneignung christlicher Heilsangebote
- Zur Standortbestimmung des Erzählers: Glaube und Aberglaube im Vogelnest
- Gottesfurcht und Bekehrung
- Magische Gegenstände, Elementargeister und deren satirische Funktion - Aberglaube und Aberglaubenskritik
- Exkurs: Frühaufklärerische Aberglaubenskritik im zweiten Teil des Vogelnests und im Simplicissimi Galgen-Männlin
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Spannungsverhältnis zwischen Religion und Aberglauben im ersten Teil von Grimmelshausens Schelmenroman „Das Wunderbarliche Vogelnest“. Im Fokus steht die Frage, wie der Text das Thema Aberglaube behandelt, ob und inwiefern eine trennscharfe Unterscheidung zwischen Glauben und Aberglauben getroffen wird und ob dieses Spannungsfeld für satirische und lehrhafte (Bekehrungs-)Zwecke instrumentalisiert wird.
- Die historische und soziokulturelle Kontexte der Frühen Neuzeit, insbesondere die Bedeutung von Aberglaube und Volksmagie
- Die Positionierung des fiktiven Erzählers im „Vogelnest“ und seine Kritik an magischen Gegenständen und Praktiken
- Die Rolle des Vogelnestes als „magischer Gegenstand“ im Roman und dessen Bedeutung im Kontext des Glaubens- und Aberglaubens-Diskurses
- Die Verbindung zwischen Grimmelshausens Aberglaubenskritik und der frühneuzeitlichen Aufklärung
- Der Einsatz des New Historicism als methodisches Vorgehen zur Analyse des „Vogelnest“ im Kontext seiner Entstehungszeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung präsentiert das „Wunderbarliche Vogelnest“ als Roman, der sich mit den Themen Religion und Aberglaube auseinandersetzt. Der fiktive Erzähler nimmt eine klare Positionierung ein und kritisiert magische Gegenstände, während der Roman zugleich mit dem Verhältnis von Glauben und Aberglauben spielt.
- Das zweite Kapitel beleuchtet die Volksmagie in der Frühen Neuzeit und die Schwierigkeiten, eine klare Unterscheidung zwischen Glauben und Aberglauben zu treffen. Der Text zeigt, wie kirchenrechtliche Definitionen von Aberglauben und Magie im Kontext der frühen Neuzeit nicht immer eindeutig sind und magische Elemente teilweise in religiöse Praktiken integriert wurden.
- Das dritte Kapitel konzentriert sich auf die Positionierung des Erzählers im „Vogelnest“ und untersucht seine kritische Haltung gegenüber Aberglauben. Hier werden die Themen Gottesfurcht, Bekehrung und die satirische Funktion von magischen Gegenständen und Elementargeistern behandelt.
Schlüsselwörter
Grimmelshausen, „Das Wunderbarliche Vogelnest“, Aberglaube, Volksmagie, Glaube, Religion, Frühe Neuzeit, Aufklärung, Satirisches Spiel, Bekehrung, magische Gegenstände, New Historicism.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Grimmelshausens „Vogelnest“?
Es ist ein Schelmenroman, in dem ein magisches Vogelnest, das unsichtbar macht, als zentrales Handlungselement für Satire und Gesellschaftskritik dient.
Wie grenzt Grimmelshausen Glaube von Aberglaube ab?
Die Arbeit untersucht das definitorische Vakuum der Frühen Neuzeit, in dem magische Praktiken oft mit religiösen Heilsangeboten vermischt wurden.
Welche Rolle spielen magische Gegenstände im Roman?
Sie werden vom Erzähler als Unglücksbringer verunglimpft und dienen dazu, die moralischen Verfehlungen der Menschen satirisch bloßzustellen.
Was ist die „Aberglaubenskritik“ bei Grimmelshausen?
Er nutzt den Roman, um vor den Gefahren der Volksmagie zu warnen und stattdessen christliches Handeln und Gottesfurcht zu propagieren.
Was thematisiert das Werk „Galgen-Männlin“?
Es behandelt den Glauben an Alraunen und andere magische Wesen und führt die frühaufklärerische Kritik am Aberglauben fort.
- Arbeit zitieren
- Thorben Höppner (Autor:in), 2021, Grimmelshausens "Vogelnest" und "Galgen-Männlin". Gottesfurcht, magisches Weltbild und Aberglaubenskritik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1354038