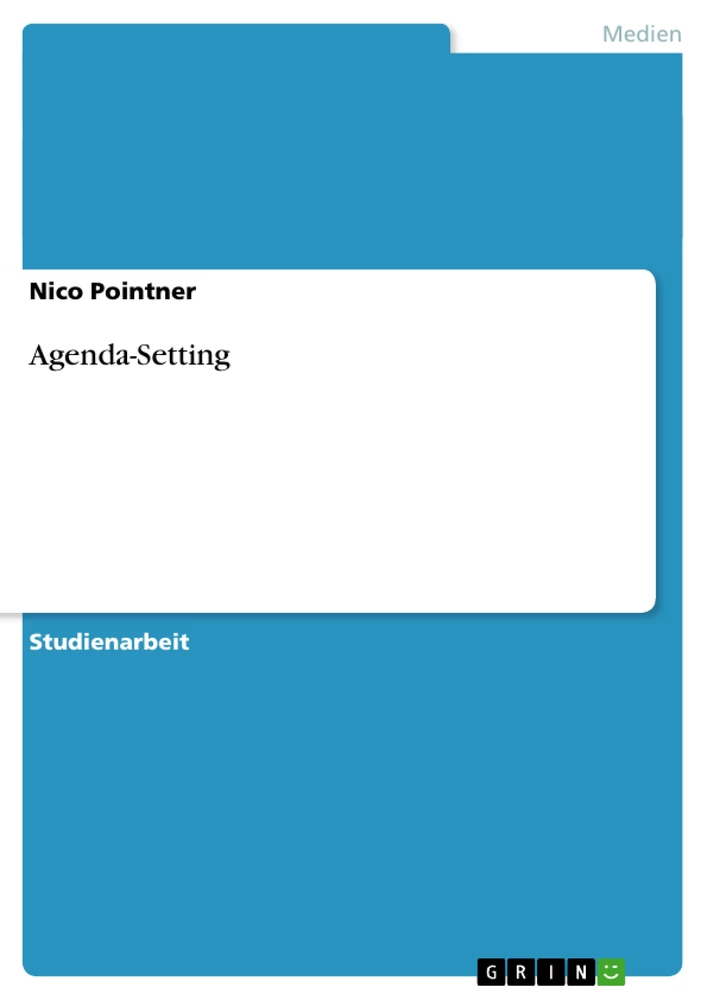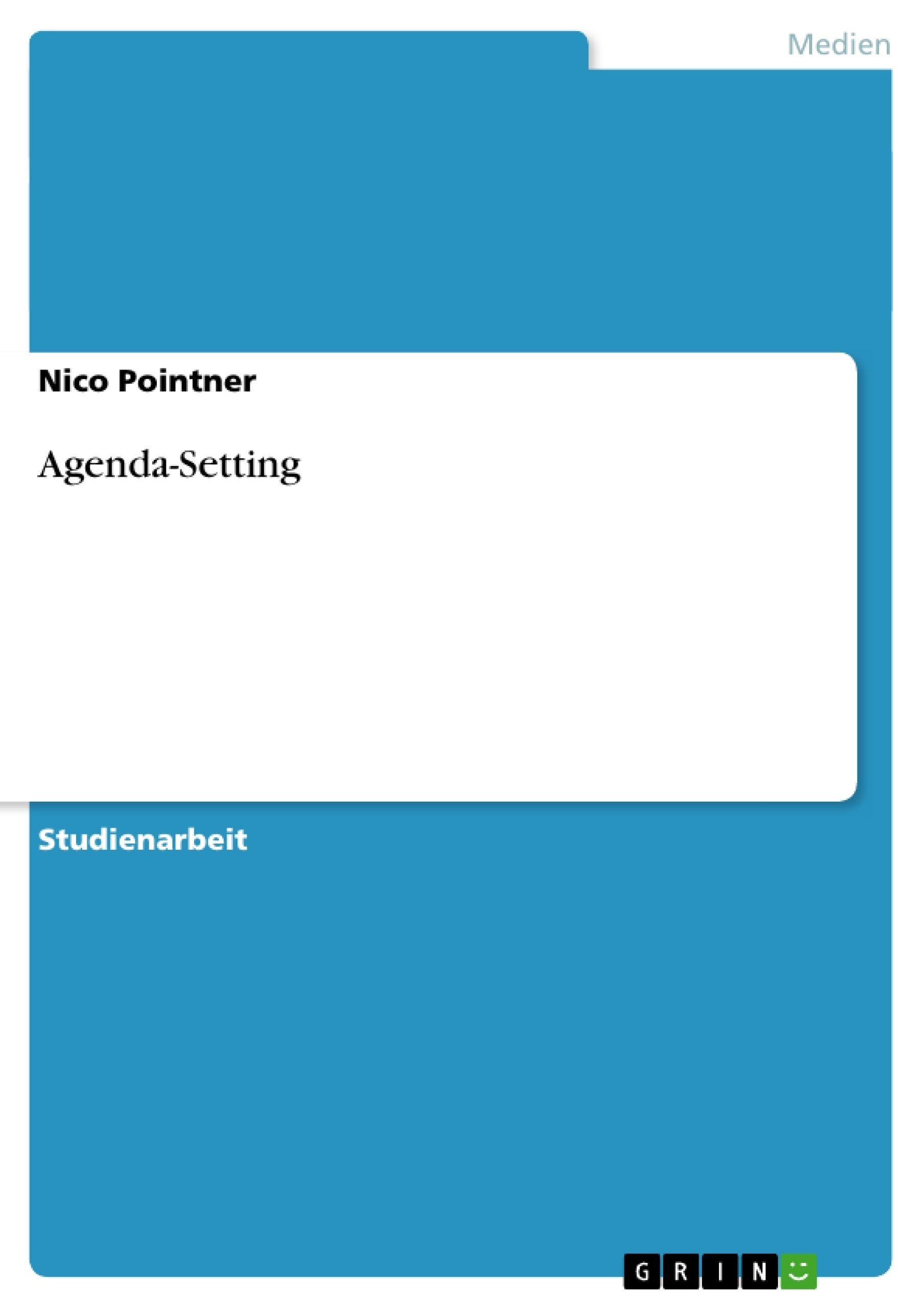Dass Massenmedien Wirkungen auf ihr Publikum haben, ist seit Entstehung dieser „4. Gewalt“ unbestritten. Doch geht es darum, auf welche Art sie beeinflussen und vor allem in welchem Ausmaß, ist man sich in der Wissenschaft nach wie vor uneinig. Ging man bis in die vierziger Jahre mit dem „Stimulus-Response-Modell“ von einer starken bis absoluten Medienwirkung aus, folgte mit der Annahme der „selektiven Kommunikationsnutzung“ und der einhergehenden „Verstärker-Hypothese“ eine wissenschaftliche Sicht, die die medialen Wirkungen als gering einstufte. Seit den Siebzigern betrachtet die Wirkungsforschung mit der
Annahme einer „selektiven Medienwirkung“ den medialen Einfluss differenzierter. In diese Kategorie ist auch der Thematisierungsansatz, dass in den USA entstandene kommunikatorzentrierte Wirkungsmodell des Agenda-Setting, anzutreffen. Themen können durch Medien erfunden („Pseudo-Themen“), besonders fokussiert oder unterdrückt werden, was sich im Bewusstsein des Medienpublikums niederschlägt. Doch die anfängliche Sichtweise der totalen Thematisierung musste nach und nach eingeschränkt werden, da man viele Faktoren, die begünstigend oder hemmend auf den Effekt wirken, zu Beginn nicht oder zumindest zu wenig berücksichtigte. Auch an der methodischen Umsetzung und einem theoretischen Grundgerüst mangelt es bisweilen stark. Dennoch ist die Existenz einer Thematisierungs- und Themenstrukturierungswirkung der Medien unumstritten. Ich will in dieser Hausarbeit den Ansatz des Agenda-Setting vorstellen und den Stand der bisherigen Forschung beleuchten.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Agenda-Setting
2.1. Agenda-Setting – Definition
2.2. Die Beziehung von Medien- und Publikumsagenda
2.3. Agenda-Building
2.4. Die Frage der Kausalität – Henne oder Ei?
3. Ergebnisse der bisherigen Forschung: „contingent conditions“
3.1. Struktur der Medienagenda
3.2. Grad der Aufdringlichkeit der Themen
3.3. Fernsehen oder Zeitung – Die Art der rezipierten Medien
3.4. Lokale und nationale Themen
3.5. Allgemeinheitsgrad der Themen
3.6. Publikumsvariablen
4. Kritik
5. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Dass Massenmedien Wirkungen auf ihr Publikum haben, ist seit Entstehung dieser „4. Gewalt“ unbestritten. Doch geht es darum, auf welche Art sie beeinflussen und vor allem in welchem Ausmaß, ist man sich in der Wissenschaft nach wie vor uneinig. Ging man bis in die vierziger Jahre mit dem „Stimulus-Response-Modell“ von einer starken bis absoluten Medienwirkung aus, folgte mit der Annahme der „selektiven Kommunikationsnutzung“ und der einhergehenden „Verstärker-Hypothese“ eine wissenschaftliche Sicht, die die medialen Wirkungen als gering einstufte. Seit den Siebzigern betrachtet die Wirkungsforschung mit der Annahme einer „selektiven Medienwirkung“ den medialen Einfluss differenzierter. In diese Kategorie ist auch der Thematisierungsansatz, dass in den USA entstandene kommunikatorzentrierte Wirkungsmodell des Agenda-Setting, anzutreffen.[1] Themen können durch Medien erfunden („Pseudo-Themen“), besonders fokussiert oder unterdrückt werden, was sich im Bewusstsein des Medienpublikums niederschlägt. Doch die anfängliche Sichtweise der totalen Thematisierung musste nach und nach eingeschränkt werden, da man viele Faktoren, die begünstigend oder hemmend auf den Effekt wirken, zu Beginn nicht oder zumindest zu wenig berücksichtigte. Auch an der methodischen Umsetzung und einem theoretischen Grundgerüst mangelt es bisweilen stark. Dennoch ist die Existenz einer Thematisierungs- und Themenstrukturierungswirkung der Medien unumstritten.
Ich will in dieser Hausarbeit den Ansatz des Agenda-Setting vorstellen und den Stand der bisherigen Forschung beleuchten.
2.1. Agenda-Setting – Definition
Agenda-Setting ist nach Schenk die „Fähigkeit der Massenmedien, das Wissen und Denken des Publikums zu strukturieren und auch Wandlungsprozesse in den Kognitionen zu bewirken“.[2]
Die Medien erzwingen durch Auswahl, Strukturierung, Platzierung und Wiederholung der Agenda die Aufmerksamkeit der Rezipienten.[3] Damit geben sie den Menschen nicht vor, was sie denken sollen, sondern dass sie über ein bestimmtes Thema nachdenken sollen.[4]
Somit stehen nicht Einstellung oder Verhalten, sondern Wissens- bzw. Vorstellungselemente der Medienwirkung im Mittelpunkt der Untersuchungen. Für Kurt Lang und Gladys Engel Lang „präsentieren [die Medien] fortlaufend Objekte, die vorschlagen, worüber die Individuen der Masse denken, etwas wissen bzw. fühlen sollen.“[5] Dem Modell liegt implizit eine Lerntheorie zugrunde, da man annimmt, dass der Rezipient umso mehr über einen Sachverhalt lernt, je häufiger dieser thematisiert wird.[6]
Den Grundstein dieser Theorie legten die U.S. Forscher Maxwell E. McCombs und Donald L. Shaw 1972 mit einer Studie in Chapel Hill, North Carolina, über den Präsidentschaftswahlkampf von 1968. Sie verglichen die individuellen Themenprioritäten hundert unentschlossener Wähler mit einer Inhaltsanalyse ausgesuchter Tageszeitungen sowie Fernsehnachrichten und stellten starke Korrelationen von Medienagenda und Publikumsagenda fest. Aufgrund dieser bemerkenswerten Übereinstimmungen stellten sie folgende, vielfach zitierte Hypothese auf:
„While the mass media may have little influence on the directory or intensity of attitudes, it is hypothesized that the mass media set the agenda for each political campaign, influencing the salience of attitudes toward political issues.”[7]
McCombs und Shaw schlossen hiermit zwar auf einen Thematisierungseffekt, bezeichneten die errechneten Korrelationen aber als zwar notwendigen, jedoch nicht hinreichenden Faktor der Thematisierung.[8] Diese fruchtbare Pilotstudie löste eine gewaltige Lawine von mittlerweile deutlich über zweihundert Nachfolgeuntersuchungen vor allem in den Vereinigten Staaten aus.[9]
2.2. Die Beziehung von Medien- und Publikumsagenda
McCombs unterscheidet drei verschiedene Untersuchungsansätze in Hinblick auf den Zusammenhang zwischen Medien- und Publikumsagenda.
[...]
[1] Schreyer, Bernhard / Schwarzmeier, Manfred: Grundkurs Politikwissenschaft: Studium der politischen Systeme. Eine studienorientierte Einführung. Wiesbaden 2002. S. 144 ff.
[2] Schenk, Michael: Medienwirkungsforschung. C.B. Mohr-Verlag, Tübingen 1987. S. 195
[3] ebd. S. 196
[4] Edelstein, Axel: Agenda-Setting – Was ist zuerst: Menschen oder Medien? In: Media Perspektiven. Vol. 7 (1983). S. 470
[5] McCombs, Maxwell E./ Shaw, Donald L.: The agenda-setting function of mass media. In: Public Opinion Quarterly. Vol. 36 (1972). S. 177
[6] s. Schenk: S. 198
[7] s. McCombs, Shaw 1972: S. 177
[8] ebd. S. 184
[9] Winterhoff-Spurk, Peter: Medienpsychologie – Eine Einführung. W. Kohlhammer, Stuttgart 1999. S. 94
Häufig gestellte Fragen
Was besagt die Agenda-Setting-Theorie?
Die Medien geben den Menschen nicht vor, was sie denken sollen, sondern worüber sie nachdenken sollen, indem sie Themen priorisieren.
Wer begründete diesen Forschungsansatz?
Maxwell McCombs und Donald Shaw legten 1972 mit ihrer "Chapel Hill"-Studie den Grundstein für die Agenda-Setting-Forschung.
Was ist der Unterschied zwischen Medienagenda und Publikumsagenda?
Die Medienagenda ist die Themenstruktur der Berichterstattung; die Publikumsagenda ist die Rangfolge der Themen, die die Menschen für wichtig halten.
Was sind "Pseudo-Themen"?
Themen, die erst durch die mediale Inszenierung an Bedeutung gewinnen oder künstlich erschaffen wurden, ohne eine reale Problembasis.
Welche Faktoren beeinflussen den Agenda-Setting-Effekt?
Dazu zählen die Art des Mediums (TV vs. Zeitung), die Aufdringlichkeit eines Themas und individuelle Publikumsvariablen.
- Arbeit zitieren
- Nico Pointner (Autor:in), 2004, Agenda-Setting, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/135508