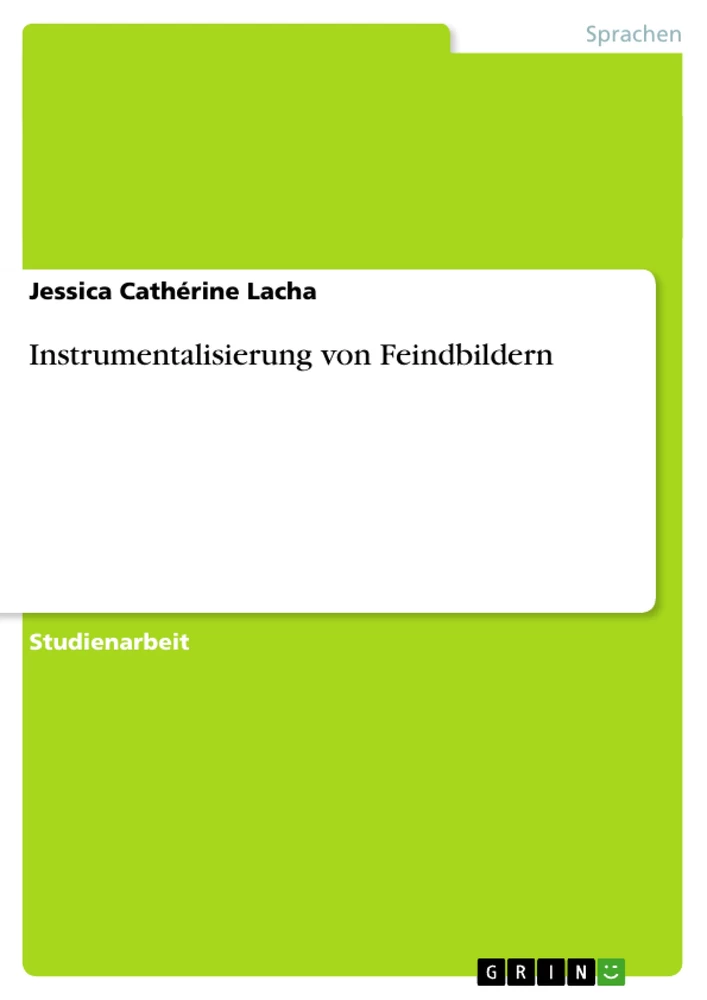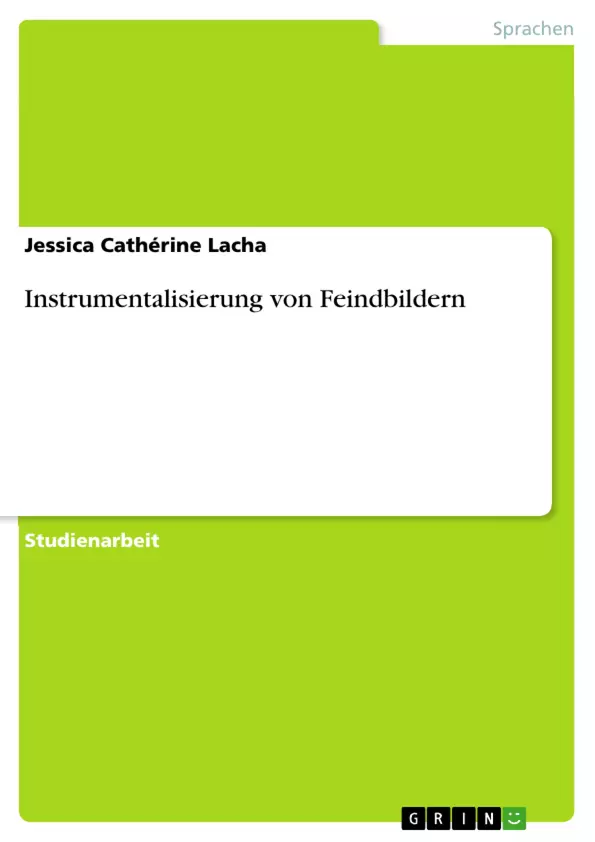In vorliegender Arbeit habe ich versucht dem Phänomen Feindbild auf die Spur zu kommen. Die zentrale Frage dieser Arbeit lautet: Was ist ein Feindbild und in Zusammenhang damit wie entsteht es, wie, wo und warum wird es eingesetzt und in weiterer Folge wie kann es abgebaut werden?
Zunächst wird mittels einer inhaltlichen Analyse versucht den Begriff Feindbild genauer zu definieren, im Anschluss daran erfolgt ein Diskurs über die Entstehung des Feindbildes, wie wird es konstruiert und aus welchen Gründen wird es überhaupt eingesetzt. Nächster Punkt bildet eine rhetorische Analyse, in der die sprachliche Umsetzung des Feindbildes anhand konkreter Beispiele untersucht wird. Das letzte Kapitel meiner Arbeit befasst sich schließlich mit dem Prozess des erfolgreichen Abbaus von Feindbildern.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Versuch einer inhaltlichen Analyse
- A.) Feindbild als Begriff
- B) Definitionsversuche: Vorurteil, Stereotyp, Feindbild
- a) Das Vorurteil
- b) Stereotyp
- c) Feindbild
- III. Entstehung - Konstruktion - Anwendung - Abbau
- A) Entstehung von Feindbildern
- B) Konstruktion von Feindbildern
- C) Warum werden Feindbilder eingesetzt?
- D) Beispiele für Feindbilder im politischen Diskurs Italiens
- IV. Versuch einer rhetorischen/semantischen Analyse
- A) Sprache und Feindbild
- B) Der Diskurs der Differenz entsteht - Gruppenbildung und Wir-Diskurs
- a) Kategorisierung und Evaluierung
- b) Wir-Diskurs
- C) Argumentationsstrategien und -techniken
- a) Beispiele: Strategien der Verantwortungs- bzw. Schuldzuschreibung
- b) Beispiele: Techniken der Argumentation: Verantwortungs- bzw. Schuldleugnung
- D) Umsetzung der Strategien
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das Phänomen des Feindbildes im politischen Diskurs Italiens. Sie befasst sich mit der Definition des Begriffs, der Entstehung und Konstruktion von Feindbildern sowie deren Einsatz und möglichen Abbau.
- Begriffliche Abgrenzung von Vorurteil, Stereotyp und Feindbild
- Analyse der Entstehung und Konstruktion von Feindbildern
- Untersuchung der Gründe für den Einsatz von Feindbildern im politischen Diskurs
- Rhetorische und semantische Analyse der sprachlichen Umsetzung von Feindbildern
- Exploration von Strategien zum Abbau von Feindbildern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Feindbild ein und stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor. Das zweite Kapitel analysiert den Begriff Feindbild und grenzt ihn von Vorurteil und Stereotyp ab. Das dritte Kapitel befasst sich mit der Entstehung, Konstruktion und Anwendung von Feindbildern. Es werden auch konkrete Beispiele aus dem italienischen politischen Diskurs genannt. Das vierte Kapitel untersucht die sprachliche Umsetzung des Feindbildes und analysiert die rhetorischen Strategien, die im Zusammenhang mit Feindbildern zum Einsatz kommen. Die Arbeit konzentriert sich dabei auf die Entstehung des „Wir-Diskurses“ und die Strategien der Verantwortungs- und Schuldzuschreibung sowie deren Leugnung.
Schlüsselwörter
Feindbild, Vorurteil, Stereotyp, politischer Diskurs, Italien, Rhetorik, Semantik, Argumentation, Gruppenbildung, Wir-Diskurs, Verantwortungszuschreibung, Schuldzuschreibung, Sprachliche Umsetzung, Abbau von Feindbildern.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird ein Feindbild definiert?
Ein Feindbild ist eine gesteigerte Form von Vorurteil und Stereotyp, die eine Gruppe als bedrohlich und grundsätzlich bösartig darstellt.
Warum werden Feindbilder in der Politik eingesetzt?
Sie dienen der internen Gruppenbildung (Wir-Diskurs), der Mobilisierung von Wählern und der einfachen Zuweisung von Schuld für komplexe Probleme.
Was kennzeichnet die Sprache von Feindbildern?
Typisch sind rhetorische Strategien der Ausgrenzung, die Verwendung von Kategorisierungen und die bewusste Leugnung eigener Verantwortung.
Welche Beispiele gibt es für Feindbilder im politischen Diskurs?
Die Arbeit untersucht dies beispielhaft am politischen Diskurs in Italien und analysiert dortige Argumentationsmuster.
Wie können Feindbilder wieder abgebaut werden?
Der Abbau erfordert den Dialog zwischen den Gruppen, die Dekonstruktion von Vorurteilen und eine Veränderung der sprachlichen Kommunikation.
- Quote paper
- Jessica Cathérine Lacha (Author), 2001, Instrumentalisierung von Feindbildern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13560