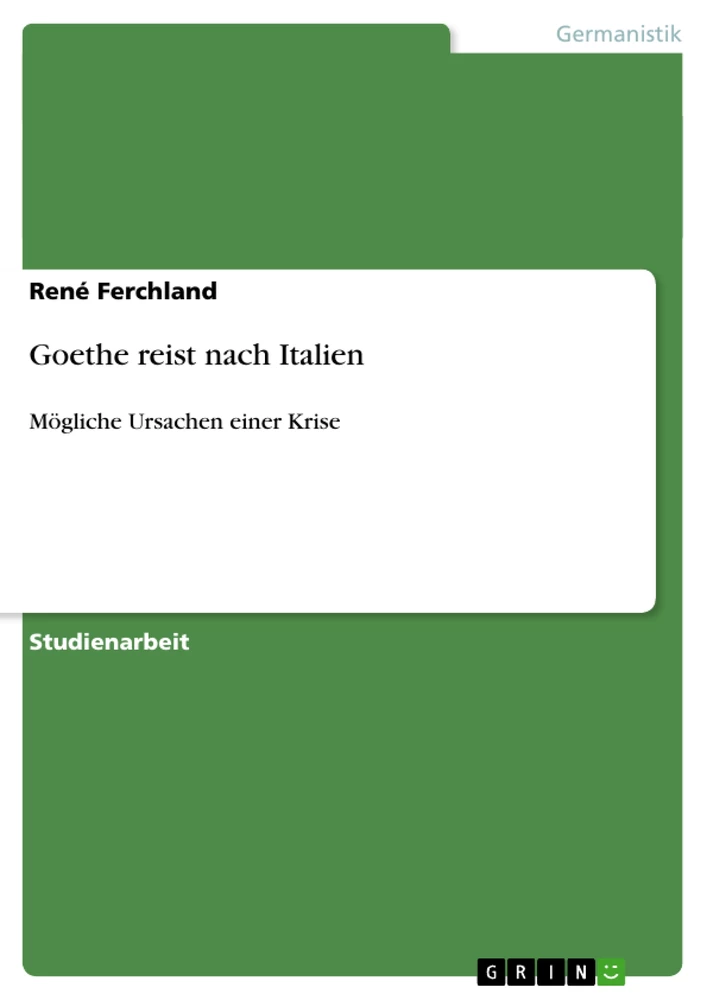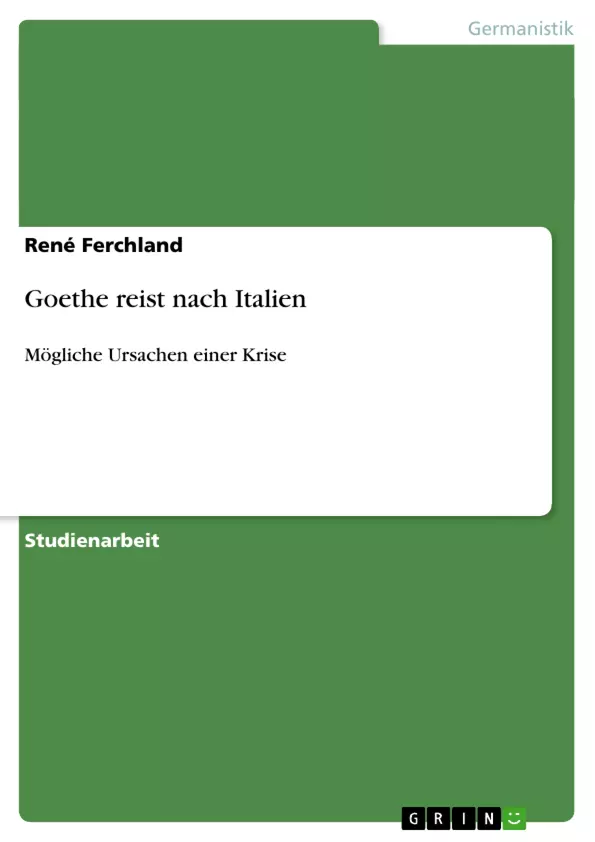Um die im Mittelpunkt stehende Persönlichkeitskrise betrachten zu können, soll zunächst derjenige Johann Wolfgang Goethe betrachtet werden, der sich in der Lebensphase des mündigen Menschen befindet. Der 1749 in Frankfurt geborene, später bekannteste Deutsche Dichter befindet sich in den späten Dreißigern seines Lebens, es ist davon auszugehen, dass sich sein Charakter entwickelt hat, ebenso wie die innere Festigung seiner selbst, wie auch der „Zusammenschluss des lebendigen Denkens, Fühlens, Wollens mit dem eigenen geistigen Kern“. Es ist bereits einige Jahre her, dass ihm sein Briefroman „Die Leiden des jungen Werthers“ (1774) ersten internationalen, literarischen Ruhm einbrachte. Goethe arbeitet ebenso lange als geheimer Legationsrat unter Herzog Karl August und verfügt über ein inzwischen stabiles Wertsystem, außerdem hat er wohl als Mittdreißiger Zuverlässigkeit in dem entwickelt, was er übernommen hat, hält Wort und Treue. Man spricht außerdem von dieser Lebenszeit als solche, in „welcher die Produktivkräfte geistiger und vitaler Art am unmittelbarsten strömen.“
Der inzwischen sogar geadelte Dichter aber manövriert sich in eine Krise; das Hofleben in Weimar behagt ihm nicht, Goethe erfährt eine tiefe Enttäuschung darüber, dass ihm die berufliche Selbstverwirklichung in Deutschland anscheinend nicht gelungen ist und fühlt sich in seiner Heimat typisiert. Nach dem bisher doch anregenden Gedankenaustausch mit Charlotte von Stein entwickeln sich zwischen ihnen Spannungen, die er nicht erträgt.
Aus diesen Faktoren resultierend erwacht in Johann Wolfgang Goethe allem Anschein nach das „Verlangen nach einem umfassenden Neubeginn“.
Inhaltsverzeichnis
1. Das Wertesystem des mündigen Menschen Goethe
2. Die Krise und Italien
3. Phasen kindlicher Entwicklung
3.1 Goethe wird, was man ihm gibt
3.2 Goethe ist, was er will
3.3 Goethe ist, was er sich zu werden vorstellen kann
4. Ergebnis der Italienreise
Quellen
1. Das Wertesystem des mündigen Menschen Goethe
Um die im Mittelpunkt stehende Persönlichkeitskrise betrachten zu können, soll zunächst derjenige Johann Wolfgang Goethe betrachtet werden, der sich in der Lebensphase des mün-digen Menschen befindet. Der 1749 in Frankfurt geborene, später bekannteste Deutsche Dich-ter befindet sich in den späten Dreißigern seines Lebens, es ist davon auszugehen, dass sich sein Charakter entwickelt hat, ebenso wie die innere Festigung seiner selbst, wie auch der „Zusammenschluss des lebendigen Denkens, Fühlens, Wollens mit dem eigenen geistigen Kern“1. Es ist bereits einige Jahre her, dass ihm sein Briefroman „Die Leiden des jungen Wer-thers“ (1774) ersten internationalen, literarischen Ruhm einbrachte. Goethe arbeitet ebenso lange als geheimer Legationsrat unter Herzog Karl August und verfügt über ein inzwischen stabiles Wertsystem, außerdem hat er wohl als Mittdreißiger Zuverlässigkeit in dem entwi-ckelt, was er übernommen hat, hält Wort und Treue. Man spricht außerdem von dieser Le-benszeit als solche, in „welcher die Produktivkräfte geistiger und vitaler Art am unmittelbars-ten strömen.“2
Der inzwischen sogar geadelte Dichter aber manövriert sich in eine Krise; das Hofleben in Weimar behagt ihm nicht, Goethe erfährt eine tiefe Enttäuschung darüber, dass ihm die beruf-liche Selbstverwirklichung in Deutschland anscheinend nicht gelungen ist und fühlt sich in seiner Heimat typisiert. Nach dem bisher doch anregenden Gedankenaustausch mit Charlotte von Stein entwickeln sich zwischen ihnen Spannungen, die er nicht erträgt.
Aus diesen Faktoren resultierend erwacht in Johann Wolfgang Goethe allem Anschein nach das „Verlangen nach einem umfassenden Neubeginn“3.
2. Die Krise und Italien
Einher mit diesen Problematiken seines bisherigen Lebens geht vermutlich das starke Gefühl, dass die Ziele nichtssagend und leer geworden sind.4 Die Erfüllung vielfältiger Aufgaben am Weimarer Hof befriedigt ihn nicht, sein Interessengebiet erweitert sich stetig und ist mit sei-nen Diensten nicht mehr vereinbar, den ersten Hinweis auf einen Stimmungswechsel liefert die Melancholisierung seiner Lyrik zu jener Zeit. Als Beispiel dafür eine Strophe aus „Gren-zen der Menschheit“, eines seiner ernsten Gedichte aus der Zeit von 1779 bis 1784:
Ein kleiner Ring/ Begrenzt unser Leben,
Und viele Geschlechter/ Reihen sie dauernd
An ihres Daseins/ Unendliche Kette.5
Zudem ist er alleinstehend, ein erfüllendes Verhältnis zu einer Frau war ihm bisher noch nicht vergönnt. Dieser Bereich seines Lebens erscheint seit seiner unglücklichen Liebe zu Charlotte Buff krisenbehaftet zu sein, wenngleich die damit zusammenhängende seelische Krise „Die Leiden des jungen Werthers“ und seinen Durchbruch begründet hat.
Heimlich tritt er am 3. September 1786 eine Reise nach Italien an – und zwar auf un-bestimmte Zeit. In Italien erhofft er sich eine physisch-körperliche Genesung6, nimmt also offenbar keine mögliche psychische Krise wahr, die durch ein Gefühl der Grenze hervorgeru-fen worden ist, nähme man sich der Persönlichkeitstheorie von Romano Guardini an. Das Erfahren der Grenze bezöge sich auf die der eigenen Kraft, die er sehr wohl hätte erkennen können, denn sie schlug sich nieder in seinen depressiven Empfindungen, die graue Düsternis, Rauheit, Nässe und Kälte in Deutschland betreffend, was wiederum als Evidenz für die wech-selseitige Abhängigkeit von Psyche und Physis angesehen werden könnte.
Das „fieberhafte Verlangen nach Rom“, der „ewigen Stadt“7 gewinnt die Überhand, Goethe lässt alles in Weimar zurück, gibt nur einem treuen Diener und Seidel darüber Bescheid, nimmt Charlotte von Steins Kränkung in Kauf und gibt sogar ein stückweit seine eigene Iden-tität auf, indem er inkognito reist und in Italien als Philipp Möller leben will.
Daraus resultierend muss es sich schlussendlich um einen psychischen Faktor handeln, der Goethe zu der Italienreise bewegt. Folgend soll nun mithilfe der Persönlichkeitsmodells Erik Eriksons und den Phasen kindlicher Entwicklung, die Freud entworfen hat, ein Licht auf den mündigen Menschen Goethe und mögliche Kindheitskonflikte geworfen werden. Wie viel lässt sich diesbezüglich zu seinen Eltern sagen – welche Schlüsse könnte man daraus ziehen? Und wie ist sein Persönlichkeitsstatus nach der Italienreise zu bewerten?
3. Phasen kindlicher Entwicklung
Wenn man sich einige autobiografische Aussagen aus der „Italienischen Reise“ vor Augen führt, wie etwa
Ich habe recht diese Zeit her zwei meiner Kapitalfehler (...) entdecken können. (Italienische Reise, S. 369) oder
„Ich liege an dieser Krankheit von Jugend auf krank, und gebe Gott,
dass sie sich einmal auflöse.“ (S. 398) ,
so kommt man nicht umhin, dass Goethe sich spätestens auf der Reise selbst des psychischen Faktors bewusst wird, der ihn unter anderem in die Krise geführt haben könnte. Es soll an dieser Stelle schon ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass es sich hier nur um mut-maßliche Schlussfolgerungen handelt, die aufgrund der „Mannichfaltigkeit“ dieses Dichters keinen unbedingten Anspruch auf Wahrheit erheben wollen. Ein weiterer Aspekt für diese Klarstellung ist auch, dass über Goethes Kindheit und Jugend nicht allzu viel bekannt gewor-den ist, es nur aufgrund einiger Quellen und den deutlich gewordenen psychischen Konturen dieser Persönlichkeit, die er als Mittdreißiger erworben hat, möglich sein kann, einige Speku-lationen anzustellen.
Als Grundlage für die Lokalisierung potentieller Krisenherde in Goethes Kindheit dient Siegmund Freud und seine Begründung der Psychoanalyse. Da der Blickpunkt aber nicht auf das Kind Goethe direkt zu richten ist, sondern wir von dem sich in der mündigen Phase be-findlichen Dichter ausgehen, wird der Aufsatz „Wachstum und Krisen der gesunden Persön-lichkeit“8 von Erik H. Erikson hinzugezogen, der sich auf Freud beruft, gleichzeitig aber die Analyse um die psychosoziale und die psychohistorische Dimension erweitert und in erster Linie von dem erwachsenen Menschen ausgeht.
Freud postuliert drei Phasen kindlicher Entwicklung, die vor der Latenzperiode stattfinden und die im Folgenden chronologisch kurz umrissen und durch Eriksons daran angelehnte drei Komponenten seelischer Gesundheit ergänzt werden. Im Anschluss an jede Phase wird ein Bezug auf die Persönlichkeitskrise Goethes versucht.
[...]
1 Guardini, Romano: Die Lebensalter, 1961, S. 145.
2 Ebenda, S. 148.
3 Reuter, Hans-Heinrich: Johann Wolfgang Goethe, 1979, S. 61.
4 Vgl. Lievegoed, Bernhard: Lebenskrisen – Lebenschancen, 2001, S. 80.
5 Brandmeyer, Rudolf: Die Geschichte des jungen Goethe: Eine gattungsgeschichtliche Einführung, Göttingen 1998.
6 Vgl. Reuter, Hans-Heinrich: Johann Wolfgang Goethe, 1979, S. 60.
7 Ebenda, S. 61.
8 Erikson, Erik: Wachstum und Krisen der gesunden Persönlichkeit, in: Identität und Lebenszyklus, 1953.
Häufig gestellte Fragen zu Goethes Italienreise
Warum floh Goethe 1786 nach Italien?
Goethe befand sich in einer tiefen Sinnkrise; er fühlte sich durch das Weimarer Hofleben und Spannungen mit Charlotte von Stein eingeengt.
Was bedeutet es, dass Goethe "inkognito" reiste?
Er wollte seine Identität als berühmter Dichter ablegen und nannte sich in Italien "Philipp Möller", um freier leben und lernen zu können.
Wie veränderte die Reise Goethes Persönlichkeit?
Die Reise wirkte wie eine "Wiedergeburt"; er fand zu neuer kreativer Kraft und einem gefestigten künstlerischen Selbstverständnis zurück.
Welche psychologischen Aspekte werden in der Arbeit analysiert?
Die Arbeit nutzt Modelle von Erikson und Freud, um Goethes Krise und seine kindliche Entwicklung zu beleuchten.
Was erhoffte sich Goethe von Rom?
Er suchte nach physischer Genesung und einem umfassenden Neubeginn in der "ewigen Stadt".
- Arbeit zitieren
- René Ferchland (Autor:in), 2008, Goethe reist nach Italien , München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/135636