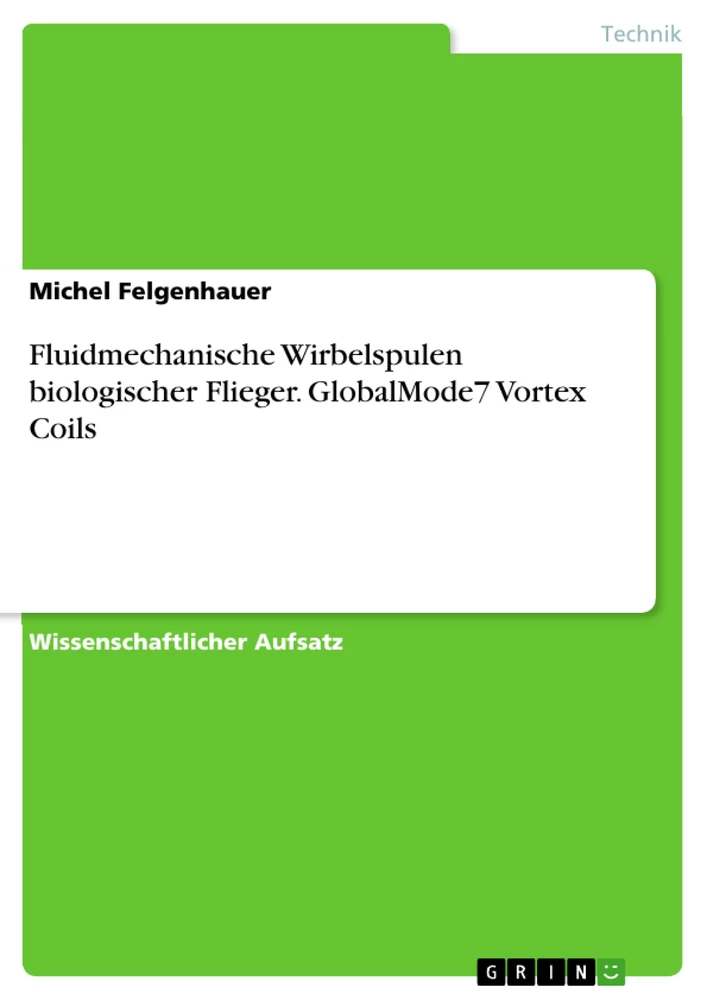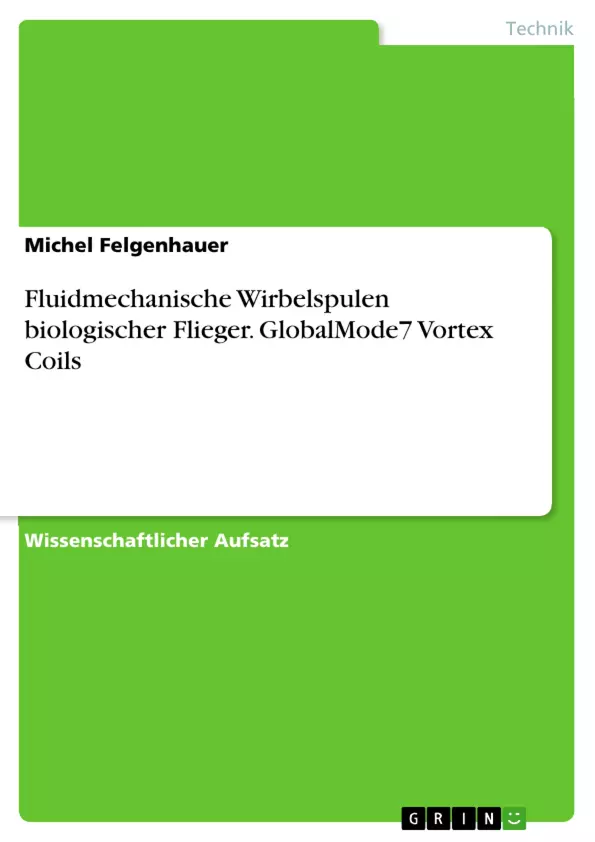Diese wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit den fluidmechanische Wirbelspulen bei biologischen Fliegern.
Fluidmechanische Wirbelspulen entstehen mit einer spiralig angeordneten Formation kohärenter Wirbelfäden. Man kann fluidmechanischen Wirbelspulen physikalische Eigenschaften zuweisen, aber formal gibt es über spiralige Wirbelformationen in der Strömungsmechanik bislang keine allgemeingültige Theorie. Also werden wir nachfolgend von einer Phänomenologie sprechen, statt von einer Theorie. Über Wirbelfäden – den „Bauelementen“ der Wirbelspulen - sind theoretische Kernaussagen seit langem bekannt; die wichtigsten stammen von Helmholtz. Einigen modernen Theorieansätzen über geordnete Wirbelanordnungen ist gemein, dass sie kohärente Wirbelformationen als zusammenhängende Domänen dominanter Wirbelstärke benennen.
Für die hier vorgestellte Phänomenologie „mehrgängiger (N) fluidmechanischer Wirbelspulen“ (global Mode N Vortex Coil) wird zunächst die als gesichert geltende Wirbelfadentheorie Helmholtz’s auf Lagrange Kohärente Strukturen angewandt und durch einen Ansatz über das innere Milieu der Wirbelfilamente erweitert. Dieserart Strukturen bilden Systeme aus, die fähig sind zu einer Impulsinduktion, welche ihrerseits das Feld organisiert. Für die Gegenwart wohlgruppierter Wirbelfäden gibt es eine Vermutung über die Selbstorganisation (Autopoiesis) von Wirbelfilamenten in einem Strömungsfeld.
Inhalt
Die erkaltete Spur
Mitspieler
Gefieder
Landsegler VS Windkanal
Kraft- und Arbeitsprozesse Korridormodell
Die fünfzählige Auffingerung Kommunizierende Wirbelfäden Berechnungsergebnisse Zusammenfassung
Anhang
Bibliographie
Programmcode
Bilder
Anmerkungen
Die erkaltete Spur
Die Kampagne beginnt im Sommer letzten Jahres und mit einem Recherchegesuch an das Archiv derTechnischen Universität Berlin. Gegenstand der Anfrage sind Messprotokolle der Experimente an den Windkanälen, Studien- und Diplomarbeiten aus den 80er und 90er Jahren. Eigentlich beginnt das Vorhaben aber schon viel früher. Es behandelt nur einen winzigen Aspekt des Vogelflugs: die fluidmechanische Wirbelspule, die beim Segelflug biologischer Landsegler auftaucht. Oder aufzutauchen verspricht! Die Fragestellung nach dem segelnden Vogelflug ist keinen Falls neu. Leonardo Da Vinci, Ikarus und Dädalus und letztendlich Lilienthal und alle anderen vor und nach ihm, waren fasziniert vom biologischen Vogelflug, entzünden die Neugier und gleichzeitig die Sehnsucht nach Ordnung des Wissens über das Fliegen. Das alte Wissen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 0: Impressionen des Abschieds. Tafelbild in der großen Versuchshalle des Fachgebiets Bionik und Evolutionstechnik im April 2017.
Natürlich hat niemand damit gerechnet, dass Wissen auch verloren gehen kann. Dass es flüchtig sein könnte, zerrinnt. Aus einer gewissen Überheblichkeit heraus dachten wir, dass Wissen auch Übereinkunft sei. Teilbar. Ein Allgemeingut. Wie die Wiese Almende, um die man sich nicht zu kümmern braucht, den Dorfanger. Doch genau dies ist natürlich falsch. Wissen existiert entweder überhaupt nicht, oder zu seiner Zeit. Dann aber für immer. Genau dies macht Wissen - hier das Wissen um fluidmechanische Wirbelspulen - zu einem fragilem Gut. Gewöhnlich gehen wir „in der Zeit" mit diesem heiligen Wissen wenig pfleglich um; ein bekannter Effekt. Und es ist uns egal, ob es eine Rettung geben könnte, oder eben nicht. Leider ist diese Arglosigkeit wenigereine Folge der Unreife, alsvielmehrder mangelnden Bildung in dieser allgemeinen Sache. Später dann, ein wenig weiser geworden in unserer Zeit erfahren wir, dass sich gerade jener Foucault[1] in seinen Synthesen mit der Produktion bzw. der Organisation von neuem Wissen und der Organisation von Wissensbeständen beschäftigt. Er bezeichnet Wissensordnung als einen historischen Raum für das, was zu wissen und zu kommunizieren überhaupt möglich ist. Genau dies ist die Grundstruktur der erkalteten Spur, nach der die Recherche angelegt ist. Und diese Rede.
Eine Wissensordnung über den Vogelflug beinhaltet also auch das, was zukünftig einmal gewusst werden wird, jemals gewusst worden ist oder in früherer Zeit noch nicht gewusst wurde, dann aber - irgendwie - auftaucht. Protagonisten im Projekt sind also die Wissenden und die Unwissenden der Vergangenheit, der Gegenwart und die zukünftig Wissenden und Unwissenden. Das erscheint mir sehr sympathisch.
Als im Jahr 2017 das Fachgebiet Bionik und Evolutionstechnik der Technischen Universität Berlin aufgelöst wird, haben die ehemaligen wissenschaftlichen Mitarbeiter ein letztes Mal Gelegenheit, die ehrwürdigen Räume des Fachgebiets zu betreten. Keiner von uns hat zu dieser Zeit auch nur eine vage Ahnung davon, was mit dem reichhaltigen Inventar aus den Laborhallen in der Ackerstraße des Berliner Wedding in den folgenden Tagen geschehen wird. Ich erinnere mich an eine spürbare, aber nicht unbedingt schmerzhafte Ratlosigkeit, als wir die große Versuchshalle betreten. Adebar[2], das altgediente Storchenflügelpräparat - es hatte in den vorangegangenen Jahrzehnten eine Menge Neues und nützliches Wissen über den Vogelflug generiert - ist an diesem Tag in der Laborhalle noch einmal präsent wie früher und immer (niemand denkt daran, es einfach „wegzupflücken", obwohl genau dies die nützlichste Tat der Stunde gewesen wäre); genauso wie die Kreidetafel, die das Wirbelgeschehen im Nachlauf des aufgefingerten Vogelflügels erklärt. Ich erkenne mein eigenes Tafelbild! Das kann doch nicht wahr sein! Das Tafelbild muss aus den späten 90er Jahren stammen; also ist diese Schiebetafel seit 20 Jahren! nicht mehr gewischt worden. Das ist kaum zu glauben. Aber, was selten geschieht: ich habe meinen Fotoapparat dabei! (Abb.O).
Im Herbst 2021 stirbt Professor Ingo Rechenberg. Es gibt einen wissenschaftlichen Nachlass: Akten, Bücher, Bildmaterial, Exponate. Ein Fundus, der aber unglücklicherweise und vorbei am Archiv derTechnischen Universität, verschwindet! Die Spur versandet. Mitte November 2022 beende ich meine Recherche im Archiv der TU Berlin: erfolglos. Es gibt keine Messprotokolle, keine Aufzeichnungen, keine Studien- und Diplomarbeiten mehr, die von den Messkampagnen an den Windkanälen handeln. Es ist, als hätte es diese experimentelle Forschung zu den fluiddynamischen Wirbelspulen in und an den Windkanälen des Fachgebiets nie gegeben.
Wären fluiddynamische Wirbelspulen Gegenstand rezenter Forschung, wäre auch dieser Verlust verkraftbar. Nun ist die Welt der 20er Jahre dieses Jahrhunderts aber eine andere als die Welt der 80er des vergangenen Jahrhunderts. Hier und heute besteht keinerlei Interesse an der Erforschung von Induktionsprozessen, angefacht aus niedrigenergetischen Vorgängen nahe Vogelflügeln und im Strömungsablauf ebendieser.
Die Spur ist erkaltet (/). Wir befinden uns nicht (wahrlich nicht) auf dem dünnem Eis ingénieur- und naturwissenschaftlicher Forschung (um ehrlich zu sein, taten wir das nie!), sondern irgendwo auf diesem dicken Brett, das es vielleicht irgendwann zu bohren gilt. Falls wir die fluidmechanischen Wirbelspulen überhaupt entdecken wollten. Wir packen das an. Aber nicht heute.
Die Spur ist erkaltet (//). Natürlich sehen wir irgendwelche fluidmechanischen Veränderungen im Feld und Wirkungen auf den Nachlauf einer Auftrieb erzeugenden Tragfläche. Aber die Effekte sind dermaßen seicht, dass ein unmittelbarer Nutzen für eine „angewandte Forschung“ schon in der ersten Phase der „Kosten und Nutzen- Darstellung“! eines modernen Forschungsantrags scheitern sollte. Wir sprechen hier nicht von Befürchtungen. Wir sprechen von Bewilligungen.
Die Spur ist erkaltet (///). Dem Elfenbeinturm ist das ziemlich egal, weil: der Elfenbeinturm ist keine Forschungsgeld-Rückmelde-Kanone. Der Elfenbeinturm - zumindest ab Stockwerk 7 aufwärts - kümmert sich einen feuchten Kehricht darum, ob die Erkenntnisse nutzen oder nicht, taugen oder nicht, die Ansichten liefern oder nicht.
Die Spur ist erkaltet(IV).Am Fachgebiet Bionik und Evolutionstechnik der TU Berlin wurden am Windkanal fluidmechanische Wirbelspulen beobachtet, gemessen und hinsichtlich ihrer Vortizität quantifiziert. Mit Messsonden, Traversier-Einrichtungen und eigens hierfür konditionierten Fadensonden. Wir wussten um das fluidmechnische Milieu der (rotorfreien) Strömung im Innern einer Wirbelspule. Das waren die Fakten, schon damals. Was wir damals nicht ahnten war, dass solches Wissen flüchtig sein könnte.
Die Spur ist erkaltet (V).Wenn es in den 80ern nicht möglich gewesen war, Gestalt und Lage eines Wirbelfilaments zurück zu verfolgen bis in seinen eigenen Entstehungsort, dann sollte es wohl auch heute - in den 20ern - keinen tieferen Sinn haben, das Wirbelfilament Δ$ zurückzuverfolgen auf seinen Weg, durch das Feld. Das ist sowohl bitter, als auch wahr!
Und überhaupt: Wirbelfilamente. Es ist keinen Falls sicher, dass es Wirbelfilamente - wie ich sie heute sehe - überhaupt gibt. Wirbelfilamente?
Mitspieler
Die mehrgängige, fluidmechanische Wirbelspule bleibt ein synthetisches Konstrukt. Wirbelspulen sind fluidische Kompositionen aus kohärenten Wirbelfäden mit zugeschriebenen Eigenschaften, welche aus ihrem wohldefinierten Innenmilieu herstammen. Zwar kommt sie in der Natur vor, die spiralige Formation, aber dennoch ist die fluidmechanische Wirbelspule „gemacht". Sie ist synthetisch in dem Sinne, dass ein Erzeugendensystem existiert, das die fluidmechanische, n- gängige Wirbelspule stiftet und generiert. Natürlich oder technisch, artifiziell oder biologisch.
Lagrange-Kohärente Wirbelsysteme haben in der Strömungsmechanik noch keine allgemeingültige Definition. Die ersten Beschreibungen, meist fünf- bzw. siebengängiger Wirbelspulensysteme beziehen sich auf Laborexperimente am Windkanal. Erste Formulierungen spiraliger rotationskohärenter Wirbelsysteme stammten aus Beobachtungen des Wirbelgeschehens um geometrisch gestaffeltes Gefieder, insbesondere der Auffingerung der Tragflügelfittiche landsegelnder Vögel. Erstspäter wurden auch technischeTragflügelmodelle vermessen; Doppeldecker-Flugsysteme - die damals einzigen technisch- artifiziellen Wirbelspulengeneratoren - tauchen als Messobjekt überhaupt nicht auf! In der Natur, als physikalisch wirkfähige Präparate in Windkanälen oder vereinfachenden Modellen waren dieserart aufgefingerte Tragflügel Forschungsgegenstand naturwissenschaftlicher und ingenieurwissenschaftlicher Institute in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Zu Beginn dieser Untersuchungen in Saarbrücken (Nachtigall) und in Berlin (Rechenberg) war man sich der sehr speziellen Fluidmechanik der Wirbelspulenstrukturen und der erforderlichen Erzeugendensysteme keinen Falls im Klaren. In Berlin (Rechenberg) war das erste technische Labormodell des aufgefingerten Vogelflügels eine aufgefächerte Randbogenkontur einer vormals kompakten, nunmehr aber am Tragflügelende geschlitzten Modelltragfläche. Alle arbeiteten damals vornehmlich in Blech; so bargen Tragflächen aus Blei gestalterische Optionen bei der Einstellung aufgefingerter Modelltragflächen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.l: Konditionierung der aufgegliederten Randbogenkontur eines Modellflügels. Gemessen wurden Auftrieb L und
Widerstand W. Nach nur 27 Variations- und Selektionskampagnen ähnelt der synthetische Flügel seinem biologischen Vorbild: dem Gefieder des landsegelnden Vogels.[3]
Mit einer auf Windkanalversuche abgestimmten Optimierungsstrategie konnte in den 90er Jahren der Technischen Universität Berlin an einem Windkanal die Gleitzahl (cl/cw)[4] eines geschlitzten und aufgefingerten Bleiflügels gegenüber seiner kompakten Anfangsgeometrie um etwa 10% verbessert werden[5].
Vorteilhafter verhält sich das Präparat eines Storchenflügels im Windkanal; mit seinem exorbitant niedrigen Widerstandsbeiwert. Obwohl das Ergebnis der Optimierung und ganz besonders die Marge der Minderung des fluidmechanischen Widerstands weit hinter den Erwartungen an die Windkanalexperimente zurückblieb, gab man sich mit dem (immerhin zweistelligen Optimierungs-) Erfolg zunächst zufrieden. Die Bilanz einer Schar aus Partialwirbeln weist weniger Verlustenergie aus als der einzelne Wirbel eines konventionellen Flügels.
Irgendwann - es sollen angeblich nur Monate, nicht etwa Jahre gewesen sein - irgendwann also fiel einem Betrachter der Windkanalexperimente, in denen wieder und wieder Vogelflügelexponate gemessen und auch gerne für das Fernsehen gefilmt wurden auf, dass die Auffächerung des biologischen Gefieders sich von dem artifiziellen Nachbau in einem kleinen aber wichtigen Detail unterscheidet. Beim biologischen Flügel bilden die „Quellpunkte" der im Nachlauf herleitbaren Wirbelstruktur eine geschlossene geometrische Figur ab, im besten Fall eine Ellipse oder ein Kreis und man erkannte: erst durch die Anordnung der Quellpunkte kommt es in der Nachlaufströmung zu einem „geordneten Impulsaustausch". In diesem Fall sorgt die Impulsinduktion der Lagrange kohärenten Wirbelfäden in das Strömungsfeld für„reaktiven Schub". In Wirbelstrukturen die aus geschlossenen geometrischen Figuren (ihrer Quellpunkte in Circe-Configuration) stammen, wird dieser reaktive Schub als Minderung des Widerstands wirksam immer dann, wenn Widerstandskräfte (-) und Schubkräfte (+) auf einer nah benachbarten oder einer gemeinsamen (Wirk-) Linie wirken.
Anders beim Bleiflügelmodell (Abb.l). Hier bilden die partiellen Tragflügel-Tips der Gefiederfinger eine gebogene, (nach vorn und nach hinten aber) begrenzte Kette von Quellpunkten aus (Chain Configuration). Die Anordnung der Quellpunkte ist weniger produktiv für Nachlaufströmung und Impulsaustausch dort.
Dass die Geometrie des (Wirbel-) Erzeugendensystems einen Einfluß auf die Qualität des Wirbelspulensystems im Nachlauf der Auftrieb erzeugenden Tragfläche besitzt, spielt aber nur für denjenigen oder diejenige in der Argumentation um ein Widerstandsgebaren eine Rolle, die um ein Wirbelinduktionsgeschehen weiß oder es vermutet. Es ist aus heutiger Sicht sehr spannend zu recherchieren, welche Forschungsfragen und Forschungsergebnisse in den 1990er und 200er Jahren die Entwicklung derflugtechnisch zugelassenen und in der zivilen Luftfahrt tatsächlich kommerziell nutzbaren „Winglets" unterstützten. Grundlegend für die Erforschung des biologischen Systems ist die Arbeit von Tucker (1993)[6] Die Circe-Configuration der Gefiederfinger wird nicht erkannt. Die Modelluntersuchungen erfolgen mit Geometrien nach der ChainConfiguration. Smith and Komerath et.al.[7] veröffentlichen 2001 Ergebnisse aus Windkanalversuchen, in denen die Wirbelkerne der Mehrfach-Winglets eine Kette bilden (Chain-Configuration). Entz und Correa et al.[8] finden für den drei- fingrigen Fall eine Verbesserung der Auftrie/Widerstands-Performance von 12% bis 14% gegenüber dem geschlossenen Randbogen an einer Modell-tragfläche (Chain-Configuration). Eine numerische Analyse der 3er Konfiguration beschreibt Thimmegowda et al.[9]Ebenso (Chain-Configuration) untersuchen Sevillano et al.[10] für sehr kleine Flugaggregate. Das Wirbelsystem hinter Winglet-Konfigurationen untersuchen Zang, Wanng und Fu[11]. Ausgeführte Konstruktionen untersucht Ning und Kroo[12] und Merryisha und Rajendran[13]. Sowie vergleichend Scholz[14]. Einen experimentellen Vergleich zwischen einem einzelnen und einem Multi-Winglet zieht Balagurumurugan et al.[15] Ein numerisches Modell (Fluent) eines MonoWinglets beschreibt Abdelghany et al.[16] Vom Vogelflügel inspirierte Winglets (Chain-Configuration) untersuchen Hossain, Rahman et al.[17] Ebenfalls ausgeführte Konstruktionen untersucht Putro und Pitoyo, et.al.[18] Die letzte Veröffentlichung einer Chain-Configuration aus dem FG Bionik und Evolutionstechnik stammt von Stäche (2006)[19]. Es ist also nicht verwunderlich, den Stand der (internationalen) Wissenschaft der späten 2010er Jahre mit der Chain-Configuration des Erzeugendensystems in Verbindung zu setzen. Kürzlich veröffentlicht wurde eine Untersuchung zu aus der Biologie inspirierten Multi-Winglets von Yussof et al. (2022)[20] mit einer 7-zähligen Auffingerung am Randbogen einer Modelltragfläche, ebenfalls in Chain-Configuration.
Zum Stand der Wissenschaft (2023). Bislang und heute kennen wir die spezifische Impulswirksamkeit nurvon den wenigen Wirbelstrukturen, die unter genau dieser Fragestellung in Windkanälen vermessen wurden. Auch wissen wir nicht, ob die fluidmechanischen Effekte skalierbar sind. Was wir beobachten ist, dass die Impulsinduktion Lagrange kohärenter Wirbelfäden in das Strömungsfeld kumula
tiv ist und damit ein konservatives Phänomen zu sein scheint. Vulgär ausgedrückt: „das Feld sammelt ein“; oder: „wir laden das Feld auf, pumpen es voll“!
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.2: Präparat des Storchenflügels (Adebar) im Windkanal unter Strömungslast. Quellpunkte an den der Gefiederfinger-Tips sind gelb markiert.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Gegenstand der Recherche "Die erkaltete Spur"?
Die Recherche befasst sich mit einem Aspekt des Vogelflugs, insbesondere der fluidmechanischen Wirbelspule, die beim Segelflug von Landseglern auftritt. Es geht um Messprotokolle, Studien- und Diplomarbeiten aus den 80er und 90er Jahren der Technischen Universität Berlin, die sich mit Experimenten an Windkanälen befassten.
Warum ist das Wissen über fluidmechanische Wirbelspulen verloren gegangen?
Das Dokument argumentiert, dass Wissen flüchtig sein kann und oft vernachlässigt wird. Der Verlust des Wissens über Wirbelspulen wird auf mangelnde Bildung und die Organisation von Wissensbeständen zurückgeführt, die durch historische Räume begrenzt sind.
Was geschah mit dem Nachlass von Professor Ingo Rechenberg?
<Nach dem Tod von Professor Ingo Rechenberg im Jahr 2021 verschwand sein wissenschaftlicher Nachlass, der Akten, Bücher, Bildmaterial und Exponate umfasste, unglücklicherweise und vorbei am Archiv der Technischen Universität.
Warum ist das Interesse an der Erforschung von Wirbelspulen heute gering?
Das Dokument stellt fest, dass im aktuellen Forschungsfeld der 20er Jahre kein großes Interesse an der Erforschung von Induktionsprozessen und niedrigenergetischen Vorgängen nahe Vogelflügeln besteht.
Was sind Lagrange-kohärente Wirbelsysteme und wo wurden sie zuerst beobachtet?
Lagrange-kohärente Wirbelsysteme sind in der Strömungsmechanik noch nicht allgemeingültig definiert. Die ersten Beschreibungen beziehen sich auf Laborexperimente am Windkanal und Beobachtungen des Wirbelgeschehens um geometrisch gestaffeltes Gefieder, insbesondere der Auffingerung der Tragflügelfittiche landsegelnder Vögel.
Was war das Ergebnis der Optimierung eines geschlitzten Bleiflügels im Windkanal?
Mit einer Optimierungsstrategie konnte die Gleitzahl eines geschlitzten und aufgefingerten Bleiflügels gegenüber seiner kompakten Anfangsgeometrie um etwa 10% verbessert werden.
Worin unterscheidet sich die Auffächerung des biologischen Gefieders von artifiziellen Nachbauten?
Beim biologischen Flügel bilden die "Quellpunkte" der im Nachlauf herleitbaren Wirbelstruktur eine geschlossene geometrische Figur (Ellipse oder Kreis), was zu einem geordneten Impulsaustausch führt. Artifizielle Modelle weisen oft eine gebogene, begrenzte Kette von Quellpunkten auf (Chain Configuration), die weniger produktiv für den Impulsaustausch ist.
Welche Konfigurationen von Winglets werden hauptsächlich in der Forschung untersucht?
Der Text hebt hervor, dass die meisten Forschungsarbeiten und Entwicklungen von Winglets sich auf die "Chain-Configuration" der Wirbelquellen konzentrieren und nicht auf die "Circe-Configuration", die im biologischen Gefieder beobachtet wird.
Was ist der aktuelle Stand der Forschung zu Wirbelstrukturen (Stand 2023)?
Derzeit ist die spezifische Impulswirksamkeit von Wirbelstrukturen nur von wenigen Strukturen bekannt, die unter dieser Fragestellung in Windkanälen vermessen wurden. Es ist unklar, ob die fluidmechanischen Effekte skalierbar sind, aber es wird vermutet, dass die Impulsinduktion Lagrange-kohärenter Wirbelfäden kumulativ ist.
- Quote paper
- Michel Felgenhauer (Author), 2023, Fluidmechanische Wirbelspulen biologischer Flieger. GlobalMode7 Vortex Coils, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1356573