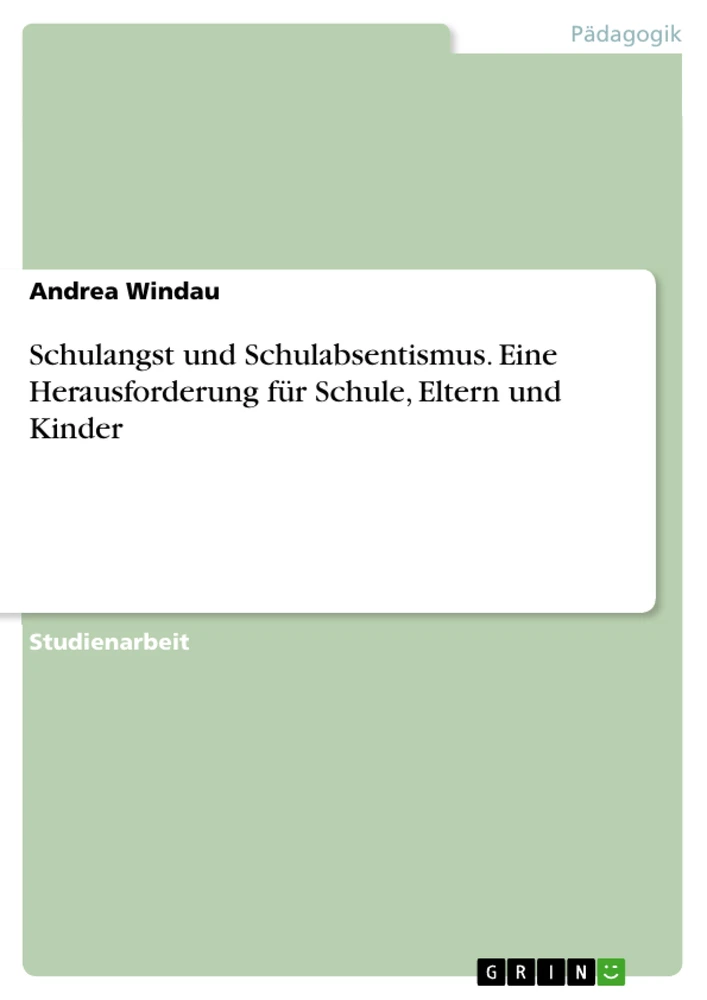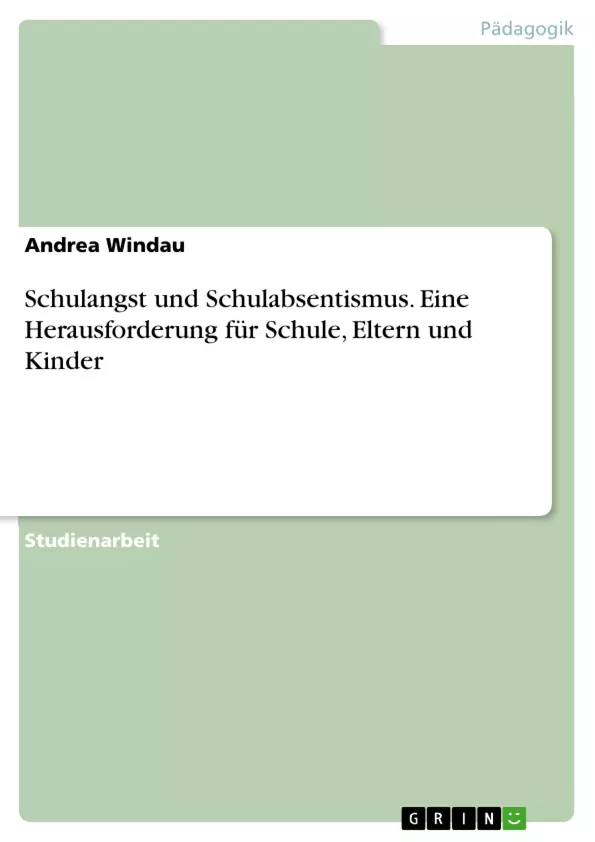Diese Hausarbeit behandelt das Thema "Schulangst und Schulabsentismus" und beschäftigt sich mit den Herausforderungen, die für die Schule, die Eltern und bei den Kindern assoziiert werden.
Im Rahmen eines Praktikums beim schulpsychologischen Dienst wurde die Relevanz des Phänomens des Schulabsentismus als Problem deutlich. Die Gründe für Schulabsentismus sind multifaktoriell. Das Elternhaus als auch die Schule können Auslöser sein. In diesem komplexen Zusammenspiel liegen die Herausforderungen für die Interessengruppen, um mit einem Maßnahmenplan Verhaltensänderungen zu bewirken. Daraus ergeben sich folgende Forschungsfragen: Wie können notwendige Verhaltensänderungen bestimmt werden? Welche Herausforderungen ergeben sich für die Interessengruppen hinsichtlich der Umsetzung eines Maßnahmenplans?
Die Beantwortung erfolgt basierend auf einem im Praktikum erlebten Fallbeispiels. Die vorliegende angstbedingte Schulverweigerung wird anhand des S-O-R-K-C Modells nach Kanfer und Saslow aufgezeigt. Dabei werden auslösende und aufrechterhaltende Faktoren betrachtet. Für das Ziel der Reduzierung der Absentismusquote an Schulen ist ein koordiniertes Vorgehen der Interessengruppen erforderlich sowie ein abgestimmter Maßnahmenplan, um die Verhaltensänderungen aller Beteiligten zu erreichen. Die zur Hilfenahme von multiprofessionellen Teams ist erforderlich.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Inhaltsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Formen von Schulabsentismus
- 2.1 Schulschwänzen
- 2.2 Angstbedingtes Meidungsverhalten
- 2.3 Zurückhalten
- 3 Erscheinungsformen von Angst im schulischen Bereich
- 3.1 Trennungsangst
- 3.2 Mobbing/Gewalt
- 3.3 Lehrerangst
- 3.4 Versagensangst
- 3.5 Soziale Angst
- 4 Das SORKC-Modell nach Kanfer und Saslow
- 4.1 Erklärung des SORKC-Modells
- 4.2 Mikroanalyse von Verhalten anhand des SORKC-Modells
- 5 Auslösende und aufrechterhaltende Parameter der Schulvermeidung anhand eines konkreten Fallbeispiels
- 5.1 Darstellung des Fallbeispiels
- 5.2 Hauptschwierigkeiten und Bedingungsanalyse
- 6 Die Herausforderungen
- 6.1 Die besondere Herausforderung für Eltern
- 6.2 Die besondere Herausforderung für Lehrer und Schule
- 6.3 Die besondere Herausforderung für den Schüler selbst
- 7 Interventionsmaßnahmen
- 7.1 Maßnahmen der Schule
- 7.2 Maßnahmen der Eltern
- 7.3 Rechtliche Maßnahmen
- 7.4 Maßnahmen außerschulischer Dienste
- 8 Fazit und Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beleuchtet das komplexe Phänomen von Schulangst und Schulabsentismus und untersucht die Herausforderungen, die sich für Schule, Eltern und Kinder daraus ergeben. Der Fokus liegt auf der Analyse des Problems aus verschiedenen Perspektiven und der Entwicklung von Maßnahmen, die zu einer Reduzierung des Schulabsentismus beitragen können.
- Ursachen und Erscheinungsformen von Schulabsentismus
- Die Rolle von Angst als Auslöser für Schulverweigerung
- Das SORKC-Modell als Instrument zur Analyse von Verhalten im Kontext von Schulangst
- Herausforderungen für Schule, Eltern und Kinder im Umgang mit Schulabsentismus
- Mögliche Interventionsmaßnahmen zur Reduzierung von Schulabsentismus
Zusammenfassung der Kapitel
Die Hausarbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Thema Schulabsentismus einführt und die Relevanz der Thematik im Kontext der schulpsychologischen Praxis deutlich macht. Im zweiten Kapitel werden verschiedene Formen von Schulabsentismus, wie Schulschwänzen, angstbedingtes Meidungsverhalten und Zurückhalten, näher betrachtet. Kapitel drei befasst sich mit den Erscheinungsformen von Angst im schulischen Bereich, darunter Trennungsangst, Mobbing/Gewalt, Lehrerangst, Versagensangst und soziale Angst. Das vierte Kapitel stellt das SORKC-Modell nach Kanfer und Saslow vor, ein Instrument zur Analyse von Verhalten und zur Identifizierung von auslösenden und aufrechterhaltenden Faktoren.
Im fünften Kapitel wird das SORKC-Modell auf ein konkretes Fallbeispiel angewendet, um die auslösenden und aufrechterhaltenden Parameter der Schulvermeidung zu analysieren. Das sechste Kapitel beleuchtet die Herausforderungen, die sich im Umgang mit Schulabsentismus für Eltern, Lehrer und Schüler selbst ergeben. Im siebten Kapitel werden verschiedene Interventionsmaßnahmen, die von der Schule, den Eltern, den Behörden und außerschulischen Diensten ergriffen werden können, vorgestellt. Die Hausarbeit schließt mit einem Fazit und einer Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse.
Schlüsselwörter
Schulangst, Schulabsentismus, Angstbedingtes Meidungsverhalten, SORKC-Modell, Interventionsmaßnahmen, Schulverweigerung, Eltern, Lehrer, Schüler, Schulpsychologie.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die häufigsten Formen von Schulabsentismus?
Zu den Hauptformen zählen das klassische Schulschwänzen, angstbedingtes Meidungsverhalten (Schulangst) sowie das Zurückhalten durch die Eltern.
Welche Arten von Ängsten führen zu Schulvermeidung?
Häufige Ursachen sind Trennungsangst, soziale Ängste, Versagensangst, Lehrerangst sowie Ängste aufgrund von Mobbing oder Gewalt in der Schule.
Was ist das SORKC-Modell in Bezug auf Schulangst?
Das SORKC-Modell nach Kanfer und Saslow ist ein verhaltenstherapeutisches Instrument zur Mikroanalyse von Verhalten. Es hilft dabei, auslösende und aufrechterhaltende Faktoren der Schulvermeidung zu identifizieren.
Welche Herausforderungen ergeben sich für Eltern bei Schulabsentismus?
Eltern stehen vor der schwierigen Aufgabe, zwischen echtem Leiden und Vermeidungsstrategien zu unterscheiden und müssen oft komplexe Maßnahmenpläne in Kooperation mit der Schule umsetzen.
Welche Maßnahmen können Schulen gegen Absentismus ergreifen?
Schulen können durch multiprofessionelle Teams, frühzeitige Interventionspläne, pädagogische Unterstützung und eine enge Zusammenarbeit mit dem schulpsychologischen Dienst reagieren.
- Arbeit zitieren
- Andrea Windau (Autor:in), 2023, Schulangst und Schulabsentismus. Eine Herausforderung für Schule, Eltern und Kinder, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1358581