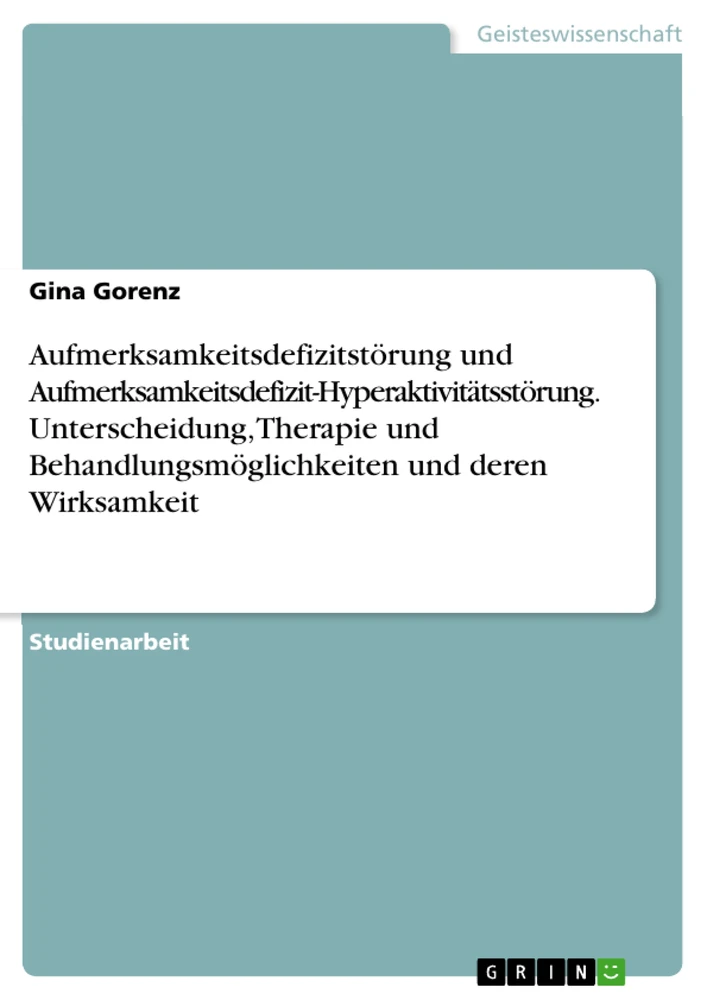In dieser Hausarbeit soll ein besseres Verständnis für das Thema der Aufmerksamkeitsdefizitstörung vermittelt werden und dabei verschiedene Bereiche rund um die Störung betrachten. Dabei steht im Fokus der Bearbeitung die zu beantwortende Hypothese, ob Ritalin ein wirksames Mittel gegen die Symptome von ADHS ist und ob alternative Behandlungsmethoden sinnvoll eingesetzt werden können.
Zu Beginn dieser Arbeit wird für das allgemeine Verständnis ein theoretischer Einblick in den Begriff "Aufmerksamkeit" in Kapitel 2 gegeben. Im anschließenden Kapitel wird auf die Aufmerksamkeitsstörung näher eingegangen und die verschiedenen Störungsbilder aufgezeigt. Das Kapitel 4 beschreibt das Krankheitsbild des Aufmerksamkeitsdefizitsyndroms allgemein, sowie aus neurobiologischer Sicht welche Abläufe im Organismus unter dieser Störung ablaufen. Weiterhin behandelt das Kapitel die Symptome und Begleiterkrankungen (Komorbiditäten) und gibt Aufschluss über den Unterschied von ADS und ADHS. Anlehnend daran werden in Kapitel 5 verschiedene Therapieformen und Behandlungsmöglichkeiten genannt. Das Ende dieser wissenschaftlichen Arbeit bilden die Kapitel 6 und 7, wobei die kritische Diskussion über die Wirksamkeit der Behandlungsmethoden, sowie der Umgang der Krankheit aus verschiedenen Sichtweisen sowie die Einordnung der Störung in das Spektrum der Aufmerksamkeitsstörungen in Kapitel 6 erfolgt und das abschließende Fazit in Kapitel 7 und die Beantwortung auf die Hypothese.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Aufmerksamkeit
- 2.1 Aufmerksamkeitsselektivität
- 2.1.1 Filtertheorie
- 2.1.2 Attenuationstheorie
- 2.1.3 Theorie der späten Auswahl
- 2.1.4 Visuelle Aufmerksamkeit
- 2.2 Sakkadische Bewegungen
- 2.1 Aufmerksamkeitsselektivität
- 3. Aufmerksamkeitsstörungen
- 3.1 Störungsbilder der Aufmerksamkeit
- 3.1.1 Intensitätsdimension
- 3.1.2 Selektionsdimension
- 3.1.3 Orientierungsdimension
- 3.1 Störungsbilder der Aufmerksamkeit
- 4. Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom
- 4.1 Begriffserläuterung
- 4.2 Neurobiologischer Vorgang im Gehirn
- 4.3 Symptome und Komorbiditäten
- 4.4 Unterschied ADS und ADHS
- 5. Therapien und Behandlungsmöglichkeiten
- 5.1 Medikation
- 5.2 Meditation
- 5.3 Sport
- 5.4 Hirnstimulation
- 6. Diskussion
- 6.1 Wirksamkeit der Therapiebehandlungen
- 6.2 Umgang mit der Krankheit aus verschiedenen Sichtweisen
- 7. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis von Aufmerksamkeitsdefizitstörungen zu vermitteln. Die Arbeit untersucht verschiedene Aspekte der Störung, von den theoretischen Grundlagen der Aufmerksamkeit bis hin zu den Behandlungsmöglichkeiten. Die zentrale Forschungsfrage befasst sich mit der Wirksamkeit von Ritalin und alternativen Therapieansätzen bei ADHS.
- Theoretische Grundlagen der Aufmerksamkeit
- Verschiedene Störungsbilder der Aufmerksamkeit
- Neurobiologische Aspekte des Aufmerksamkeitsdefizitsyndroms
- Symptome, Komorbiditäten und der Unterschied zwischen ADS und ADHS
- Therapiemöglichkeiten und deren Wirksamkeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Aufmerksamkeitsdefizitstörung ein und skizziert den Aufbau der Hausarbeit. Sie formuliert die zentrale Forschungsfrage nach der Wirksamkeit von Ritalin und alternativen Behandlungsmethoden bei ADHS. Die Einleitung verweist auf die Bedeutung eines ganzheitlichen Verständnisses der Störung.
2. Aufmerksamkeit: Dieses Kapitel liefert eine theoretische Grundlage, indem es verschiedene Aspekte der Aufmerksamkeit beleuchtet. Es werden Theorien der Aufmerksamkeitsselektivität (Filter-, Attenuations- und Theorie der späten Auswahl) und die visuelle Aufmerksamkeit diskutiert. Der Abschnitt zu sakkadischen Bewegungen erweitert das Verständnis der aufmerksamkeitsbezogenen Prozesse. Insgesamt bietet dieses Kapitel ein fundiertes Verständnis der kognitiven Mechanismen der Aufmerksamkeit, die für das spätere Verständnis der Störung essentiell sind.
3. Aufmerksamkeitsstörungen: Kapitel 3 beschreibt verschiedene Störungsbilder der Aufmerksamkeit, indem es diese nach Intensität, Selektion und Orientierung differenziert. Es legt somit ein breiteres Verständnis des Spektrums von Aufmerksamkeitsstörungen dar und bildet so die Grundlage für das tiefere Verständnis der ADHS im darauffolgenden Kapitel. Die Differenzierung der Störungsbilder ermöglicht ein differenziertes Verständnis der verschiedenen Ausprägungen von Aufmerksamkeitsstörungen.
4. Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom: Dieses Kapitel definiert das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (ADS/ADHS), beleuchtet seine neurobiologischen Grundlagen und beschreibt die Symptome sowie Komorbiditäten. Es differenziert zwischen ADS und ADHS. Die neurobiologischen Ausführungen liefern einen wichtigen Kontext für das Verständnis der Entstehung und des Verlaufs der Störung. Der Fokus auf Symptome und Komorbiditäten trägt zum Verständnis der vielschichtigen Auswirkungen von ADS/ADHS bei.
5. Therapien und Behandlungsmöglichkeiten: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Therapien und Behandlungsmöglichkeiten für ADS/ADHS, darunter Medikation, Meditation, Sport und Hirnstimulation. Der Überblick über verschiedene Ansätze zeigt die Vielseitigkeit der Behandlungsmethoden auf und unterstreicht die Bedeutung eines ganzheitlichen Therapieansatzes, der auf die individuellen Bedürfnisse des Patienten zugeschnitten ist. Die Erwähnung von alternativen Methoden neben der Medikation erweitert den Blick auf die Behandlungsmöglichkeiten.
Schlüsselwörter
Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (ADS), Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS), Aufmerksamkeitsstörung, Neurobiologie, Symptome, Komorbiditäten, Therapien, Medikation, alternative Behandlungsmethoden, Ritalin, Wirksamkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Aufmerksamkeitsdefizitstörungen
Was ist der Inhalt dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit befasst sich umfassend mit Aufmerksamkeitsdefizitstörungen (ADS/ADHS). Sie behandelt die theoretischen Grundlagen der Aufmerksamkeit, verschiedene Störungsbilder, die neurobiologischen Aspekte von ADS/ADHS, Symptome, Komorbiditäten, den Unterschied zwischen ADS und ADHS sowie verschiedene Therapiemöglichkeiten und deren Wirksamkeit. Ein besonderer Fokus liegt auf der Wirksamkeit von Ritalin und alternativen Therapieansätzen.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit deckt ein breites Spektrum an Themen ab, darunter: Theorien der Aufmerksamkeitsselektivität (Filter-, Attenuations- und Theorie der späten Auswahl), visuelle Aufmerksamkeit, sakkadische Bewegungen, verschiedene Störungsbilder der Aufmerksamkeit (nach Intensität, Selektion und Orientierung), Neurobiologie von ADS/ADHS, Symptome und Komorbiditäten von ADS/ADHS, der Unterschied zwischen ADS und ADHS, verschiedene Therapiemöglichkeiten (Medikation, Meditation, Sport, Hirnstimulation) und deren Wirksamkeit, sowie ein Vergleich der Wirksamkeit von Ritalin und alternativen Behandlungsmethoden.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit ist in sieben Kapitel gegliedert: Einleitung, Aufmerksamkeit (inkl. Aufmerksamkeitsselektivität und sakkadische Bewegungen), Aufmerksamkeitsstörungen, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (ADS/ADHS), Therapien und Behandlungsmöglichkeiten, Diskussion (Wirksamkeit der Therapien und verschiedene Perspektiven auf den Umgang mit der Krankheit) und Fazit/Ausblick.
Welche Forschungsfrage wird in der Hausarbeit untersucht?
Die zentrale Forschungsfrage der Hausarbeit befasst sich mit der Wirksamkeit von Ritalin und alternativen Therapieansätzen bei ADHS.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (ADS), Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS), Aufmerksamkeitsstörung, Neurobiologie, Symptome, Komorbiditäten, Therapien, Medikation, alternative Behandlungsmethoden, Ritalin, Wirksamkeit.
Welche Theorien der Aufmerksamkeit werden behandelt?
Die Hausarbeit behandelt die Filtertheorie, die Attenuationstheorie und die Theorie der späten Auswahl im Kontext der Aufmerksamkeitsselektivität.
Wie werden Aufmerksamkeitsstörungen in der Hausarbeit kategorisiert?
Aufmerksamkeitsstörungen werden nach Intensitäts-, Selektions- und Orientierungsdimension differenziert.
Welche Therapieansätze werden für ADS/ADHS diskutiert?
Die Hausarbeit diskutiert Medikation (z.B. Ritalin), Meditation, Sport und Hirnstimulation als Therapieansätze für ADS/ADHS.
Was ist der Unterschied zwischen ADS und ADHS?
Die Hausarbeit beschreibt den Unterschied zwischen ADS und ADHS, geht aber nicht detailliert auf die spezifischen Kriterien ein. Diese Information muss aus dem Haupttext der Hausarbeit selbst entnommen werden.
- Quote paper
- Gina Gorenz (Author), 2019, Aufmerksamkeitsdefizitstörung und Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Unterscheidung, Therapie und Behandlungsmöglichkeiten und deren Wirksamkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1358745