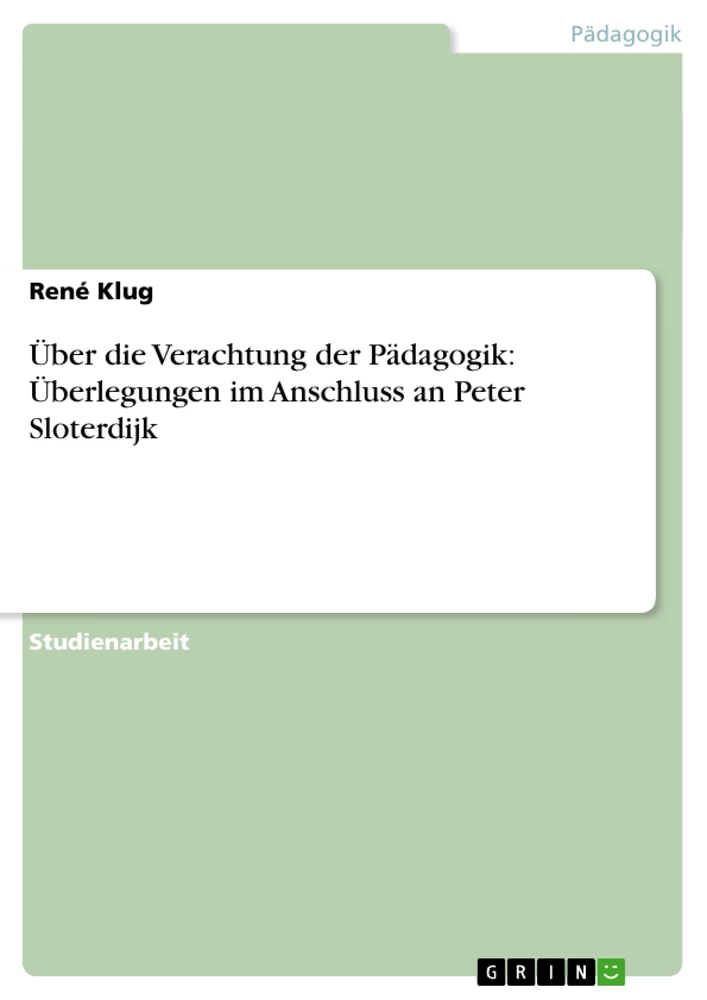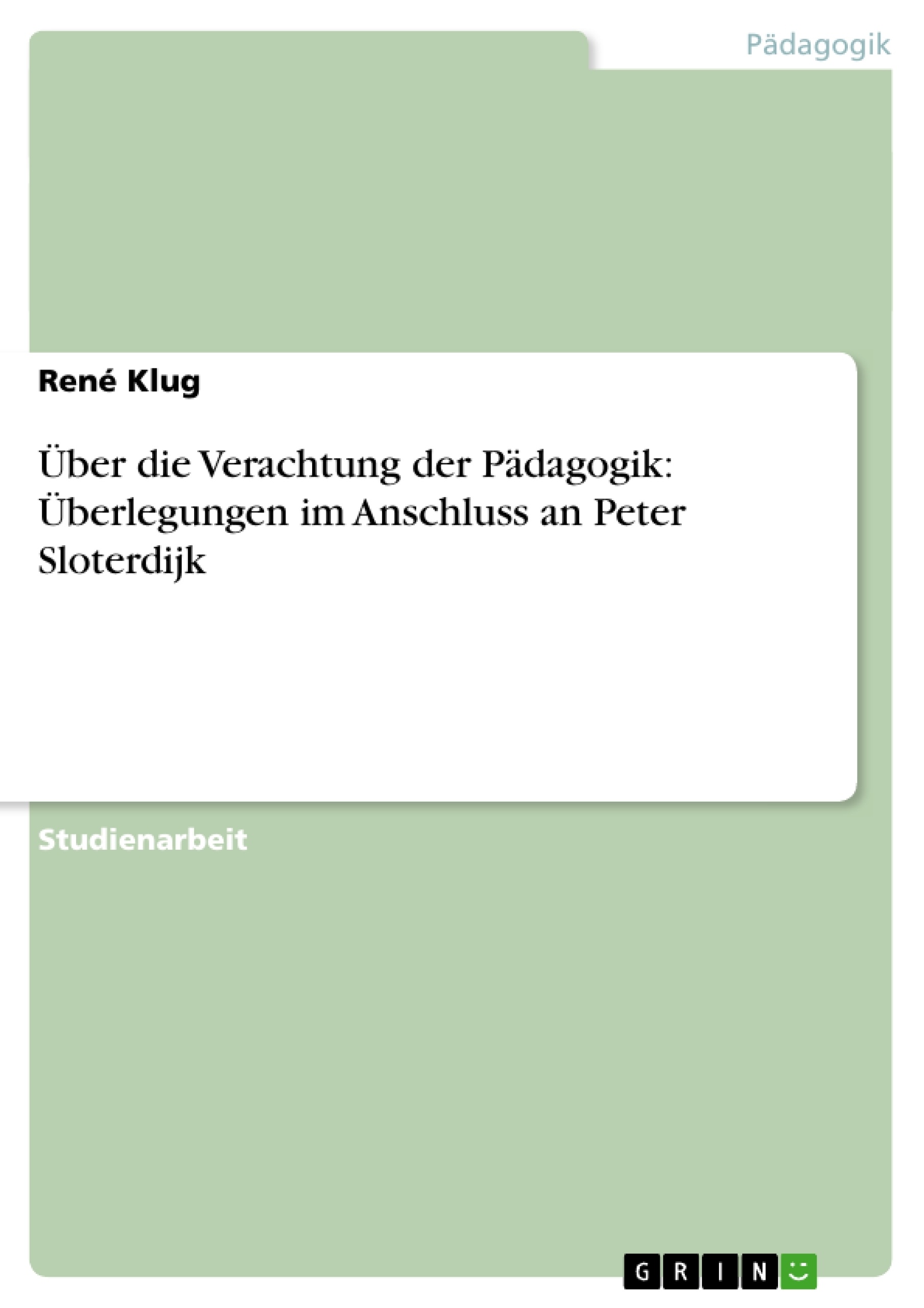Den Ausgangspunkt dieser Arbeit bildet der von Norbert Ricken in seinem Aufsatz
‚Über die Verachtung der Pädagogik. Eine Einführung’ (2007) diagnostizierte Umstand,
wonach
„trotz aller Beschwörungen und ‚Hochglanz’-Beteuerungen, dass Bildung – und mit ihr die Pädagogik
insgesamt – gesellschaftlich nicht nur unverzichtbar, sondern überhaupt wichtiger
denn je sei, […] sich doch in der Öffentlichkeit hartnäckig eine weithin negative Einschätzung
eben dieser Pädagogik [hält]“ (Ricken 2007: 15).
Ricken gibt in seinem Aufsatz bereits einige wertvolle Hinweise, welche Motive für
eben diese Verachtung der Pädagogik als ursächlich anzusehen sind. Ich möchte im
Folgenden auf zwei dieser Hinweise näher eingehen, um daran Überlegungen des
Philosophen, Kulturwissenschaftlers und Essayisten Peter Sloterdijk anzuschließen.
Insbesondere werde ich mich dabei auf die Verachtung, die dem pädagogischen Beruf
des Lehrers entgegengebracht wird, konzentrieren. Aus Sloterdijks Sicht ist dem
Lehrerberuf als einer ‚strukturellen Überforderungsfalle’ nur durch eine entsprechende
Kritik zu helfen: „Die Analyse von berufsspezifischen Kränkungen und Erfahrungen
des Scheiterns ist so nötig wie die Analyse des Ressentiments gegen den
Beruf. Das wäre Aufklärung der wertvollsten Art.“ (Sloterdijk 2001: 43) An einer
solchen Form von Aufklärung möchte diese Arbeit mithelfen.
Zu diesem Zweck werde ich zunächst dem Hinweis Rickens auf den von Theodor W.
Adorno in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gehaltenen Vortrag ‚Tabus
über dem Lehrberuf’ folgen. In dieser Rede spricht Adorno u. a. vom Lehrer als
‚Krüppel’, dem „ein gewisses Aroma des gesellschaftlich nicht ganz Vollgenommenen“
(Adorno 1993: 71) anhafte. Diese Vorstellung Adornos vom Lehrer als seelischem
Krüppel erweist sich als anschlussfähig für Sloterdijks Überlegungen in dessen
aktuellem Buch ‚Du musst dein Leben ändern. Über Anthropotechnik’ (2009),
wonach das ‚Krüppeltum’ nicht nur den modus vivendi des Lehrers, sondern ausnahmslos
aller Menschen bestimme. Wie ich versuchen werde zu zeigen, liegt bereits
in der bloßen Akzeptanz dieser These eine Möglichkeit zur Emanzipation von der
von vielen Lehrern empfundenen Hilflosigkeit sowie einer gewissen selbstbemitleidenden
Haltung, welche von der Öffentlichkeit als Anlass für Verachtung gegenüber
dem Beruf des Lehrers genommen wird. [...]
Inhaltsverzeichnis
1. EINLEITUNG
2. DER LEHRER ALS SEELISCHER KRÜPPEL
3. PÄDAGOGIK UND ZYNISMUS
3.1 KRITIK DER ZYNISCHEN VERNUNFT
3.2 ANTIKE PHILOSOPHIE DER FRECHHEIT: KYNISMUS
3.3 DIOGENES VON SINOPE
3.3.1. Diogenes und Alexander der Große
3.3.2. Die Laternen-Anekdote
3.3.3. Der Philosoph in der Tonne
3.3.4. Diogenes der Schamlose
3.4 DIE MODERNE GESELLSCHAFTLICHE SCHIZOPHRENIE
4. FAZIT: UNTHANS UND DIOGENES’ LEKTION
5. LITERATURVERZEICHNIS
1. Einleitung
Den Ausgangspunkt dieser Arbeit bildet der von Norbert Ricken in seinem Aufsatz ‚Über die Verachtung der Pädagogik. Eine Einführung’ (2007) diagnostizierte Um-stand, wonach „trotz aller Beschwörungen und ‚Hochglanz’-Beteuerungen, dass Bildung – und mit ihr die Pä-dagogik insgesamt – gesellschaftlich nicht nur unverzichtbar, sondern überhaupt wichtiger denn je sei, [...] sich doch in der Öffentlichkeit hartnäckig eine weithin negative Einschätzung eben dieser Pädagogik [hält]“ (Ricken 2007: 15).
Ricken gibt in seinem Aufsatz bereits einige wertvolle Hinweise, welche Motive für eben diese Verachtung der Pädagogik als ursächlich anzusehen sind. Ich möchte im Folgenden auf zwei dieser Hinweise näher eingehen, um daran Überlegungen des Philosophen, Kulturwissenschaftlers und Essayisten Peter Sloterdijk anzuschließen. Insbesondere werde ich mich dabei auf die Verachtung, die dem pädagogischen Be-ruf des Lehrers entgegengebracht wird, konzentrieren. Aus Sloterdijks Sicht ist dem Lehrerberuf als einer ‚strukturellen Überforderungsfalle’ nur durch eine entspre-chende Kritik zu helfen: „Die Analyse von berufsspezifischen Kränkungen und Er-fahrungen des Scheiterns ist so nötig wie die Analyse des Ressentiments gegen den Beruf. Das wäre Aufklärung der wertvollsten Art.“ (Sloterdijk 2001: 43) An einer solchen Form von Aufklärung möchte diese Arbeit mithelfen.
Zu diesem Zweck werde ich zunächst dem Hinweis Rickens auf den von Theodor W. Adorno in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gehaltenen Vortrag ‚Tabus über dem Lehrberuf’ folgen. In dieser Rede spricht Adorno u. a. vom Lehrer als ‚Krüppel’, dem „ein gewisses Aroma des gesellschaftlich nicht ganz Vollgenomme-nen“ (Adorno 1993: 71) anhafte. Diese Vorstellung Adornos vom Lehrer als seeli-schem Krüppel erweist sich als anschlussfähig für Sloterdijks Überlegungen in des-sen aktuellem Buch ‚Du musst dein Leben ändern. Über Anthropotechnik’ (2009), wonach das ‚Krüppeltum’ nicht nur den modus vivendi des Lehrers, sondern aus-nahmslos aller Menschen bestimme. Wie ich versuchen werde zu zeigen, liegt bereits in der bloßen Akzeptanz dieser These eine Möglichkeit zur Emanzipation von der von vielen Lehrern empfundenen Hilflosigkeit sowie einer gewissen selbstbemitlei-denden Haltung, welche von der Öffentlichkeit als Anlass für Verachtung gegenüber dem Beruf des Lehrers genommen wird.1
In einem zweiten Schritt geht es dann um die Verachtung der Pädagogik insgesamt. Hierzu werde ich den Verweis Rickens auf den paradoxen Zusammenhang bzw. die „offensichtliche Diskrepanz zwischen gesellschaftlich Erforderlichem und dem pä-dagogisch Wünsch- und vielleicht auch Verantwortbaren“ (Ricken 2007: 18 f.) auf-greifen. In diesem Zusammenhang stellt Ricken heraus, dass die Erziehungswissen-schaft, würde sie Eigenschaften wie Eigennutz, Rücksichtslosigkeit und bewusster Vorteilnahme – also ausnahmslos Dinge, ohne die man in der modernen, (neolibera-len) kapitalistischen Gesellschaft nicht mehr auszukommen scheint – ausdrücklich zu pädagogischen Lernzielen erheben, schlicht zynisch sei (vgl. Ricken 2007: 18). Unter Rückgriff auf Peter Sloterdijks erstes Hauptwerk ‚Kritik der zynischen Vernunft’ (1983) werde ich versuchen, die Entstehung dieser offensichtlichen Dichotomie zwi-schen den Erfordernissen der Gesellschaft und den ‚Wünschen’ der Pädagogik im Sinne einer Nichtidentität von Leben und Einsicht zu interpretieren. So könnte eine Rückbesinnung auf eine philosophische Haltung, wie sie im antiken Kynismus be-stand, in der Leben und Einsicht in Form der Verkörperungsregel noch untrennbar zusammen standen, einen Ansatz zur Überwindung der modernen gesellschaftlichen ‚Schizophrenie’ bieten.
Ein abschließendes Fazit dient der Diskussion, inwiefern die zuvor dargestellten Überlegungen konkret dazu genutzt werden können, um der Verachtung der Pädago-gik zu begegnen.
2. Der Lehrer als seelischer Krüppel
In seinem 1965 gehaltenen Vortrag ‚Tabus über dem Lehrberuf’ versucht Theodor W. Adorno diverse Abneigungen bzw. Verächtlichkeiten gegenüber dem Beruf des Lehrers darzulegen, wobei er die disziplinäre Funktion als die zentrale Dimension, aus welcher die Verachtung des Berufs sich seiner Auffassung nach speist, heraus-stellt. Hinter dem negativen Bild des Lehrers, der die Disziplinarmacht im Sinne Michel Foucaults gewissermaßen in seiner Person verkörpert, stehe letztlich – so Adorno – die Vorstellung des „Prüglers“ (Adorno 1993: 76), d. h. also des Lehrers als dem „physisch Stärkeren, der den Schwächeren schlägt“ (ebd.). Auch wenn die Licht von Benachteiligungen zu beschreiben, ist inzwischen so stark, dass schon junge Leute dieses rentnerhafte, resignierte Verhalten [...] wie eine neue Selbstverständlichkeit entwickelt haben.“ (Slo-terdijk 2001: 44)
Prügelstrafe längst abgeschafft worden sei, so vererbe sich das Bild vom Lehrer als „Kerkermeister“ (ebd.: 77) oder militärischen „Unteroffizier“ (ebd.) doch unbewusst weiter. Entscheidend für meine folgenden Überlegungen ist in diesem Zusammen-hang die nachstehende Bemerkung Adornos:
„Soldatisch klingt jenes Wort Steißtrommler; unbewusst werden Lehrer vielleicht wie jene Ve-teranen als eine Art von Krüppeln vorgestellt, als Menschen, die innerhalb des eigentlichen Lebens, des realen Reproduktionsprozesses der Gesellschaft keine Funktion haben, sondern nur auf eine schwer durchsichtige Weise und auf dem Weg ihnen erwiesener Gnade dazu bei-tragen, dass das Ganze und ihr eigenes Leben irgendwie weitergehe.“ (Hervorh. R. K.) (ebd.: 77 f.)
Der Lehrer wird demnach laut Adorno verachtet, weil er als ‚seelischer Krüppel’ am allerwenigsten dazu in der Lage erscheint, den Nachwuchs ‚zum Leben’ zu erziehen. Aus meiner Sicht muss der Begriff des Krüppels hier tatsächlich wörtlich genommen werden, denn wie Norbert Ricken zeigt, wird seit geraumer Zeit im Rahmen neuer Professionalisierungsstrategien des Lehrerberufs der Versuch unternommen, den Lehrer in Schutz zu nehmen, indem immer wieder die „enormen zeitlichen, sozialen und vor allem psychischen Belastungen“ (Ricken 2007: 17) des Lehramts betont werden, „mit dem allerdings fatalen Effekt, dass insbesondere mit Verweis auf gesundheitliche Risiken und Frühpensionierungsraten des Lehrerberufs diese nun nicht mehr nur als ‚faule Säcke’ – wie Gerhard Schröder einst urteilte –, sondern zunehmend auch als ‚arme Schweine’ gelten [...].“ (Hervorh. R. K.) (ebd.)
Diese Form von Mitleid, welche den Pädagogen von außen entgegengebracht wird, resultiert intern auf Seiten des Lehrers schließlich in einem Gefühl von Selbstmitleid, welches dann in der Schule in einer bestimmten Weise – häufig in Form einer zyni-schen Grundhaltung des Lehrers – kompensiert wird: „Ihr werdet euch noch wun-dern, und ich bin der, der es euch noch zeigen wird. [...] Ich selbst wundere mich schon lange nicht mehr.“ (Sloterdijk 2001: 43) Sloterdijk bezeichnet diese Haltung mit dem Begriff „Entmutigungsdidaktik“ (ebd.), die (oft unbewusst) das eigene Scheitern oder das Selbstmitleid des Lehrers auf die Schüler überträgt, die darauf wiederum mit Verachtung reagieren.
In seinem Buch ‚Du musst dein Leben ändern. Über Anthropotechnik’ (2009) macht Sloterdijk auf die zunächst „ungewohnte Konvergenz von Mensch und Krüppel in den Diskursen der Generation nach Nietzsche“ (ebd.: 69) aufmerksam, wonach nun nicht nur – wie bei Adorno – der Lehrer, sondern ausnahmslos alle Menschen auf verschiedene Weisen als Krüppel erscheinen, „gleichgültig, ob man wie die Psychoanalyse vom Menschen als Hilflosigkeitskrüppel spricht, der seine Ziele nur erhinken kann, ob man ihn wie Bolk und Gehlen für einen neotenischen2 Krüppel hält, dessen chronische Unerwachsenheit nur durch starre Kulturhüllen kompensierbar ist, oder wie Plessner für einen exzentrischen Krüppel, der chronisch neben sich steht und sich leben sieht, oder wie Sartre und Blumenberg als Sichtbarkeitskrüppel, der sich zeitlebens einen Reim auf den Nachteil, gesehen zu werden, machen muss.“ (ebd.: 97)
Demnach wäre der Lehrer als seelischer Krüppel keine Besonderheit, sondern genau-so ein Mängelwesen (Arnold Gehlen, Johann Gottfried Herder) wie alle anderen Menschen auch. Weil der Lehrer mit seiner ‚Behinderung’ also keineswegs alleine dasteht, so gäbe es im Grunde genommen keinen Anlass dem Selbstmitleid zu verfal-len, wie es weiter oben angedeutet wurde. Die Ursache dafür, dass der Lehrer sich dennoch als Außenseiter fühlen muss, liegt in der von Norbert Ricken festgestellten Haltung einer Gesellschaft, „die auf Souveränität qua Kenner- und Könnerschaft setzt“ (Ricken 2007: 37), in der für Behinderungen jeglicher Art kein Platz ist,3 schon gar nicht in der Person des Lehrers, der diese Haltung der Souveränität der nächsten Generation gewissermaßen vorzuleben hat.4
In Carl Herrmann Unthan, einem Armlosen, der 1925 das – unter Verwendung eines Griffels mit dem Fuß auf einer Schreibmaschine abgetippte – Buch ‚Das Pediskript. Aufzeichnungen aus dem Leben eines Armlosen, mit 30 Bildern“ veröffentlichte, sieht Sloterdijk „einen Existenzvirtuosen wider Willen“ (Sloterdijk 2009: 70). Durch ein enormes Übungspensum erreichte Unthan bereits in jungen Jahren einen hohen Grad an Virtuosität im Geigenspiel mit den Füßen, später auch mit dem Gewehr und der Trompete, woraufhin Unthan durch die Welt reiste, um seine Artistenkünste ei-nem begeisterten Publikum vorzuführen. Obwohl seine Startbedingungen so außer-ordentlich schlecht waren, so nutzte Unthan seine Behinderung als Ausgangspunkt für eine umfassende Selbstwahl, welche mit einem rigorosen Melancholieverbot und einem Widerwillen gegen jedwede Art von Mitleid zusammenging (vgl. ebd.: 74). Demzufolge wäre das beste Mittel gegen das (Selbst-)Mitleid, wie es auch dem Lehrer als seelischem Krüppel widerfährt, in einer von Sloterdijk so bezeichneten
[...]
1 Zudem wirkt sich diese von Sloterdijk so bezeichnete ‚Opferpassion’ auch negativ auf die Schüler aus, wenn sie sich eine solche Haltung zum Vorbild nehmen: „Die Verführung, das eigene Leben im
2 Der Begriff Neotenie bezeichnet in der Biologie das Festhalten an juvenilen (von lat. iuvenis, ‚ju-gendlich’) und fötalen Zügen (vgl. Sloterdijk 2009: 96).
3 So war dann auch das 1932 von Hans Würtz, dem Initiator der staatlichen Behindertenpädagogik, veröffentlichte Buch ‚Zerbrecht die Krücken’ nicht zeitgemäß, „jedoch nicht, weil die Idee des Krü-ckenzerbrechens damals keine Anhänger gefunden hätte, sondern im Gegenteil, weil die Titelparole allzu viele Bekenner in ihren Bann zog“ (Sloterdijk 2009: 82). Weil in Würtz’ Übersichten zur Menschheitsgeschichte des Krüppelproblems u. a. auch der Name Joseph Göbbels gelistet ist (unter der Kategorie ‚Klumpfußkrüppel’), so wurde die gesamte noch nicht ausgelieferte Auflage des Buches von eben jenem Göbbels wieder eingezogen und Würtz als Volksfeind denunziert (vgl. ebd.: 85-90).
4 Damit ist im Grunde bereits der problematische Umgang mit dem Phänomen der Negativität in der Schule angesprochen, auf den in Kapitel 4 näher eingegangen wird.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird der Pädagogik in der Öffentlichkeit oft Verachtung entgegengebracht?
Laut Norbert Ricken besteht eine Diskrepanz zwischen der gesellschaftlichen Beschwörung von Bildung und einer hartnäckig negativen Einschätzung der pädagogischen Praxis.
Was meinte Adorno mit dem „Lehrer als seelischem Krüppel“?
Adorno beschrieb damit das gesellschaftliche Tabu, wonach Lehrer als Menschen wahrgenommen werden, die außerhalb des „realen“ Lebens stehen und disziplinarische Funktionen verkörpern.
Wie greift Peter Sloterdijk den Begriff des „Krüppeltums“ auf?
Sloterdijk verallgemeinert dies dahingehend, dass alle Menschen „Mängelwesen“ sind, was Lehrern helfen kann, sich von ihrer gefühlten Hilflosigkeit zu emanzipieren.
Was ist der Unterschied zwischen Kynismus und Zynismus?
Der antike Kynismus (z. B. Diogenes) war eine Philosophie der Frechheit und Authentizität, während der moderne Zynismus eine Form der resignierten „Nichtidentität von Leben und Einsicht“ ist.
Was ist die „Entmutigungsdidaktik“?
Ein von Sloterdijk geprägter Begriff für eine Haltung, bei der Lehrer ihr eigenes Scheitern unbewusst auf Schüler übertragen, was wiederum Verachtung provoziert.
- Quote paper
- B.A. René Klug (Author), 2009, Über die Verachtung der Pädagogik: Überlegungen im Anschluss an Peter Sloterdijk, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/135892