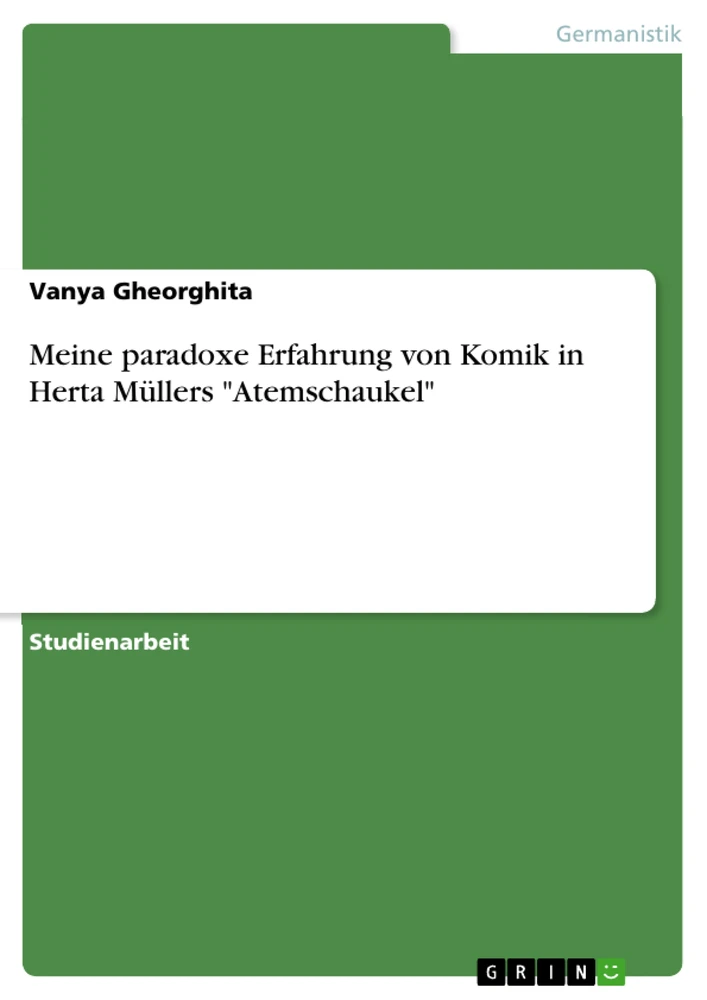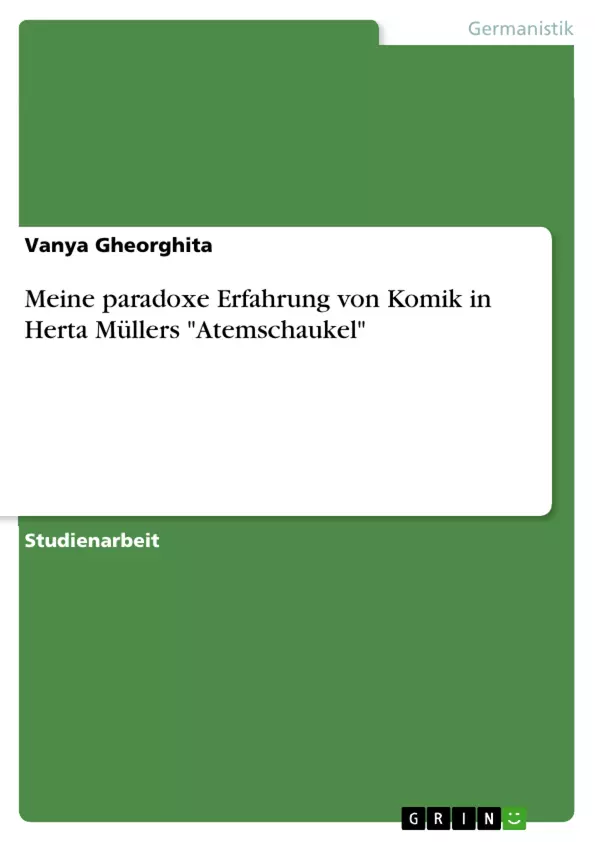Herta Müllers Atemschaukel ist kein Werk, dass sich ausdrücklich über humoristische Mittel mit der Thematik der Zwangsdeportation der Rumäniendeutschen auseinandersetzt, wie etwa Bernhard Ohsams Eine Handvoll Machorka (1958). Edith Konradt bemerkt zu Ohsams Roman: „eine betont humoristische, zugleich aber nicht minder realistische Darstellung […], wobei der Realismus ‚auf der Strecke bleibt‛, der Humor hingegen ‚zum Selbstzweck gerät‛“.
Im Folgenden möchte ich mich mit der Problematik, die dieses Lachen – d.h. mein Lachen über Textausschnitte aus der Atemschaukel – aufwirft, auseinandersetzen, indem ich folgende Fragen zu beantworten versuche:
• Darf gelacht werden?
• Was ist denn zum Lachen? Warum wird gelacht?
• Wo bietet der Text einen Anschluss für Komik, für Lachen?
• Woran mache ich fest, dass bei mir als Rezipientin eine höhere Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass ich über einen Text lache?
Bei der Analyse der Texte gehe ich davon aus, dass Lachen und Komik bzw. Humor grundsätzlich zusammen gehören. Humor sehe ich dabei mit Jörg Räwel als Kommunikationsmedium, dessen Funktion darin besteht, Gesellschaft zu reflektieren.
Inhaltsverzeichnis
- Das ist nicht zum Lachen!
- Erinnerungsbericht: Lesung mit Herta Müller aus Atemschaukel
- Der Gedanke hinter dieser Arbeit
- Theoretische Überlegungen
- Wer sagt denn, dass das nicht zum Lachen ist?
- „Humor ist, wenn man trotzdem lacht.“
- Komische Brücke über die Leerstelle im performativen Akt der Sinnkonstitution
- Konkret am Text
- Ubornaja gemeinschaftlicher Klogang
- Nur die Läuse durften sich rühren an uns
- Fußkultur
- Planton-Kati – unverbesserlich und hilflos
- Kochrezepte erzählen ist eine größere Kunst als Witze erzählen
- Abschließende Gedanken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die paradoxe Erfahrung des Lachens beim Lesen von Herta Müllers „Atemschaukel“, insbesondere im Kontext des Themas Zwangsdeportation der Rumäniendeutschen. Die Analyse konzentriert sich auf Textstellen, die beim Lesen komische Reaktionen hervorrufen, und hinterfragt die legitime Reaktion des Lachens angesichts des schweren historischen Hintergrunds. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, wo und wie Komik im Roman auftritt und wie sie sich mit dem ernsten Thema des Romans verbindet.
- Das Verhältnis von Komik und Tragik in Herta Müllers „Atemschaukel“
- Die Funktion von Humor als Reflexionsmedium im Roman
- Die Rezeption von Komik und die Rolle des Lesers bei der Sinnkonstitution
- Die Frage der Legitimität des Lachens angesichts des Leidens der Deportationsopfer
- Analyse spezifischer Textstellen, die komische Elemente aufweisen
Zusammenfassung der Kapitel
Das ist nicht zum Lachen!: Der einleitende Abschnitt beginnt mit einem Bericht über eine Lesung von Herta Müller aus „Atemschaukel“. Die Autorin beschreibt die überraschende Reaktion des Publikums – einzelne Lachanfälle bei der Lesung einer Passage über die hygienischen Gegebenheiten im Lager, gefolgt von einem plötzlichen Verstummen. Diese paradoxe Reaktion des Lachens angesichts von Leid und Entbehrungen bildet den Ausgangspunkt der gesamten Arbeit und führt zur zentralen Fragestellung nach der Legitimität des Lachens in diesem Kontext. Die Autorin schildert ihre eigene ambivalente Reaktion, das gleichzeitige Lachen und die Erkenntnis über die Tragik der Situation. Dieser Abschnitt dient als Einleitung und begründet die Forschungsfrage der Arbeit.
Theoretische Überlegungen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Analyse der komischen Elemente im Roman. Es werden Fragen nach der Definition von Humor und Komik erörtert und die These aufgestellt, dass Lachen und Komik zusammenhängen. Der Autor bezieht sich dabei auf die Theorien von Jörg Räwel, der Humor als Kommunikationsmedium und Reflexionsmedium versteht, welches auf bestehenden Konventionen basiert und durch deren Unterbrechung komische Effekte erzeugt. Diese theoretische Grundlage wird für die anschließende Textanalyse verwendet.
Konkret am Text: In diesem zentralen Kapitel werden ausgewählte Textstellen aus „Atemschaukel“ analysiert, die komische Elemente aufweisen. Es werden verschiedene Beispiele aus dem Roman präsentiert und unter dem Gesichtspunkt der zuvor dargestellten Theorien interpretiert. Die Analyse untersucht, wie die Komik im Kontext des Romans funktioniert und welche Rolle sie im Gesamtwerk spielt. Es werden die verschiedenen Strategien von Herta Müller aufgezeigt, wie sie Komik einsetzt um die schweren Themen des Romans zu vermitteln.
Schlüsselwörter
Herta Müller, Atemschaukel, Komik, Humor, Zwangsdeportation, Rumäniendeutsche, Lachen, Tragik, Reflexionsmedium, Kommunikationsmedium, Sinnkonstitution, Textanalyse, Leserreaktion.
Häufig gestellte Fragen zu Herta Müllers "Atemschaukel": Eine Analyse des komischen Elements
Was ist das zentrale Thema dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die paradoxe Reaktion des Lachens beim Lesen von Herta Müllers Roman "Atemschaukel", insbesondere im Kontext der Zwangsdeportation der Rumäniendeutschen. Sie analysiert, wie komische Elemente im Roman auftreten und sich mit dem ernsten Thema der Deportation verbinden.
Welche Aspekte werden in der Analyse betrachtet?
Die Analyse konzentriert sich auf das Verhältnis von Komik und Tragik, die Funktion von Humor als Reflexionsmedium, die Rolle des Lesers bei der Sinnkonstitution, die Legitimität des Lachens angesichts des Leids und die Interpretation spezifischer Textstellen mit komischen Elementen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Einleitung ("Das ist nicht zum Lachen!"), theoretische Überlegungen, eine konkrete Textanalyse ausgewählter Passagen aus "Atemschaukel" und abschließende Gedanken. Die Einleitung beschreibt eine Lesung von Herta Müller und die überraschenden Reaktionen des Publikums, welche die Forschungsfrage nach der Legitimität des Lachens im Kontext der Deportation aufwerfen.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf Theorien von Jörg Räwel, der Humor als Kommunikations- und Reflexionsmedium versteht, das auf bestehenden Konventionen basiert und durch deren Unterbrechung komische Effekte erzeugt. Diese Theorie dient als Grundlage für die Interpretation der komischen Elemente im Roman.
Welche Textstellen werden analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf spezifische Textstellen aus "Atemschaukel", die komische Elemente aufweisen. Beispiele umfassen Beschreibungen des Lagers, Anekdoten und die Darstellung von Figuren wie Planton-Kati. Die Analyse untersucht, wie Herta Müller Komik einsetzt, um die schweren Themen des Romans zu vermitteln.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit untersucht die Ambivalenz der Lesererfahrung und die Frage, ob und wie Lachen angesichts des Leids der Deportationsopfer legitim ist. Sie beleuchtet die komplexen Beziehungen zwischen Komik und Tragik im Roman und die Funktion des Humors als Reflexions- und Kommunikationsmittel. Die genauen Schlussfolgerungen werden in der abschließenden Zusammenfassung der Arbeit detailliert dargestellt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Herta Müller, Atemschaukel, Komik, Humor, Zwangsdeportation, Rumäniendeutsche, Lachen, Tragik, Reflexionsmedium, Kommunikationsmedium, Sinnkonstitution, Textanalyse, Leserreaktion.
- Citar trabajo
- Vanya Gheorghita (Autor), 2010, Meine paradoxe Erfahrung von Komik in Herta Müllers "Atemschaukel", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1359235