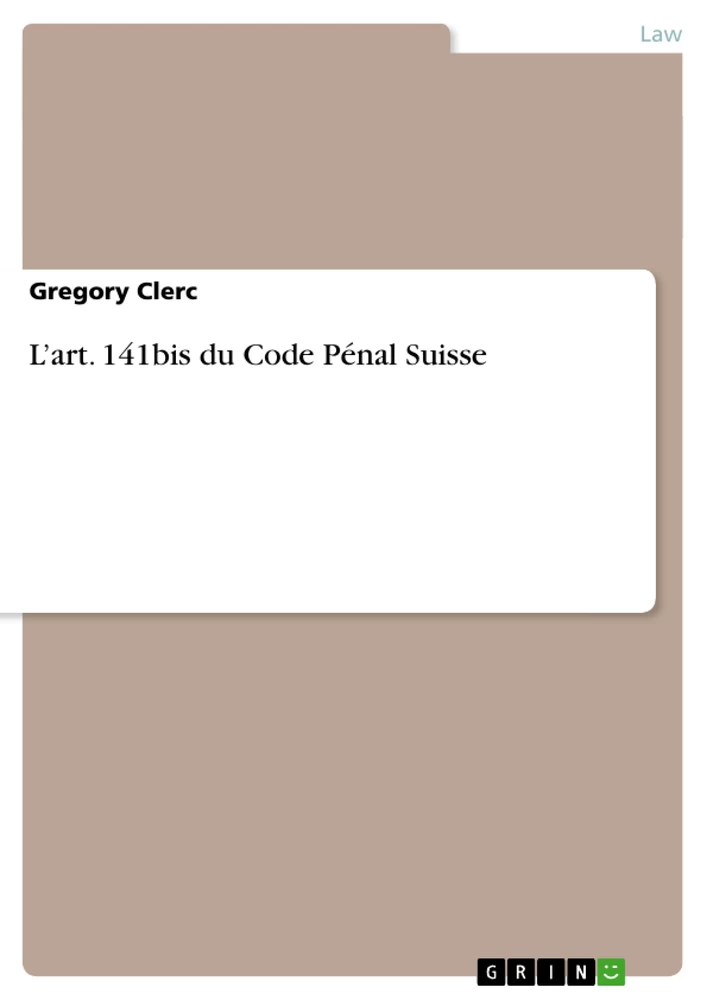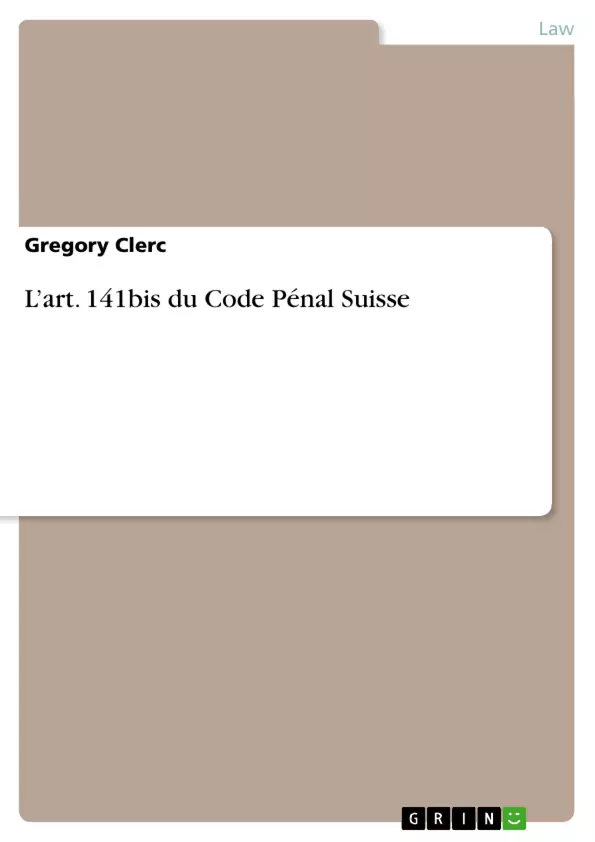Cet ouvrage traite du droit pénal et plus particulièrement de l'utilisation sans droit de valeurs patrimoniales (art. 141bis du Code Pénale Suisse).
La disposition de l'art. 141bis CP a été introduite dans la loi par la révision des infractions contre le patrimoine du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janvier 1995. L’art. 141bis CP a permis au législateur de réprimer l’utilisation sans droit de valeurs patrimoniales. Cet article est le fruit de la codification de la jurisprudence « Nehmad » établie depuis 1961. La problématique rencontrée dans cette jurisprudence était que compte tenu de la teneur et de la systématique de l'ancien droit concernant l'infraction de détournement (art. 141 aCP), le détournement de créances n'était englobé qu'en étendant cette notion aux
créances. Dans la pratique il en résultait des difficultés concernant celui qui, dans un dessein d'enrichissement illégitime, disposait d'un avoir dont il savait qu'il avait été crédité par erreur sur son compte. Les juges du tribunal fédéral avaient à l’époque élargi la notion de choses à des créances tout en rendant punissable en tant que détournement le fait pour l’auteur de disposer dans un dessein d’enrichissement illégitime d’un avoir dont il savait qu’il avait été accrédité par erreur. L’art. 141bis CP a par conséquent été conçu pour réprimer les cas de détournement d’une créance. Jusqu’alors aucune disposition en vigueur sur l’appropriation ne leurs étaient applicable en l’absence d’une interprétation
très extensive de la notion de chose.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents):
- I. Einleitung
- II. Die Elemente der Straftat
- A. Objektive Tatbestandsmerkmale
- i. Ein Vermögenswert
- ii. Eine unfreiwillige Erlangung
- iii. Eine rechtswidrige Verwendung zum Vorteil des Täters oder eines Dritten
- B. Die Absicht
- A. Objektive Tatbestandsmerkmale
- III. Die Verfolgung und die Strafe
- IV. Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes):
Dieser Text befasst sich mit der strafrechtlichen Regulierung der rechtswidrigen Verwendung von Vermögenswerten im Schweizer Strafgesetzbuch, insbesondere mit dem Artikel 141 bis StGB. Der Artikel analysiert die Entwicklung der Rechtsprechung zu diesem Thema und die Gründe für die Einführung des Artikels 141 bis StGB. Zudem beleuchtet der Text die verschiedenen Tatbestandsmerkmale, die für eine strafrechtliche Verurteilung nach diesem Artikel relevant sind.
- Entwicklung der Rechtsprechung zum unrechtmäßigen Gebrauch von Vermögenswerten
- Die Rechtsgrundlage des Artikels 141 bis StGB
- Die Bedeutung des Tatbestandsmerkmals "unfreiwillige Erlangung" im Zusammenhang mit dem Artikel 141 bis StGB
- Die Unterscheidung zwischen "Verwendung" und "Verfügung" im Sinne des Artikels 141 bis StGB
- Die Frage der strafrechtlichen Sanktionierung
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries):
Die Einleitung stellt die historische Entwicklung des Artikels 141 bis StGB dar. Sie erklärt, warum dieser Artikel im Schweizer Strafgesetzbuch eingeführt wurde und welche Probleme er lösen sollte.
Der zweite Abschnitt konzentriert sich auf die verschiedenen Elemente der Straftat nach dem Artikel 141 bis StGB. Er untersucht die objektiven Tatbestandsmerkmale, wie z.B. die Definition eines Vermögenswerts und das Merkmal der "unfreiwilligen Erlangung".
Der dritte Abschnitt beleuchtet die rechtlichen Folgen einer Straftat nach dem Artikel 141 bis StGB, insbesondere die Frage der Verfolgung und die mögliche Strafhöhe.
Die Schlussfolgerung fasst die wichtigsten Punkte des Textes zusammen und bietet möglicherweise einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen im Bereich des strafrechtlichen Schutzes von Vermögenswerten.
Schlüsselwörter (Keywords):
Der Text fokussiert auf die rechtswidrige Verwendung von Vermögenswerten im Schweizer Strafgesetzbuch, insbesondere den Artikel 141 bis StGB. Zu den zentralen Begriffen gehören "Vermögenswert", "unfreiwillige Erlangung", "rechtswidrige Verwendung", "Absicht" und "Strafbarkeit".
Häufig gestellte Fragen
Was regelt der Artikel 141bis des Schweizer Strafgesetzbuchs?
Er regelt die strafrechtliche Verfolgung der rechtswidrigen Verwendung von Vermögenswerten, die dem Täter ohne dessen Zutun (z.B. durch Fehlüberweisung) zugekommen sind.
Warum wurde dieser Artikel 1995 eingeführt?
Um eine Gesetzeslücke zu schließen. Zuvor war es schwierig, Personen zu bestrafen, die irrtümlich gutgeschriebenes Geld behielten, da dies nicht eindeutig unter den Begriff "Diebstahl" oder "Unterschlagung" fiel.
Was bedeutet "unfreiwillige Erlangung" in diesem Kontext?
Es bedeutet, dass der Vermögenswert ohne den Willen des ursprünglichen Eigentümers, aber auch ohne aktives Zutun des Empfängers (z.B. Bankirrtum) in dessen Machtbereich gelangt ist.
Was ist der Unterschied zwischen "Verwendung" und "Verfügung"?
Der Artikel 141bis nutzt den Begriff der Verwendung, was jede Handlung einschließt, die den rechtmäßigen Eigentümer dauerhaft um seinen Wert bringt, um sich selbst oder einen Dritten zu bereichern.
Was war die "Nehmad-Rechtsprechung"?
Dies war eine wegweisende Entscheidung des Bundesgerichts von 1961, die versuchte, das Problem der Fehlüberweisungen über eine weite Auslegung des Begriffs "Sache" zu lösen, was schließlich zur Kodifizierung im Art. 141bis führte.
Welche Strafe droht bei einem Verstoß gegen Art. 141bis StGB?
Die rechtswidrige Verwendung von Vermögenswerten kann mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe sanktioniert werden.
- Arbeit zitieren
- Gregory Clerc (Autor:in), 2009, L’art. 141bis du Code Pénal Suisse, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/135927