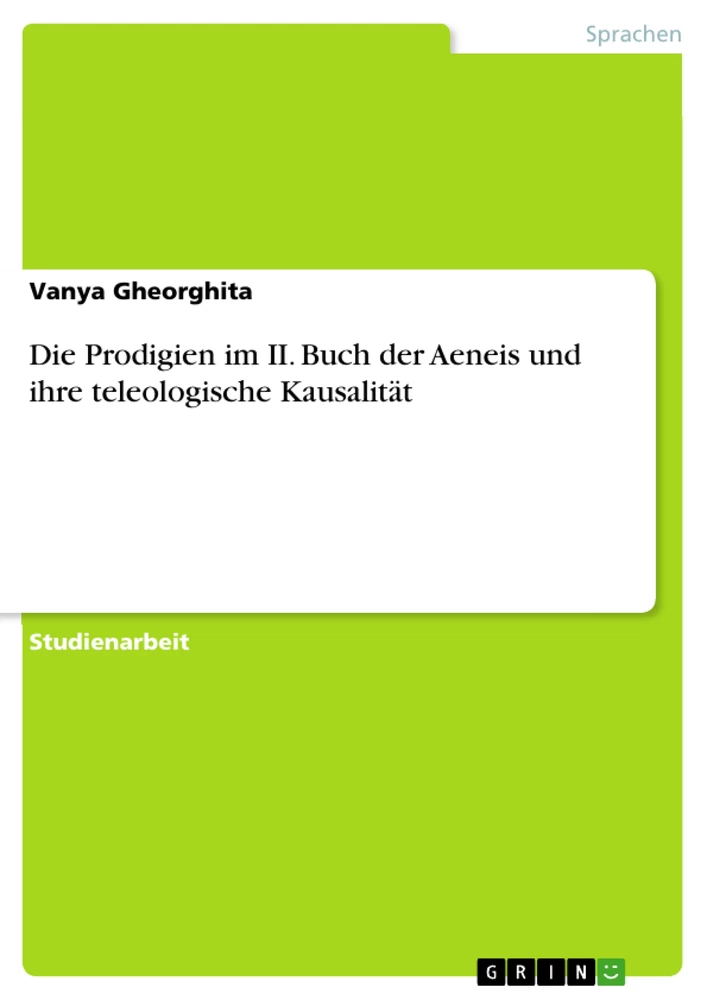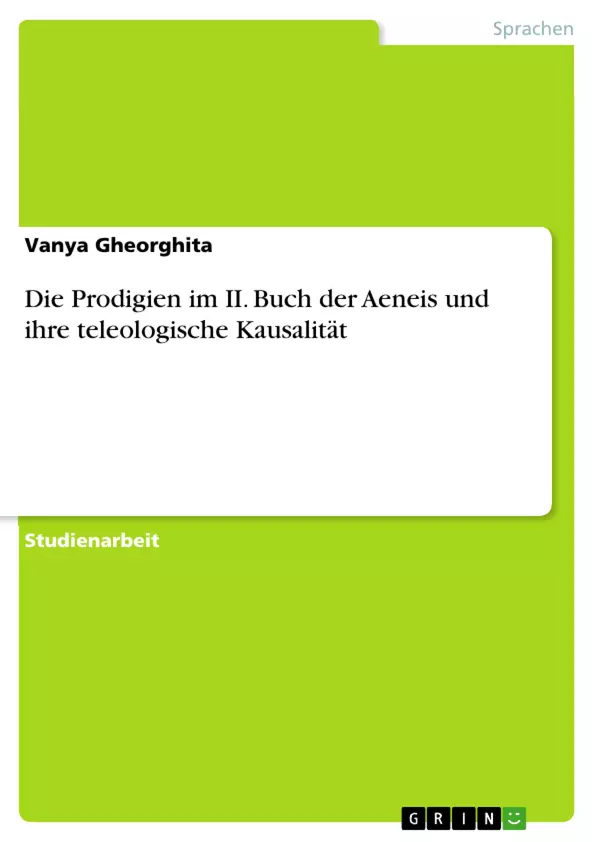Das zweite Buch der Aeneis, in dem Aeneas, aufgefordert von Dido, den Fall Trojas und den anschließenden Auszug aus Troja erzählt, fällt durch die Häufung von verschiedenen göttlichen Zeichen besonders auf: Erscheinung einer Gottheit (der Venus), Prodigien (Schwitzen des Palladiums, Laokoonprodigium, Flammenprodigium und Sternprodigium), Traumerscheinung (Hektors) und Epiphanie (Kreusas).
Dass es um die Gründung des römischen Imperium geht, weiß der Leser schon nach den ersten Zeilen 1-7 des I. Buches. Wie es jedoch vom Fall Trojas zur Gründung Roms kommt, muss der Erzähler noch begründen, denn Erzählen ist sinnkonstituierend: es besteht nicht bloß aus der chronologischen Abfolge von Ereignissen, sondern schafft einen Handlungszusammenhang nach dem Prinzip der Kausalität.
Wie sich diese finale Motivierung im Text niederschlägt, möchte ich anhand der Prodigien im II. Buch der Aeneis analysieren. Denn nachdem die Aeneis in medias res anfängt, wird im II. Buch retrospektivisch der Anfang des Weges von Troja nach Latium dargestellt und vor allem durch die Prodigien als epische Mittel motiviert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Problemstellung
- 2. Was ist ein Prodigium?
- 3. Die Prodigien im II. Buch der Aeneis
- 3.1. Schwitzen des Palladiums (162-182)
- 3.2. Laokoonprodigium (199-233)
- 3.3. Flammenprodigium und Sternprodigium (679-704)
- Flammenprodigium
- Sternprodigium
- 4. Zusammenfassende Schlussfolgerung
- 5. Anhang: Übersetzung der Prodigien des II. Buches der Aeneis
- 5.1. Schwitzen des Palladiums (162-182)
- 5.2. Laokoonprodigium (199-233)
- 5.3. Flammen- und Sternprodigium (679-704)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Prodigien im zweiten Buch der Aeneis und untersucht deren teleologische Kausalität. Sie zielt darauf ab, die Rolle dieser göttlichen Zeichen im Kontext der römischen Weltanschauung und der epischen Handlung Vergils zu verstehen.
- Die Bedeutung von Prodigien im römischen Kulturkreis
- Die Funktion der Prodigien als epische Mittel in der Aeneis
- Die teleologische Kausalität der Prodigien in Bezug auf das Fatum Roms
- Die Dramatisierung der Handlung durch die Prodigien
- Vergils dichterische Gestaltung der Prodigien im Vergleich zum römischen Prodigienstil
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt die Problemstellung dar, indem es die Häufung von göttlichen Zeichen im zweiten Buch der Aeneis beleuchtet. Kapitel zwei definiert den Begriff "Prodigium" und skizziert seine Bedeutung in der römischen Religion. In Kapitel drei werden die einzelnen Prodigien im II. Buch der Aeneis analysiert: das Schwitzen des Palladiums, das Laokoonprodigium und das Flammen- und Sternprodigium. Dieses Kapitel untersucht die Funktion und Bedeutung jedes Prodigiums im Kontext der Handlung und in Bezug auf die römischen Überzeugungen. Die Arbeit wird durch einen Anhang abgerundet, der Übersetzungen der Prodigien aus dem II. Buch der Aeneis enthält.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Analyse der Prodigien im zweiten Buch der Aeneis und ihren Funktionen in Bezug auf das Fatum Roms. Die Analyse berührt die Bereiche der römischen Religion und Kultur, der epischen Handlungsführung und der dichterischen Gestaltung der Prodigien. Zu den zentralen Begriffen zählen Prodigium, teleologische Kausalität, Pax Deum, Fatum, epische Mittel, römische Weltanschauung und die epische Gestaltung des Prodigienstils.
- Quote paper
- Vanya Gheorghita (Author), 2007, Die Prodigien im II. Buch der Aeneis und ihre teleologische Kausalität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1359400