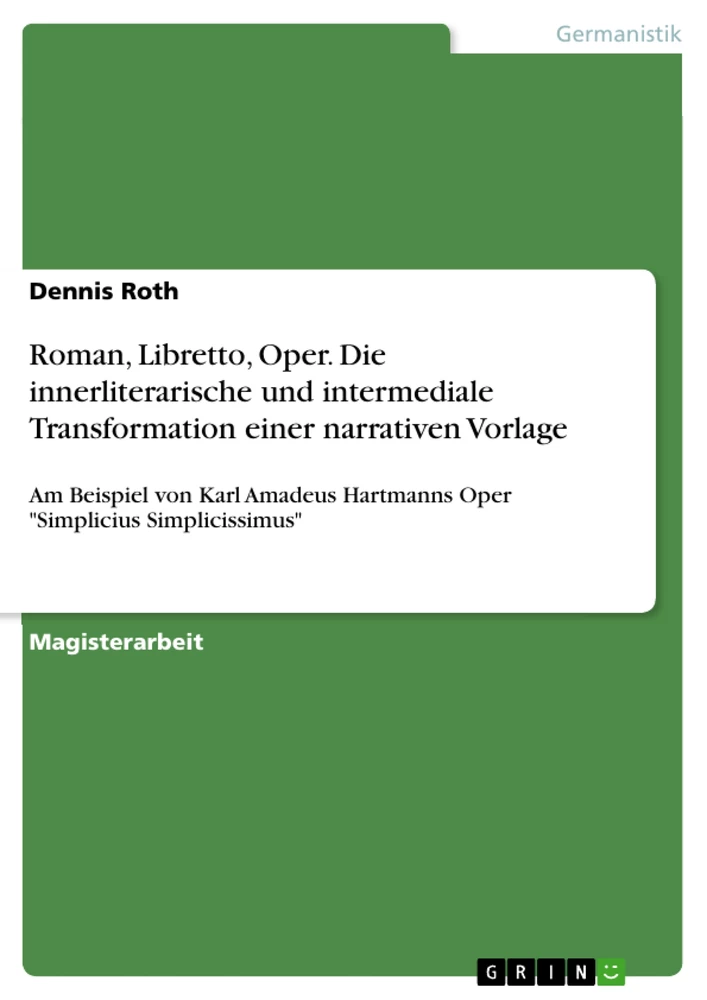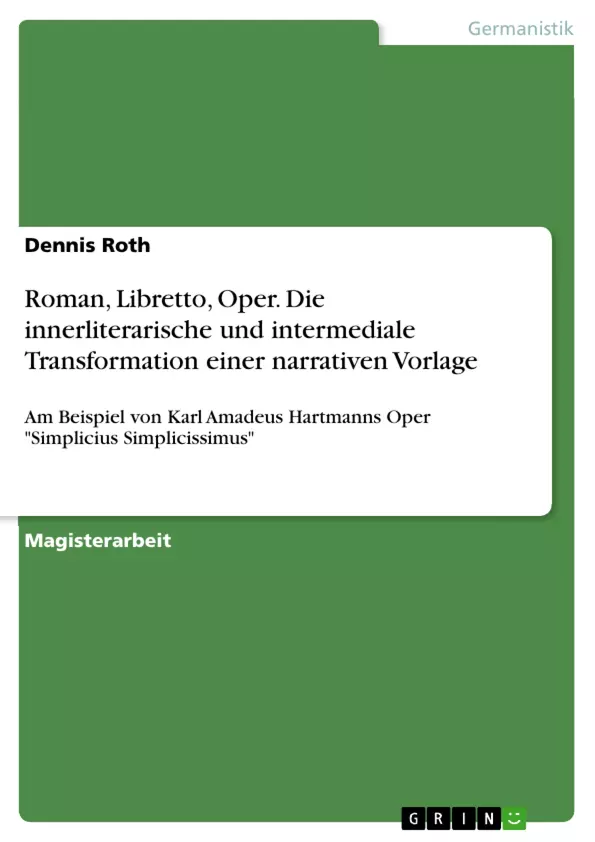Die vorliegende Arbeit weist eine dreischrittige Anlage auf, die das leitende narratologische Interesse widerspiegelt. Hierfür soll zunächst der Erzähltext, dann das Libretto, in das jener dramatisiert wurde, und schließlich die Oper als Vertonung des Librettos in den Blick genommen werden. Die Endgestalt von Libretto und Oper lässt jeweils vergleichende Rückschlüsse auf den Transformationsprozess zu, der sich zwischen den unterschiedlichen textlichen und medialen Realisationen der jeweiligen Vorlage ereignet hat. Diese komparatistische Vorgehensweise sucht nicht nur dem Libretto als einer "intermediären Gattung" methodisch gerecht zu werden, sondern auch dem Erzähltext, der zwar selbstredend unter dem Vorzeichen seiner Librettisierung betrachtet wird, dabei jedoch nicht auf seine bloße Vorlagenfunktion reduziert werden soll. Vielmehr wird er als das angesehen, was er ist: ein autonomes Kunstwerk, das von seiner späteren Bearbeitung gleichsam nichts weiß.
Neben den narratologischen rücken auch ästhetische Fragestellungen in den Blickpunkt des Interesses, weil das "Wie" der ästhetischen Realisierung vom "Was" des Realisierten nicht zu trennen ist. Denn die Librettisierung ist ja nicht nur ein formaler, sondern auch ein ästhetisch-reflektierender Akt, bei dem der Erzähltext aufgrund der strukturellen Unterschiede zwischen den Textgattungen nicht ohne innerliterarische Widerstände von der einen in die andere Gattung transponiert werden kann. Vielmehr stellt sie immer auch einen Prozess der Deutung, ja Umdeutung der Vorlage dar, die der Librettist bzw. der Komponist für seine ästhetischen Ziele in der anvisierten Gattung bzw. medialen Realisierung fruchtbar zu machen sucht.
Nicht jedes Libretto ist originäre Operndichtung, nicht jede Oper die Vertonung eines Textbuchs, das der Librettist eigens zum Zweck seiner Vertonung als genuine Schöpfung verfasst hat und in dem daher eben nicht ein bereits vorhandener Stoff oder ein bestimmtes Werk bearbeitend aufgegriffen und für die Opernbühne adaptiert wurde. Zu solchen originären Operndichtungen zählen u. a. – trotz zahlreicher Anleihen an und Anspielungen auf bereits vorhandene Stoffe und Themen – die Libretti, die Hugo von Hofmannsthal für Richard Strauss verfasste, darunter jene zu "Der Rosenkavalier", "Ariadne auf Naxos" und "Die Frau ohne Schatten", Lorenzo da Pontes Textbuch zu "Così fan tutte", Ernst Kreneks "Jonny" spielt auf und auch Stockhausens gigantomanischer Opernzyklus "Licht".
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Roman
- 2.1 Grimmelshausen und sein Roman Der abentheurliche Simplicissimus Teutsch
- 2.2 Analyse
- 2.2.1 Inhalt der librettisierten Kapitel
- 2.2.2 Protagonist
- 2.2.3 Erzählsituation und Perspektivismus
- 2.2.4 Satire
- 2.2.5 Krieg und Gesellschaft
- 2.2.6 Ständebaum
- 3. Das Libretto
- 3.1 Karl Amadeus Hartmann und seine Oper Simplicius Simplicissimus
- 3.1.1 Werkgeschichte
- 3.2 Voraussetzungen der innerliterarischen Transformation und des Librettos als eines zu vertonenden Textes
- 3.3 Analyse
- 3.3.1 Titel
- 3.3.2 Form
- 3.3.3 Sprache
- 3.3.4 Handlung
- 3.3.5 Figurenarsenal
- 3.3.6 Erzählweise
- 3.3.7 Episierungsstrategien
- 3.3.8 Lieder und spielinterne Musik
- 3.3.9 Protagonist
- 3.3.10 Ständebaum
- 3.4 Allgemeine Eigenschaften des Librettos
- 3.4.1 Verdichtung
- 3.4.2 Verdeutlichung und Bildhaftigkeit
- 3.4.3 Veräußerlichung innerer Vorgänge
- 3.4.4 Emotionalisierung
- 3.4.5 Plurimedialität
- 3.1 Karl Amadeus Hartmann und seine Oper Simplicius Simplicissimus
- 4. Die Oper
- 4.1 Epische Oper und Bekenntnismusik (I)
- 4.2 Analyse
- 4.2.1 Besetzung
- 4.2.2 Lieder
- 4.2.3 Zitate
- 4.2.4 Funktionen der Musik
- 4.2.5 Epische Oper und Bekenntnismusik (II)
- 5. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die innerliterarische und intermediale Transformation des Romans "Der abenteuerliche Simplicissimus Teutsch" von Grimmelshausen in Karl Amadeus Hartmanns Oper "Simplicius Simplicissimus". Die Arbeit analysiert die spezifischen Herausforderungen und ästhetischen Entscheidungen, die mit der Adaption eines epischen Textes in ein musikalisch-dramatisches Werk verbunden sind.
- Analyse der narrativen Struktur und der Erzählperspektive im Roman und im Libretto.
- Vergleich der Charaktere und der Handlungsführung in beiden Werken.
- Untersuchung der Rolle von Musik und Sprache in der Oper.
- Bewertung der stilistischen und inhaltlichen Veränderungen während der Transformation.
- Erörterung der intermedialen Aspekte der Oper, insbesondere der Beziehung zwischen Literatur und Musik.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Libretto-Erstellung ein und differenziert zwischen originären Operndichtungen und solchen, die auf literarischen Vorlagen basieren. Sie hebt hervor, dass die vorliegende Arbeit sich mit der Transformation eines narrativen Textes in ein Libretto beschäftigt, was einen komplexen innerliterarischen Transformationsprozess impliziert, bevor die intermediale Transformation in die Musik stattfindet. Der Fokus liegt auf der Analyse von Grimmelshausens "Simplicissimus" und seiner Adaption durch Hartmann.
2. Der Roman: Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Analyse von Grimmelshausens "Simplicissimus". Es untersucht den Inhalt, den Protagonisten, die Erzählsituation, die satirischen Elemente, die Darstellung von Krieg und Gesellschaft, und die Bedeutung des Ständebaums im Roman. Die Analyse legt den Fokus auf die Aspekte des Romans, die für die spätere Opernfassung relevant sind und beleuchtet die spezifischen Herausforderungen, die sich bei der Adaption ergeben.
3. Das Libretto: Der Schwerpunkt dieses Kapitels liegt auf der Analyse des Librettos von Hartmanns Oper. Es befasst sich mit dem Titel, der Form, der Sprache, der Handlung, dem Figurenarsenal, der Erzählweise, den Episierungsstrategien, den Liedern und der Musik, sowie der Darstellung des Protagonisten und des Ständebaums. Es untersucht, wie die Elemente des Romans im Libretto transformiert wurden und welche ästhetischen Entscheidungen getroffen wurden.
4. Die Oper: Dieses Kapitel widmet sich der Analyse von Hartmanns Oper "Simplicius Simplicissimus" selbst. Es betrachtet die Besetzung, die Lieder, Zitate, die Funktionen der Musik innerhalb der Oper und setzt diese in den Kontext der epischen Oper und Bekenntnismusik. Die Analyse beleuchtet, wie die musikalischen Elemente die narrative und emotionale Wirkung des Librettos verstärken und die intermediale Beziehung zwischen Musik und Literatur gestaltet wird.
Schlüsselwörter
Simplicissimus, Grimmelshausen, Hartmann, Oper, Libretto, innerliterarische Transformation, intermediale Transformation, epischer Roman, dramatischer Text, Musik, Literatur, Satire, Krieg, Gesellschaft, Ständebaum, Erzählperspektive.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Simplicius Simplicissimus": Roman, Libretto und Oper
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Diese Magisterarbeit analysiert die Transformation von Grimmelshausens Roman "Der abenteuerliche Simplicissimus Teutsch" in Karl Amadeus Hartmanns Oper "Simplicius Simplicissimus". Sie untersucht die Herausforderungen und ästhetischen Entscheidungen bei der Adaption eines epischen Textes in ein musikalisch-dramatisches Werk.
Welche Aspekte des Romans werden analysiert?
Die Analyse des Romans umfasst den Inhalt, den Protagonisten Simplicius Simplicissimus, die Erzählsituation und Perspektivismus, die satirischen Elemente, die Darstellung von Krieg und Gesellschaft, sowie die Bedeutung des Ständebaums. Der Fokus liegt auf den Aspekten, die für die Opernfassung relevant sind.
Wie wird das Libretto analysiert?
Die Analyse des Librettos betrachtet Titel, Form, Sprache, Handlung, Figurenarsenal, Erzählweise, Episierungsstrategien, Lieder und Musik, sowie die Darstellung von Simplicius Simplicissimus und des Ständebaums. Es wird untersucht, wie Elemente des Romans transformiert wurden und welche ästhetischen Entscheidungen getroffen wurden.
Welche Aspekte der Oper werden untersucht?
Die Opernanalyse umfasst die Besetzung, die Lieder, Zitate, die Funktionen der Musik, und setzt diese in den Kontext der epischen Oper und Bekenntnismusik. Es wird beleuchtet, wie musikalische Elemente die narrative und emotionale Wirkung verstärken und die intermediale Beziehung zwischen Musik und Literatur gestaltet wird.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die narrative Struktur und Erzählperspektive im Roman und Libretto, vergleicht Charaktere und Handlungsführung, untersucht die Rolle von Musik und Sprache in der Oper, bewertet stilistische und inhaltliche Veränderungen während der Transformation und erörtert die intermedialen Aspekte, insbesondere die Beziehung zwischen Literatur und Musik.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Simplicissimus, Grimmelshausen, Hartmann, Oper, Libretto, innerliterarische Transformation, intermediale Transformation, epischer Roman, dramatischer Text, Musik, Literatur, Satire, Krieg, Gesellschaft, Ständebaum, Erzählperspektive.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Roman "Simplicissimus", ein Kapitel zum Libretto der Oper, ein Kapitel zur Oper selbst und eine Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Analyse der jeweiligen Aspekte.
Wie wird die Transformation des Romans in die Oper beschrieben?
Die Arbeit beschreibt den komplexen Prozess der innerliterarischen Transformation des Romans in ein Libretto und anschließend die intermediale Transformation in die Musik. Sie analysiert die spezifischen Entscheidungen und Herausforderungen bei dieser Adaption.
- Quote paper
- Dennis Roth (Author), 2009, Roman, Libretto, Oper. Die innerliterarische und intermediale Transformation einer narrativen Vorlage, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1359552