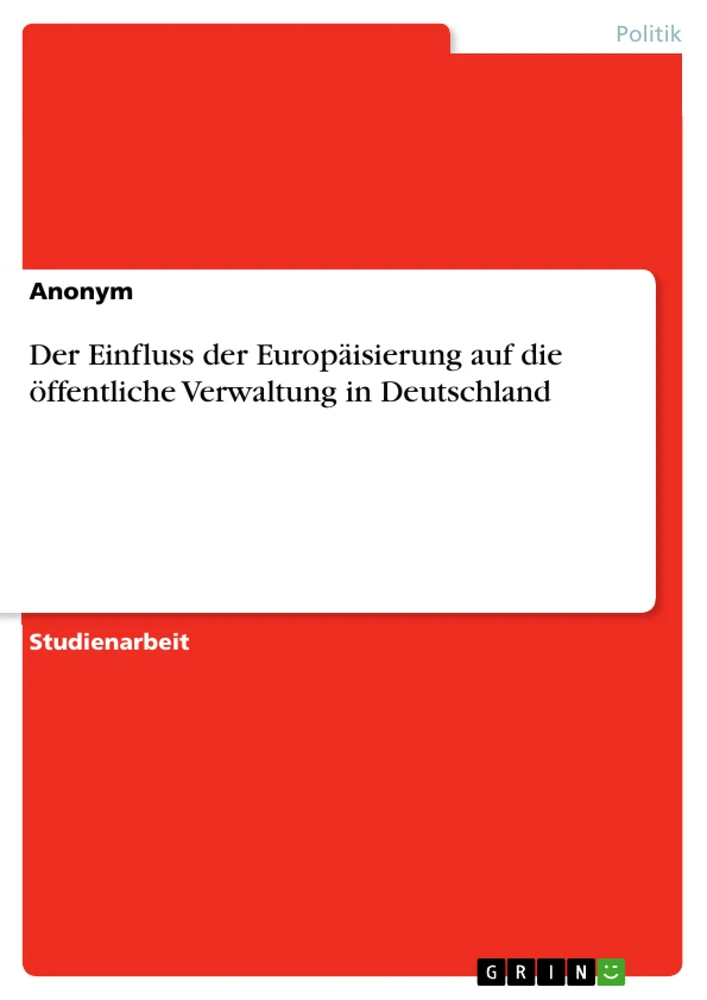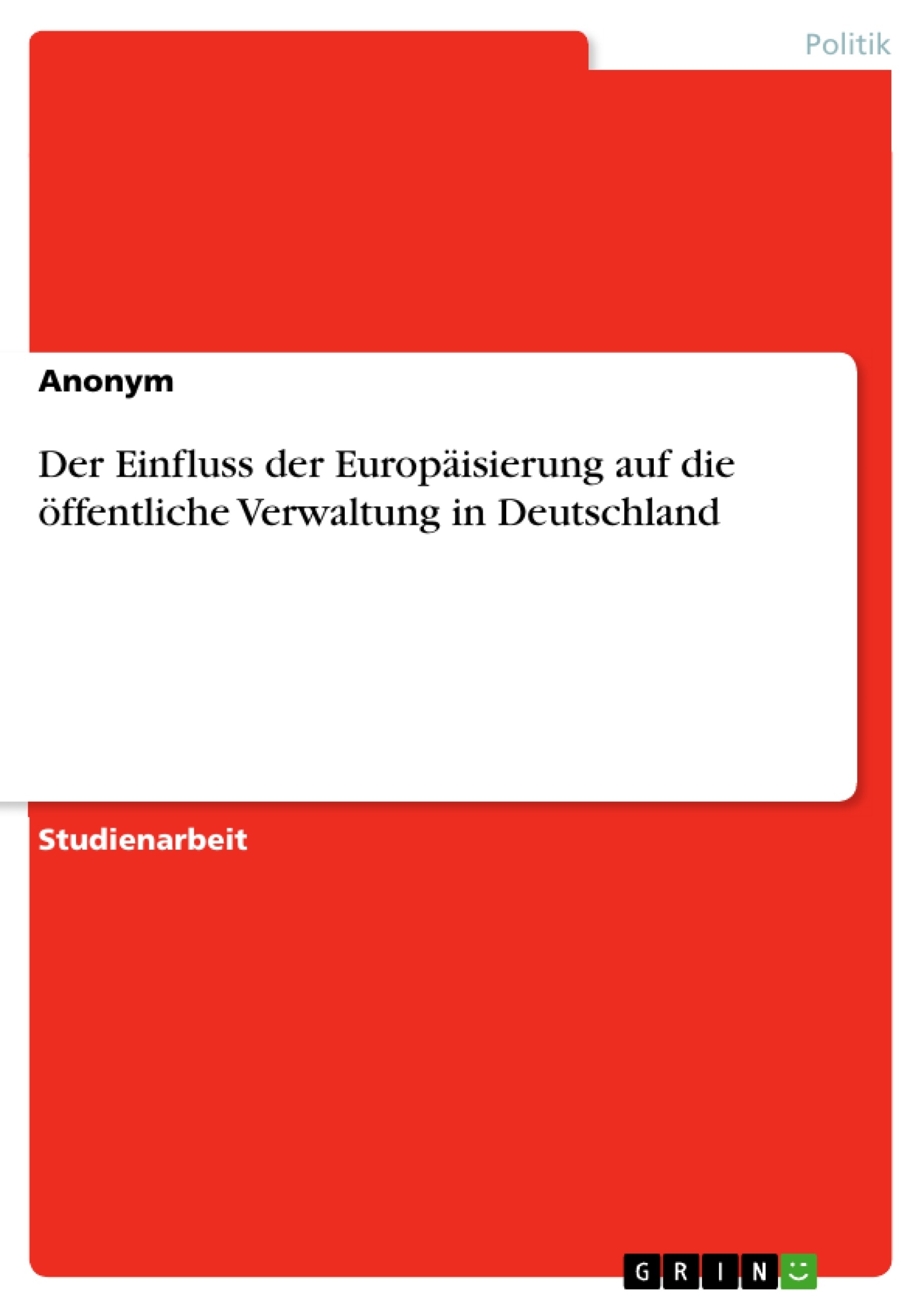Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, welche Rolle die Europäisierung für die Kommunen in Deutschland hat. Dabei wird der Fokus auf die Kommunen, als unterste Ebene im politischen System in der Europäischen Union, gesetzt. Neben der Bedeutung der Europäisierung sollen ebenfalls positive wie negative Auswirkungen des europäischen Integrationsprozesses auf die kommunale Ebene aufgezeigt werden.
Um die Fragestellung zu klären, folgt die Arbeit der anschließend dargestellten Struktur: Es werden zunächst der Europäisierungsbegriff definiert und die Europäisierung als methodisches Konzept beleuchtet. In Kapitel 3 erfolgt ein Blick auf die kommunale Ebene, die im Grundgesetz verankerte Selbstverwaltungsgarantie und der Versuch der wachsenden Einbindung der Kommunen in die Europapolitik. Im Anschluss wird auf drei ausgewählte Politikfelder eingegangen, bei denen die europäische Rechtsetzung den Handlungsrahmen der Kommunen im Wesentlichen mitbestimmt, bevor am Ende ein Fazit gezogen wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Europäisierung
- Ebenen der Europäisierung
- Vektoren der Europäisierung
- Die kommunale Ebene im europäischen Kontext
- Das kommunale Selbstverwaltungsrecht und seine Schranken
- Zur Stellung der Kommunen in der Europäischen Union
- Folgen der Europäisierung auf kommunaler Ebene
- Öffentliches Auftragswesen
- Umweltpolitik
- Kommunale Wirtschaftsförderung und EU-Beihilferecht
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle der Europäisierung für die Kommunen in Deutschland. Sie konzentriert sich auf die Kommunen als unterste Ebene des politischen Systems in der Europäischen Union und beleuchtet die Auswirkungen des europäischen Integrationsprozesses auf die kommunale Ebene. Die Arbeit befasst sich insbesondere mit der Bedeutung der Europäisierung für die Kommunen und zeigt sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf.
- Definition des Begriffs „Europäisierung“
- Ebenen der Europäisierung (polity, politics, policies)
- Das kommunale Selbstverwaltungsrecht und seine Schranken im europäischen Kontext
- Die Stellung der Kommunen in der Europäischen Union
- Auswirkungen der Europäisierung auf ausgewählte Politikfelder (Öffentliches Auftragswesen, Umweltpolitik, Kommunale Wirtschaftsförderung)
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung führt den Leser in die Thematik der Europäisierung und ihre Bedeutung für die öffentliche Verwaltung in Deutschland ein. Sie beleuchtet den Leitspruch der Europäischen Union „In Vielfalt geeint“ und erklärt, wie die europäische Rechtsetzung, mittels Richtlinien, Verordnungen und Entscheidungen, Einfluss auf das Leben der Menschen in den Kommunen nimmt. Die Einleitung betont die Vorteile des geeinten Europas für die Bürger, insbesondere die Reisefreiheit und die Abschaffung von Roaming-Gebühren.
Kapitel 2: Europäisierung
Dieses Kapitel definiert den Begriff „Europäisierung“ und betrachtet ihn als einen Anpassungsprozess der EU-Mitgliedsstaaten an die Veränderungen von innerstaatlichen Strukturen. Es werden die Ebenen der Europäisierung (polity, politics, policies) erläutert und die Auswirkungen auf die verschiedenen Politikdimensionen werden aufgezeigt.
Kapitel 3: Die kommunale Ebene im europäischen Kontext
Kapitel 3 befasst sich mit der kommunalen Ebene und beleuchtet das im Grundgesetz verankerte Selbstverwaltungsrecht. Es werden die Schranken dieses Rechts im europäischen Kontext sowie die wachsende Einbindung der Kommunen in die Europapolitik diskutiert.
Kapitel 4: Folgen der Europäisierung auf kommunaler Ebene
Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen der Europäischen Union auf drei ausgewählte Politikfelder: Öffentliches Auftragswesen, Umweltpolitik und Kommunale Wirtschaftsförderung und EU-Beihilferecht.
Schlüsselwörter
Europäisierung, Kommunale Ebene, Selbstverwaltungsrecht, EU-Rechtsetzung, Politikfelder, Öffentliches Auftragswesen, Umweltpolitik, Kommunale Wirtschaftsförderung, EU-Beihilferecht, Integrationsprozess
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Europäisierung für deutsche Kommunen?
Europäisierung beschreibt den Prozess, bei dem europäische Rechtsetzung (Richtlinien, Verordnungen) zunehmend den Handlungsrahmen und die innerstaatlichen Strukturen der kommunalen Ebene beeinflusst.
Wird das kommunale Selbstverwaltungsrecht durch die EU eingeschränkt?
Ja, das im Grundgesetz verankerte Selbstverwaltungsrecht findet seine Schranken in der vorrangigen europäischen Gesetzgebung, beispielsweise im Beihilfe- oder Vergaberecht.
In welchen Politikfeldern ist der EU-Einfluss besonders hoch?
Besonders stark betroffen sind das öffentliche Auftragswesen (Ausschreibungen), die Umweltpolitik sowie die kommunale Wirtschaftsförderung durch das EU-Beihilferecht.
Welche Vorteile bietet die EU für Bürger in den Kommunen?
Dazu gehören die Reisefreiheit, der Wegfall von Roaming-Gebühren und einheitliche Standards im Umweltschutz, die direkt die Lebensqualität vor Ort verbessern.
Was sind die 'Vektoren der Europäisierung'?
Es handelt sich um die Wege, auf denen europäische Impulse in nationale Systeme gelangen, unterschieden nach Polity (Strukturen), Politics (Prozesse) und Policies (Inhalte).
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Der Einfluss der Europäisierung auf die öffentliche Verwaltung in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1360735