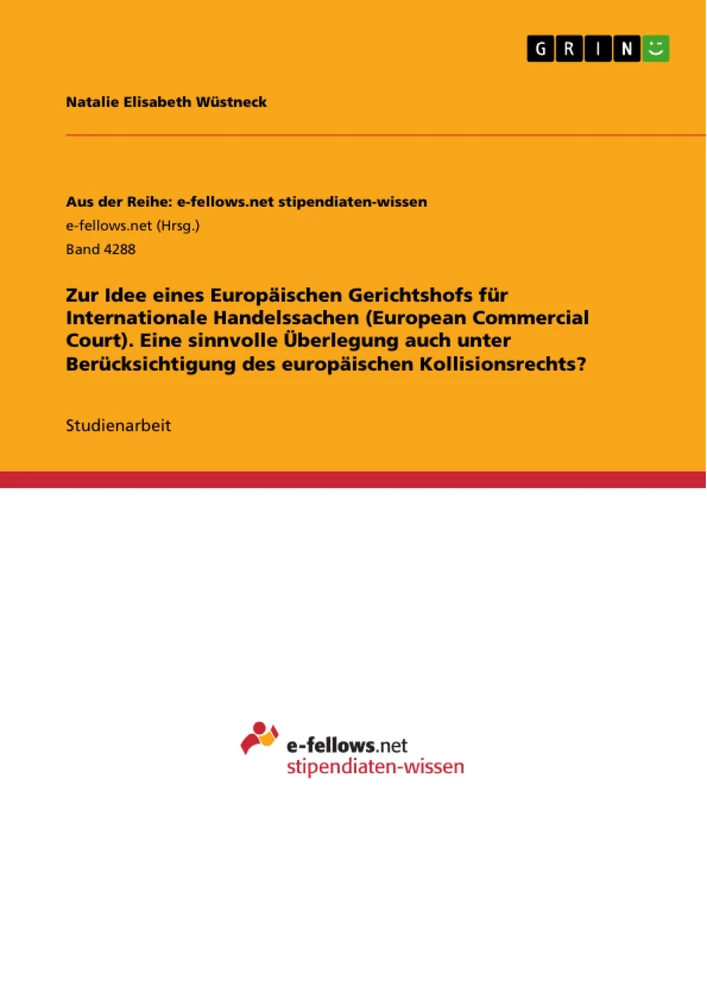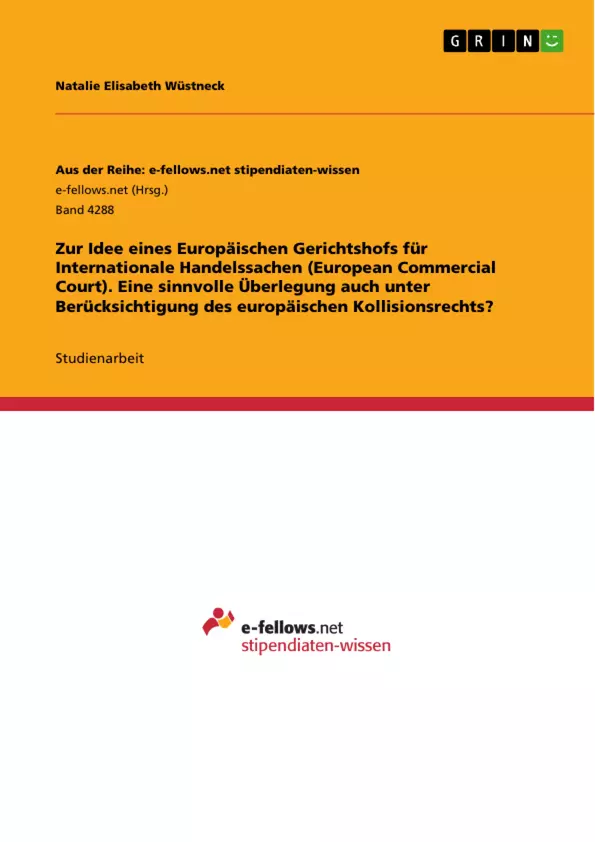Um die Frage zu beantworten, inwiefern ein europäischer Handelsgerichtshof (European Commercial Court, ECC) als Instrument zur Beilegung grenzüberschreitender Streitigkeiten im Binnenmarkt und darüber hinaus sinnvoll und geeignet wäre, Herausforderungen wie den border effect zu minimieren und die Attraktivität des Rechtsstandorts EU zu stärken, drängt sich eine intradisziplinäre Betrachtung der Probleme im internationalen Handelsverkehr, der derzeitigen Streitbeilegungslandschaft und Attraktivität verschiedener Streitbeilegungsmechanismen, Rechtsordnungen und Gerichtsstandorten nach empirischen, ökonomischen und rechtsvergleichenden Überlegungen geradezu auf.
Erkenntnisse dieser Überlegungen sollen hier als Leitfaden gelten, um zu erörtern, welche Rolle das Europäische Kollisionsrecht bei der möglichen Ausgestaltung eines kompetitiveren europäischen Handelsgerichts in Relation zu spezialisierten internationalisierten nationalen Gerichten in Europa spielt. Ferner, wie dieses optimiert werden könnte, um Unternehmerinteressen in größerem Umfang gerecht zu werden.
Der Fokus liegt hierbei auf Gerichtsstands- und Rechtswahlklauseln. Wie diese Freiheiten als Instrument im Rahmen des europäischen Kollisionsrechts reformiert werden könnten, um das Erfolgsversprechen eines ECC zu erfüllen, wird im Folgenden in Hinblick auf bestehende attraktivitätsmindernde rechtliche Einschränkungen in den entsprechenden Verordnungen untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- A) Bestandsaufnahme: Rechtliche Herausforderungen im Internationalen Handelsverkehr und der Status Quo von Commercial Courts in Europa
- I) Das Problem internationaler Transaktionen
- 1.) Starke Abweichungen in nebeneinanderstehenden nationalen Privat- und Verfahrensrechtsordnungen
- 2.) Law shopping through forum shopping
- II) Präferierte Wahl der Parteien - Jurisdiktionen und staatliche Gerichte im Wettbewerb
- 1.) „Wahlfreiheiten“ im internationalen Vertragsrecht
- a) Gerichtsstandsvereinbarungen - Parteiinteressen bei der Wahl des Forums
- b) Die Rechtswahl - Initiator eines Wettbewerbs der Rechtsordnungen
- 2.) Attraktivität der Schiedsgerichtsbarkeit gegenüber staatlichen Gerichten
- a) Schiedsgerichtsbarkeit in Zahlen
- b) Warum Schiedsverfahren so beliebt sind - Erklärungsversuch für die mangelnde Attraktivität staatlicher Gerichte
- c) Kritik an der Handelsschiedsgerichtsbarkeit
- III) Die EU - unattraktiver Streitbeilegungsort?
- 1.) Der europäische Markt - dominiert von London und der Schweiz
- 2.) Nationale Commercial Courts - enttäuschende Zahlen in Paris und Amsterdam und eingeschränktes Potenzial des Rechtsstandorts Deutschland
- a) Frankreich
- b) Niederlande
- c) Deutschland
- d) Fazit
- 3.) Fazit - die EU und ihre Mitgliedstaaten müssen aufholen!
- IV) European Commercial Court als Game Changer?
- 1.) Die Idee eines kompetitiveren Europäischen Handelsgerichts
- a) Bedeutung für die Entwicklung des europäischen Privatrechts und der europäischen Rechtsgemeinschaft
- b) Fairere und bessere Alternative für den Mittelstand und kleinere Unternehmen in Europa
- 2.) Errichtung, Ausgestaltung und Kompetenzen eines European Commercial Courts
- a) Sachliche Zuständigkeit eines Europäischen Handelsgerichts und auszulegendes Recht
- b) EU-Kompetenz zur Errichtung eines European Commercial Courts
- aa) Kein Fall des Art. 257 AEUV
- bb) Art. 81 AEUV als Kompetenzgrundlage
- c) Verhältnis zum EuGH und mitgliedstaatlicher höchstrichterlicher Rechtsprechung und Akzeptanz
- aa) EuGH
- bb) Mitgliedstaatliche Gerichte
- d) Integration in den europäischen Rechtsraum
- e) Fazit
- 3.) Kritik an der Idee internationaler Handelsgerichte bezogen auf den ECC
- B) Reformvorschläge und die Rolle des Europäischen Kollisionsrechts
- I.) Verbesserung der Verfahrensvorschriften - Expedited Procedure (EECP)
- II) Rechtswahlfreiheit als Instrument in den Rom-Verordnungen
- 1.) Rom I-Verordnung
- a) Art. 3 Rom I-VO - Restriktionen der Rechtswahl aufheben
- aa) Liberales Verständnis von Parteiautonomie
- bb) Gegenstand der Rechtswahl auf nichtstaatliches Recht erweitern
- b) Reine Inlandssachverhalte (Art. 3 Abs. 3 Rom I-VO) und Binnenmarktklausel (Art. 3 Abs. 4 Rom I-VO)
- c) Fazit
- 2.) Rom II-Verordnung
- III) Brüssel Ia VO
- 1.) Liberale Regelung der Zuständigkeit nach der Brüssel Ia-VO - Art. 25 Brüssel Ia-VO und der ECC
- 2.) Bilateral-konsensuale Wahl für den European Commercial Court
- 3.) Vollstreckbarkeit - auch außerhalb der EU?
- IV.) Expertise aufbauen!
- C) Kritische Beurteilung der Attraktivität eines European Commercial Courts - Eine sinnvolle Überlegung auch unter Berücksichtigung des europäischen Kollisionsrechts?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Idee eines Europäischen Gerichtshofs für Internationale Handelssachen (ECC) und bewertet dessen Sinnhaftigkeit. Sie analysiert die derzeitigen rechtlichen Herausforderungen im internationalen Handelsverkehr und den Status quo von Commercial Courts in Europa. Die Studie beleuchtet auch die Rolle des europäischen Kollisionsrechts bei der Gestaltung eines solchen Gerichts.
- Rechtliche Herausforderungen im internationalen Handelsverkehr
- Bewertung des Status Quo von Commercial Courts in Europa
- Analyse der Idee eines Europäischen Handelsgerichtshofs (ECC)
- Rolle des europäischen Kollisionsrechts
- Reformvorschläge zur Verbesserung der Attraktivität des ECC
Zusammenfassung der Kapitel
A) Bestandsaufnahme: Rechtliche Herausforderungen im Internationalen Handelsverkehr und der Status Quo von Commercial Courts in Europa: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Übersicht über die aktuellen Herausforderungen im internationalen Handelsverkehr, die durch stark abweichende nationale Rechtsordnungen und das Phänomen des "forum shopping" entstehen. Es analysiert die Beliebtheit der Schiedsgerichtsbarkeit im Vergleich zu staatlichen Gerichten und untersucht die Attraktivität der EU als Streitbeilegungsort im Kontext der dominierenden Rolle von London und der Schweiz. Die Analyse umfasst eine kritische Betrachtung nationaler Commercial Courts in Frankreich, den Niederlanden und Deutschland, um den bestehenden Bedarf für eine Reform zu unterstreichen.
B) Reformvorschläge und die Rolle des Europäischen Kollisionsrechts: Dieses Kapitel konzentriert sich auf mögliche Reformen zur Steigerung der Attraktivität eines ECC. Es untersucht die Verbesserung der Verfahrensvorschriften mittels einer beschleunigten Verfahrensweise (EECP) und die Bedeutung der Rechtswahlfreiheit gemäß den Rom-Verordnungen I und II. Die Analyse befasst sich mit der liberalen Regelung der Zuständigkeit nach der Brüssel Ia-VO und der Frage der Vollstreckbarkeit von Entscheidungen eines ECC auch außerhalb der EU. Der Aufbau von Expertise im Bereich des internationalen Handelsrechts wird als essentieller Faktor für den Erfolg des ECC hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Europäischer Gerichtshof für Internationale Handelssachen (ECC), Internationaler Handelsverkehr, Kollisionsrecht, Commercial Courts, Schiedsgerichtsbarkeit, Rechtswahl, Rom I-Verordnung, Rom II-Verordnung, Brüssel Ia-VO, EU-Recht, Parteiautonomie, Gerichtsstandsvereinbarung, Binnenmarkt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema: Europäischer Gerichtshof für Internationale Handelssachen (ECC)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Idee eines Europäischen Gerichtshofs für Internationale Handelssachen (ECC) und bewertet dessen Sinnhaftigkeit. Sie analysiert die derzeitigen rechtlichen Herausforderungen im internationalen Handelsverkehr und den Status quo von Commercial Courts in Europa. Die Studie beleuchtet auch die Rolle des europäischen Kollisionsrechts bei der Gestaltung eines solchen Gerichts und unterbreitet Reformvorschläge.
Welche rechtlichen Herausforderungen im internationalen Handelsverkehr werden betrachtet?
Die Arbeit identifiziert starke Abweichungen in nebeneinanderstehenden nationalen Privat- und Verfahrensrechtsordnungen und das Phänomen des "Law Shopping" (Forum Shopping) als zentrale Herausforderungen. Die unterschiedlichen Rechtsordnungen und die Möglichkeit, günstige Gerichtsstände auszuwählen, erschweren internationale Transaktionen.
Wie wird die Attraktivität von staatlichen Gerichten im Vergleich zur Schiedsgerichtsbarkeit bewertet?
Die Arbeit analysiert die Präferenzen von Parteien bei der Wahl von Jurisdiktionen und untersucht die Gründe für die Beliebtheit der Schiedsgerichtsbarkeit gegenüber staatlichen Gerichten. Sie beleuchtet die Kritik an der Handelsschiedsgerichtsbarkeit und die mangelnde Attraktivität staatlicher Gerichte, insbesondere im EU-Kontext.
Wie wird der Status Quo der Commercial Courts in Europa bewertet?
Die Arbeit analysiert den Status Quo von Commercial Courts in Europa, insbesondere in Frankreich, den Niederlanden und Deutschland. Sie stellt fest, dass London und die Schweiz dominieren und die EU-eigenen Commercial Courts im Vergleich enttäuschende Zahlen aufweisen und ein eingeschränktes Potenzial haben.
Welche Rolle spielt der European Commercial Court (ECC) als potenzieller "Game Changer"?
Die Arbeit untersucht die Idee eines ECC als kompetitiveres Europäisches Handelsgericht. Sie analysiert die Bedeutung des ECC für die Entwicklung des europäischen Privatrechts und die europäische Rechtsgemeinschaft, seine potenziellen Vorteile für den Mittelstand und kleinere Unternehmen und diskutiert dessen mögliche Ausgestaltung, Kompetenzen und das Verhältnis zum EuGH und mitgliedstaatlicher Gerichte.
Welche Reformvorschläge werden unterbreitet?
Die Arbeit schlägt Reformen vor, um die Attraktivität eines ECC zu steigern. Dies beinhaltet die Verbesserung der Verfahrensvorschriften durch eine beschleunigte Verfahrensweise (EECP), eine liberalisierte Rechtswahlfreiheit gemäß den Rom-Verordnungen I und II, eine liberale Regelung der Zuständigkeit nach der Brüssel Ia-VO und den Aufbau von Expertise im Bereich des internationalen Handelsrechts.
Welche Rolle spielt das Europäische Kollisionsrecht?
Das Europäische Kollisionsrecht, insbesondere die Rom I- und Rom II-Verordnungen und die Brüssel Ia-VO, spielt eine zentrale Rolle bei der Gestaltung und Attraktivität eines ECC. Die Arbeit analysiert, wie diese Verordnungen angepasst werden könnten, um die Rechtswahlfreiheit zu stärken und die Zuständigkeit des ECC zu regeln. Die Vollstreckbarkeit von Entscheidungen des ECC auch außerhalb der EU wird ebenfalls thematisiert.
Welche kritische Beurteilung des ECC wird vorgenommen?
Die Arbeit beinhaltet eine kritische Beurteilung der Attraktivität eines ECC unter Berücksichtigung des europäischen Kollisionsrechts. Sie analysiert die Sinnhaftigkeit der Errichtung eines solchen Gerichts im Kontext der bestehenden Herausforderungen und der vorgeschlagenen Reformen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter umfassen: Europäischer Gerichtshof für Internationale Handelssachen (ECC), Internationaler Handelsverkehr, Kollisionsrecht, Commercial Courts, Schiedsgerichtsbarkeit, Rechtswahl, Rom I-Verordnung, Rom II-Verordnung, Brüssel Ia-VO, EU-Recht, Parteiautonomie, Gerichtsstandsvereinbarung, Binnenmarkt.
- Quote paper
- Natalie Elisabeth Wüstneck (Author), 2023, Zur Idee eines Europäischen Gerichtshofs für Internationale Handelssachen (European Commercial Court). Eine sinnvolle Überlegung auch unter Berücksichtigung des europäischen Kollisionsrechts?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1361911