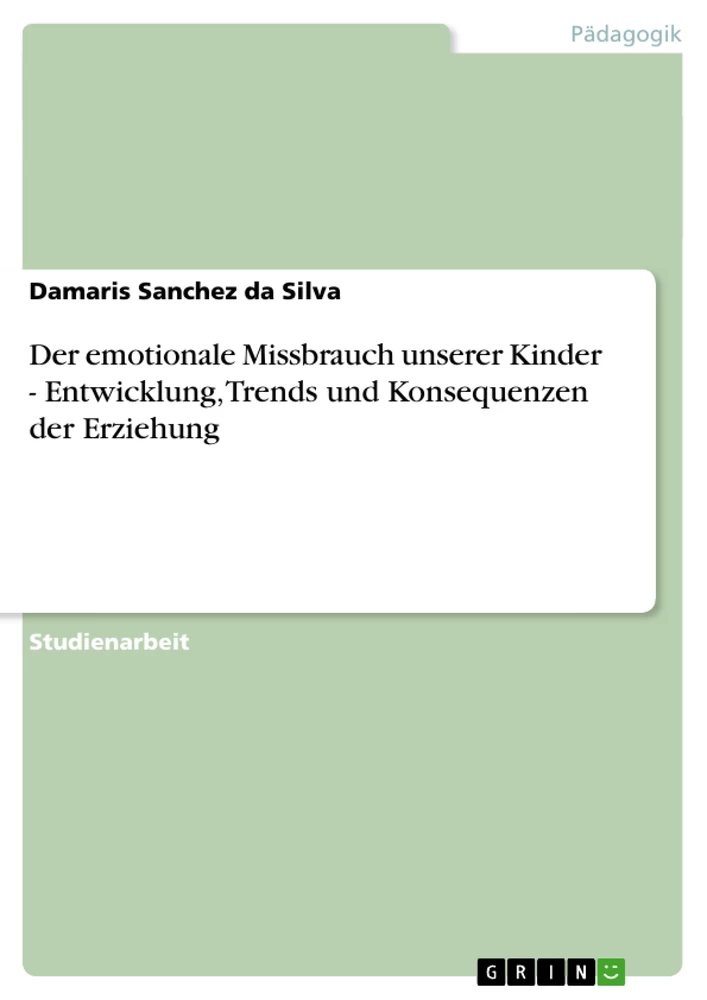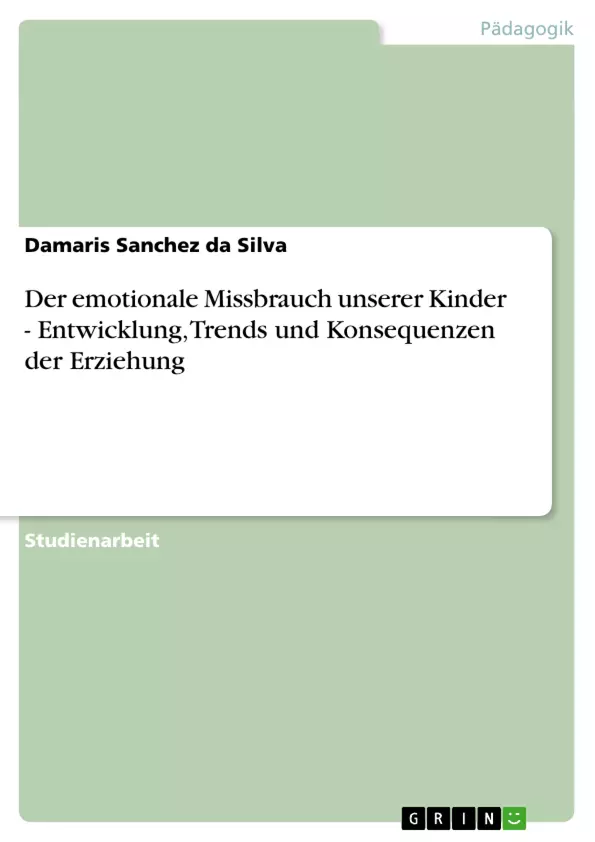Diese Arbeit befasst sich mit der Erziehung und ihrer Entwicklung: es stellt sich die Frage, ob
die Generation vor uns und unsere eigene in der Erziehung fehleranfällig war oder dies eine
normale Entwicklung in der Geschichte bleibt. Eine gewisse Verunsicherung gibt es bei der
Frage nach der richtigen Erziehung. Der Tenor zeigt uns eigentlich auf, dass die
Weiterentwicklung in den autoritativen Erziehungsstil abgeschlossen wird. Um das genauer
zu erklären und aufzuzeigen, werden die Erziehungsstile aus der historischen Perspektive
angeschaut. Weiter wird die Entwicklung der Erziehung und Pädagogik im 19. Jahrhundert
erläutert. Die Meinung des Psychologen Winterhoff zeigt in einem provokanten Stil den Ist-
Zustand der heutigen Gesellschaft gegenüber der Erziehung und den Problemen mit den
heutigen Kindern und Jugendlichen.[...]
Inhaltsverzeichnis
Einführung
1. Chancengerechtigkeit im schweizerischen Bildungswesen
1.1 Demographische Merkmale
1.2 Aktuelle Situation der Chancengerechtigkeit
1.3 Aktuelle Debatten zur Chancengerechtigkeit in der Schweiz
2. Umgang mit der unterschiedlichen Chancenverteilung
3. Empirische Befunde zur Chancengleichheit
3.1 Internationale Befunde
3.2 Empirische Befunde aus deutschsprachigen Ländern
4. Fazit
Literatur- und Quellenverzeichnis
Einführung
Schon im Grundschulalter haben Kinder unterschiedliche Kompetenzen. Dies hängt stark mit dem sozioökonomischen Status der Familie zusammen. Werden den Kindern mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen, die selben Anforderungen gestellt, werden die Unterschiede in Leistung und Bildungschancen verstärkt. Die Lebensqualität eines Einzelnen in der heutigen Gesellschaft hängt stark mit dem Einkommen und der beruflichen Position ab und je niedriger der sozioökonomische Status der Familie ist, desto eingeschränkter ist der Schulerfolg der Kinder (Heinzel 2008, S. 133). Im Folgenden werden die Chancenverteilungen im schweizerischen Bildungswesen skizziert und die Konzepte zum Umgang mit den Unterschieden in der Chancengerechtigkeit vorgestellt. Zuletzt wird auf den heutigen Forschungsstand eingegangen.
1. Chancengerechtigkeit im schweizerischen Bildungswesen
In diesem Kapitel werden zuerst die Demographischen Merkmale der Schweiz aufgezeigt, so dass man die aktuelle Situation der Chancengerechtigkeit in der Schweiz in Bezug zum sozioökonomischen Status besser versteht. In einem weiteren Teil wird die aktuelle Debatte zur Chancengerechtigkeit in der Schweiz aufgegriffen.
1.1 Demographische Merkmale
Die Schweiz hat rund 7,6 Millionen Einwohner (Angaben aus dem Jahr 2007, BFS 2008). Im Vergleich zu 1980 ist der Anteil von über 40-Jährigen stark gestiegen, dagegen hat der Anteil von unter 20-Jährigen stark abgenommen. Etwas mehr als 2/3 der Bevölkerung der Schweiz lebt in städtischen Gebieten. In der Schweiz sind 4 Sprachen als Landessprache anerkannt. Ca. 63% der Bevölkerung spricht Deutsch, 20% der Bevölkerung spricht Französisch, ca. 6% spricht Italienisch und knapp 0.5% spricht Rätoromanisch. Andere Sprachen sind zu ca. 9% in der Schweizer Bevölkerung vertreten (Angaben aus dem Jahr 2000, BFS 2004).
„Im schweizerischen Durchschnitt absolvierten rund 47% der männlichen und rund 44% der weiblichen 15- bis 21-jährigen Personen zum Zeitpunkt der letzten Volkszählung eine Ausbildung auf der Sekundarstufe II. Die restlichen Personen dieser Altersgruppe befanden sich entweder noch in der obligatorischen Ausbildung, bereits in einer weiterführenden, tertiären Ausbildung oder im Berufsleben“[1] Im Jahr 2007 hatte die Schweiz fast 178'000 Studenten an Fachhochschulen und Universitäten.[2]
1.2 Aktuelle Situation der Chancengerechtigkeit
Studien von Volken & Knöpfel aus dem Jahr 2004 zeigen, dass die kurzzeitige Armut in der Schweiz relativ weit verbreitet ist und dass in den obersten und untersten Positionen der Einkommenshierarchie die Tendenz zum Verbleib der Armut hoch ist. Bauer & Streuli (2001) zeigen, dass eine abgeschlossene Berufslehre das Armutsrisiko um die Hälfte verringert und für Erwerbstätige mit einem universitären Abschluss sinkt das Risiko auf weniger als 1%. Weiter zeigen Bauer & Streule, dass die finanziell präkere Situation vieler Personen mit Migrationshintergrund zu einem Grossteil durch mangelnde nachobligatorische Ausbildung hervorgerufen wird (Trendbericht SKBF 2005, S. 12).
20,5% der Bevölkerung sind Ausländerinnen und Ausländer, die sich in der Schweiz niedergelassen haben. Werden Eingebürgerte mitgerechnet sind es sogar 27,9% (Volkszählung 2000). Etwas mehr als die Hälfte der Ausländer leben seit über 15 Jahren in der Schweiz oder sind hier geboren. (Trendbericht SKBF 2005, S. 12f.)
Die seit dem Jahr 2000 durchgeführten PISA-Erhebungen zeigen, dass die Schulleistungen und die Bildungskarriere eines Kindes stark vom familiären Umfeld beeinflusst werden und dass auch die soziale Herkunft ein starker Bestimmungsfaktor für den schulischen Erfolg ist.
1.3 Aktuelle Debatten zur Chancengerechtigkeit in der Schweiz
Lange konzentrierte sich die Debatte zum Thema Chancengerechtikeit im Bildungswesen Schweiz auf die Ungleichbehandlung der Geschlechter und auf die Integration von Personen mit Migrationshintergrund (Trendbericht SKBF 2005, S. 19). Nun muss sich die Debatte aber auch mit Hindernissen und Barrieren im Bildungssystem für allgemein sozioökonomisch Benachteiligte befassen. Es geht nicht mehr nur um die erfolgreiche Intergration der Migrantenkinder, es geht nun auch um die sozioökonomische Situation der immigrierten Bevölkerung.
[...]
[1] http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/regionen/thematische_karten/gleichstellungsatlas/ausbildung/sek2_teiligung.html
[2] http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/15/06/tab/blank/uebersicht.html
Häufig gestellte Fragen
Was beeinflusst die Chancengerechtigkeit im Schweizer Bildungswesen?
Der sozioökonomische Status der Familie ist der stärkste Bestimmungsfaktor für den Schulerfolg und die spätere Bildungskarriere eines Kindes.
Welchen Einfluss hat ein Migrationshintergrund auf die Bildungschancen?
Finanzielle prekäre Situationen und mangelnde nachobligatorische Ausbildung bei Migranten führen oft zu geringeren Aufstiegschancen im Bildungssystem.
Was zeigen die PISA-Studien für die Schweiz?
PISA-Ergebnisse belegen regelmäßig, dass Schulleistungen in der Schweiz stark vom familiären Umfeld und der sozialen Herkunft abhängen.
Wie hat sich die Debatte zur Chancengerechtigkeit gewandelt?
Früher lag der Fokus auf Geschlechtergleichstellung; heute stehen Barrieren für sozioökonomisch Benachteiligte und die Integration von Migranten im Zentrum.
Warum verstärken gleiche Anforderungen für alle Kinder die Ungleichheit?
Wenn Kinder mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen dieselben Anforderungen ohne individuelle Förderung erhalten, vergrößern sich die Leistungsunterschiede im Laufe der Schulzeit.
- Arbeit zitieren
- Damaris Sanchez da Silva (Autor:in), 2008, Der emotionale Missbrauch unserer Kinder - Entwicklung, Trends und Konsequenzen der Erziehung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/136208