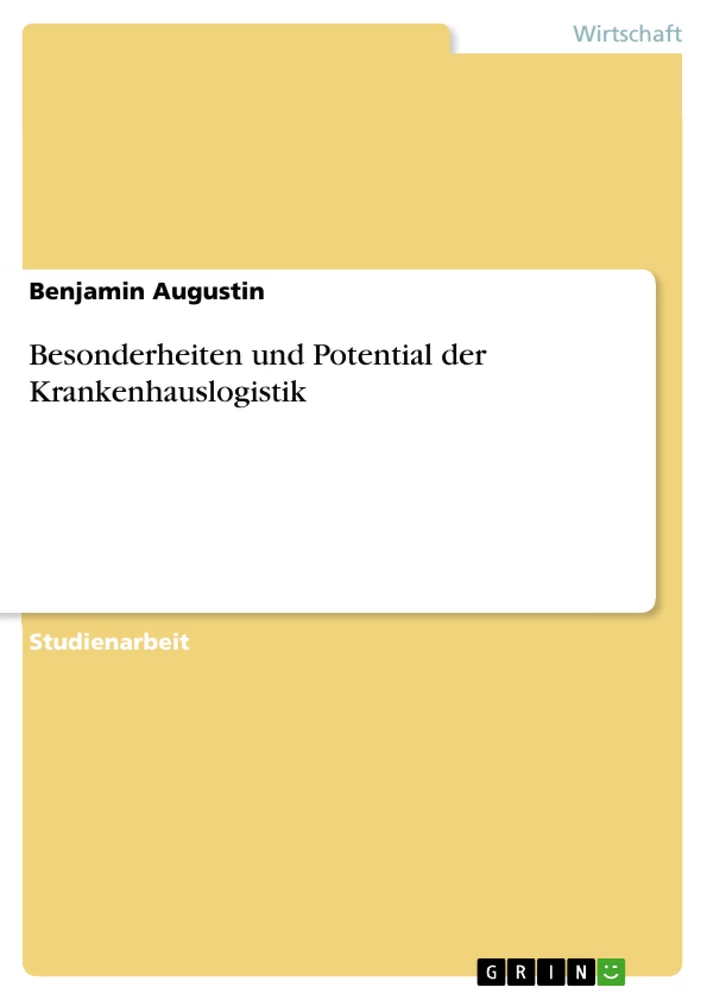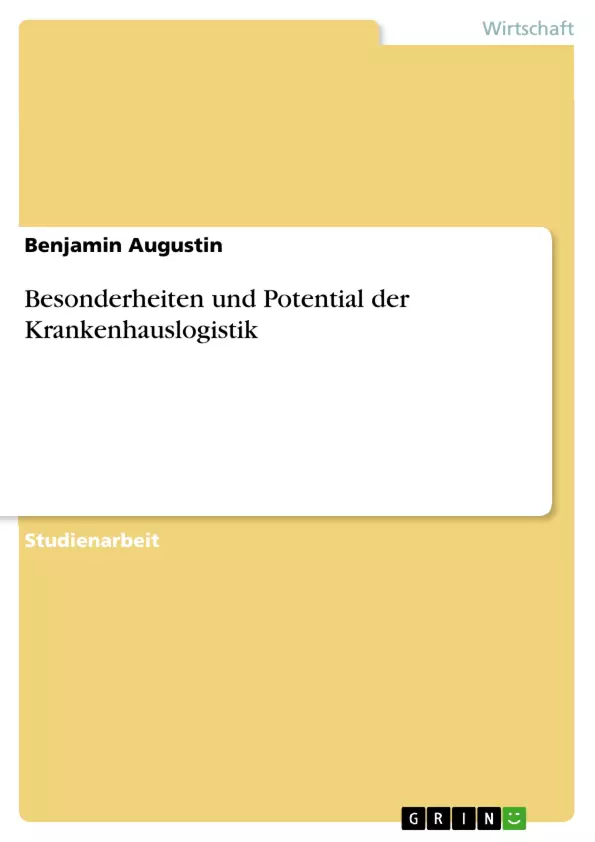Das Gesundheitswesen in Deutschland sieht sich mit einem ansteigenden Kostendruck konfrontiert. Dieser resultiert aus der demographischen Veränderung und aus technologischen Erneuerungen. Zusätzlich wird dieser Zustand durch die zunehmend leeren öffentlichen Kassen und der Forderung nach niedrigen Beitragssätzen bei den gesetzlichen Krankenversicherungen verschärft. Aus dem Zwiespalt zwischen der sozialstaatlichen Verantwortung und der angespannten Haushaltslage ergibt sich die Notwendigkeit zu einer verstärkten betriebswirtschaftlichen Orientierung. Insbesondere im Krankenhaussektor spielt dieses eine übergeordnete Rolle, da Krankenhäuser den höchsten Kostenfaktor des Gesundheitswesens darstellen. Dies hatte zur Folge, dass zahlreiche Krankenhäuser privatisiert wurden, um den Wettbewerb unter ihnen zu forcieren und so Kosten-senkungspotentiale auszuschöpfen.
Die größten Einsparungsmöglichkeiten liegen in der Reorganisation der logistischen Prozesse des Krankenhauses. Daher befasst sich diese Arbeit mit verschiedenen Prozessen in der Krankenhauslogistik. Den Ein-stieg stellt eine Betrachtung der Dienstleistungsbranche unter Berücksichtigung spezieller Merkmale von Gesundheitsdienstleistungen dar. Anschließend wird sowohl auf die Besonderheiten als auch Problemfelder der jeweiligen Abläufe eingegangen und diese werden anhand praktischer Beispiele belegt. Die darauf folgende Marktbeurteilung setzt sich zunächst mit dem aktuellen Trend und danach mit den Zukunftsaussichten der Branche auseinander. Den Abschluss der Arbeit bildet eine Zusammenfassung und kritische Würdigung der Thematik.
Ziel dieser Arbeit ist es, die logistischen Prozesse, welche in der Industrie bereits weitestgehend optimiert sind und schon lange aus Kostengesichtspunkten betrachtet werden, auf die Handhabung in Krankenhäusern zu beziehen.
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Branchenbetrachtung
2.1 Allgemeine Dienstleistungen
2.2 Gesundheitsdienstleistungen
2.3 Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen
3. Logistische Prozesse
3.1 Überblick
3.2 Anwendungsfelder im Krankenhaus
3.2.1 Patiententransport
3.2.2 Informationsdienstleistungen
3.2.3 Medikamenten- und Apothekendienste
3.2.4 Ernährungs- und Gastronomiedienstleistungen
3.2.5 Sonstige logistische Prozesse
4. Marktbeurteilung
4.1 Anteil am Gesamtmarkt
4.2 Trend und Ausblick
5. Fazit
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Begleitung und Übergabe prämidizierter Patienten
Abbildung 2: Apothekengüterversorgung
Abbildung 3: Speisenversorgung
Abbildung 4: Anteil der Gesundheitsausgaben am BIP
Abbildung 5: Anteil nach Einrichtungen
1. Einleitung
Das Gesundheitswesen in Deutschland sieht sich mit einem ansteigenden Kostendruck konfrontiert. Dieser resultiert aus der demographischen Veränderung und aus technologischen Erneuerungen. Zusätzlich wird dieser Zustand durch die zunehmend leeren öffentlichen Kassen und der Forderung nach niedrigen Beitragssätzen bei den gesetzlichen Krankenversicherungen verschärft. Aus dem Zwiespalt zwischen der sozialstaatlichen Verantwortung und der angespannten Haushaltslage ergibt sich die Notwendigkeit zu einer verstärkten betriebswirtschaftlichen Orientierung. Insbesondere im Krankenhaussektor spielt dieses eine übergeordnete Rolle, da Krankenhäuser den höchsten Kostenfaktor des Gesundheitswesens darstellen. Dies hatte zur Folge, dass zahlreiche Krankenhäuser privatisiert wurden, um den Wettbewerb unter ihnen zu forcieren und so Kostensenkungspotentiale auszuschöpfen.
Die größten Einsparungsmöglichkeiten liegen in der Reorganisation der logistischen Prozesse des Krankenhauses. Daher befasst sich diese Arbeit mit verschiedenen Prozessen in der Krankenhauslogistik. Den Einstieg stellt eine Betrachtung der Dienstleistungsbranche unter Berücksichtigung spezieller Merkmale von Gesundheitsdienstleistungen dar. Anschließend wird sowohl auf die Besonderheiten als auch Problemfelder der jeweiligen Abläufe eingegangen und diese werden anhand praktischer Beispiele belegt. Die darauf folgende Marktbeurteilung setzt sich zunächst mit dem aktuellen Trend und danach mit den Zukunftsaussichten der Branche auseinander. Den Abschluss der Arbeit bildet eine Zusammenfassung und kritische Würdigung der Thematik.
Ziel dieser Arbeit ist es, die logistischen Prozesse, welche in der Industrie bereits weitestgehend optimiert sind und schon lange aus Kostengesichtspunkten betrachtet werden, auf die Handhabung in Krankenhäusern zu beziehen.
2. Branchenbetrachtung
2.1 Allgemeine Dienstleistungen
Die Dienstleistungsbranche erfährt in Deutschland schon seit längerer Zeit einen enormen Aufschwung. In den vergangenen drei Jahrzehnten konnte eine beträchtliche Verschiebung der Erwerbstätigkeit festgestellt werden. Während per Saldo im produzierenden Gewerbe, Land- und Forstwirtschaft und Fischerei in Westdeutschland Stellen verloren gingen, entstanden im Dienstleistungsbereich zahlreiche neue Stellen. Besonders starkes Wachstum kann im Bereich der Rechts- und Wirtschaftsberatung sowie in anderen unternehmensnahen Servicebranchen beobachtet werden. Laut Statistischem Bundesamt verfünffachte sich die Zahl der dort Beschäftigten.[1] Ein Großteil dieser Verschiebungen auf dem Arbeitsmarkt kann an den folgenden fünf Punkten festgemacht werden: Zum einen kam es aufgrund des gestiegenen Pro-Kopf-Einkommens zu starken Nachfrageverschiebungen. Sobald der Konsument einen gewissen Standard erreicht hat, nimmt die Nachfrage nach Dienstleistungen stärker zu, als der Bedarf an industriellen Gütern. Eine weitere Ursache ist die Entwicklung neuer Produkte, wie z. B. dem Handy, und die damit einhergehenden neuen Branchen. Auch hat die Automatisierung in der produzierenden Industrie zu starken Produktivitätssteigerungen bei gleichzeitigem Rückgang an Arbeitsplätzen in diesem Sektor geführt. Im Dienstleistungsbereich ist diese Reduzierung an Arbeitsplätzen nicht zu erwarten. Zunehmend ist auch die ausländische Konkurrenz eine Ursache für die Beschäftigungsverschiebungen. Zahlreiche Unternehmen gliedern ihre Produktionsstätten in Billiglohnländer aus. Dieses Vorgehen ist im Dienstleistungssektor nur in geringem Maße möglich. Abschließend ist die veränderte Arbeitsorganisation zu nennen. Zahlreiche Unternehmen gliedern aufgrund des gestiegenen Kostendrucks einen Teil ihrer ehemaligen EDV-, Marketing-, Marktforschungs-, Forschungs- und Entwicklungs- sowie Wartungs-, Reparatur- und sonstigen Serviceabteilungen aus. Dadurch werden eine Reihe neuer selbstständiger Gesellschaften gegründet, welche in den Statistiken dann neuerdings als Dienstleistungsunternehmen eingehen.[2]
Das Gebiet der allgemeinen Dienstleistungen ist weitaus umfangreicher als es die für uns typischen Dienstleistungsbranchen wie z. B. Verkehrssysteme (z. B. Bus und Bahn), medizinische und soziale Einrichtungen, Banken, Versicherungen, Tourismus sowie Gaststätten- und Hotelgewerbe erscheinen lassen. Aufgrund der Heterogenität in diesem Sektor wird die Dienstleistung je nach Quelle auch sehr unterschiedlich definiert. Jedoch weisen alle Definitionen sehr ähnliche Charakteristika auf.
Eine Dienstleistung wird stets als ein Produkt verstanden, dessen Merkmale immaterieller Natur sind. Mit dieser Immaterialität gehen auch die Intangibilität, die Nicht-Lagerbarkeit und die Nicht-Transportfähigkeit von Dienstleistungen einher. Weitere Gemeinsamkeiten aller Dienstleistungen sind die simultan stattfindende Produktion und ihre Übertragung (auf den Nachfrager), die Teilnahme des Käufers an der Erstellung, sowie die Tatsache, dass das Eigentum an dieser nicht wechseln kann. Auch kann die Dienstleistung vor dem Verkauf weder gezeigt noch geprüft werden.[3] Ein weiteres Charakteristikum ist die Integration eines externen Faktors. So kann eine Dienstleistung nur unter Beteiligung des Nachfragers oder eines ihm gehörenden Objektes produziert werden. Beispielsweise muss der Kunde an einer Weiterbildung persönlich teilnehmen, bzw. beim Autowaschen das Auto in die Waschstraße fahren. Auch haben die meisten Dienstleistungen die Gemeinsamkeit, dass sie nur schwer standardisiert werden können und ihre Qualität und Quantität auch aus diesem Grunde nur schwer messbar ist.[4]
Die Abgrenzung der Dienst- von der Sachleistung wird durch die sehr häufig anzutreffende Kombination beider erschwert. So ist die Produktion eines Sachguts ohne jegliche Dienstleistung nicht denkbar. Annähernd jedes Sachgut benötigt sowohl eine Forschungs- und Entwicklungs-, als auch eine Vertriebsleistung bevor es abgesetzt werden kann. Dahingegen kann eine Dienstleistung sehr wohl ohne eine Sachleistung existieren.[5] Hinzu kommt, dass viele Serviceleistungen bereits gesetzlich vorgeschrieben sind. Auch aufgrund der immer deutlicher werdenden Macht des Kunden und dem zunehmend wachsenden Wettbewerb auf nahezu allen Absatzmärkten von Sachleistungen, versuchen die Produzenten sich von der Konkurrenz zu differenzieren. Neben der Preissetzung kann dies am einfachsten über die zusätzlich angebotenen Serviceleistungen erreicht werden, welche auf die Kundenzufriedenheit wirken.[6] Die Art und Qualität von zusätzlichen Dienstleistungen kann den Verkauf der Sachgüter sowohl fördern, als auch hemmen. Bei der Erlangung von Wettbewerbsvorteilen durch Dienstleistungsqualität können u. a. folgende Kriterien eine entscheidende Rolle spielen: Mitarbeiterqualifikation, Kompetenz der Mitarbeiter, Freundlichkeit/Höflichkeit, Glaubwürdigkeit der Kundenberatung, Kommunikation, Lieferung, Reparatur, Montage, Erreichbarkeit, Auftragsabwicklung, Kulanzverhalten, Zusatzleistungen wie Service, Garantiedauer etc., gesamtes Auftreten des Unternehmens.[7] So wirken diese Dienstleistungen auf die Kundenzufriedenheit.
2.2 Gesundheitsdienstleistungen
Unter dem Begriff der Gesundheitsdienstleistungen werden zahlreiche medizinische und pflegerische Dienstleistungen zusammengefasst. Dabei handelt es sich vor allem um Krankenhausleistungen, ambulante medizinische und zahnmedizinische Versorgung, Rehabilitations- und Altenpflegeleistungen sowie Krankengymnastik und alternative medizinische Leistungen. Ebenfalls kommen auch mehr und mehr Beratungs- und Vorsorgeleistungen zu diesem Leistungsbereich hinzu. In den letzten Jahren war zudem ein verstärkter Trend zu kosmetischen Gesundheitsdienstleistungen und so genannten “Wellness-Dienstleistungen“ erkennbar (z. B. in den Bereichen Schönheit, Fitness und Ernährung).[8] Hieraus lässt sich erkennen, dass der Sektor der Gesundheitsdienstleistungen einen großen Wachstumsmarkt darstellt. So hat sich in den vergangenen 30 Jahren die Anzahl der Beschäftigten in diesem Dienstleistungsbereich in den alten Bundesländern mehr als verdreifacht.[9]
Bei der wirtschaftlichen Betrachtung von Gesundheitsdienstleistungen unterscheidet man zwischen den Leistungserbringern (Produzent, z. B. Krankenhaus) und -empfängern (Konsument, z. B. Patient).[10] Die Finanzierung der Gesundheitsleistungen werden heute durch die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV), die Private Krankenversicherung (PKV), die Soziale Pflegeversicherung (SPV), die Gesetzliche Unfallversicherung (GUV), die Gesetzliche Rentenversicherung (GRV), über Patientenzuzahlungen, Steuern und über eine Arbeitgeberbeteiligung finanziert. In der Regel gilt für alle GKV-Versicherten, welche in etwa einen Anteil von gut 90 Prozent der Versicherten ausmachen, das Sachleistungsprinzip, welches zur Folge hat, dass die Kosten der Behandlung des Patienten zu Lasten der Krankenkassen gehen. Da die Kosten der GKV durch einen bruttolohnbezogenen Versicherungsbeitrag abgedeckt werden, steigen die Lohnnebenkosten mit jeder Erhöhung der Beiträge an. Dadurch werden strukturelle Probleme, wie z. B. die Arbeitslosigkeit, verstärkt.[11] Vor allem um diese Folgen zu reduzieren und im besten Fall zu vermeiden, müssen vom Patienten verstärkt Zuzahlungen getätigt werden, wie an den Beispielen des Zahnersatzes und der Praxisgebühr zu erkennen ist.[12]
[...]
[1] Vgl. Haller, S. [2005] S. 4
[2] Vgl. Haller, S. [2005] S. 4 ff.
[3] Vgl. Haller, S. [2005] S. 10
[4] Vgl. Haller, S. [2005] S. 8
[5] Vgl. Haller, S. [2005] S. 7
[6] Vgl. Nagl, A. / Rath V. [2004] S. 26
[7] Vgl. Nagl, A. / Rath V. [2004] S. 29
[8] Vgl. Lindl, C. [2005] S. 65 ff.
[9] Vgl. Haller, S. [2005] S. 4
[10] Vgl. Lindl, C. [2005] S. 65 ff.
[11] Vgl. Stolpe, M. [2003] S.55 ff.
[12] Vgl. http://www-bior.wiwi.uni-kl.de/wiwi/dekanat/blank/Segelseminar2006/referate/Gesundheitsdienstleistungen.pdf; S.6
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Krankenhauslogistik heute so wichtig?
Aufgrund steigenden Kostendrucks im Gesundheitswesen bietet die Optimierung logistischer Prozesse (z. B. Patiententransport, Medikamentenversorgung) enorme Einsparungspotenziale.
Welche logistischen Prozesse gibt es im Krankenhaus?
Dazu gehören der Patiententransport, Informationsdienstleistungen, Medikamenten- und Apothekendienste sowie Ernährungs- und Gastronomieleistungen.
Was sind die Besonderheiten von Gesundheitsdienstleistungen?
Sie sind immateriell, nicht lagerbar und erfordern die Integration des Patienten als externen Faktor in den Erstellungsprozess.
Wie beeinflusst die Privatisierung den Krankenhaussektor?
Privatisierungen forcieren den Wettbewerb und zwingen Krankenhäuser zu einer stärkeren betriebswirtschaftlichen Orientierung, um Kosten zu senken.
Was ist der "externe Faktor" in der Krankenhauslogistik?
Der externe Faktor ist der Patient selbst oder ein ihm gehörendes Objekt, ohne dessen Mitwirkung die medizinische Dienstleistung nicht erbracht werden kann.
- Arbeit zitieren
- Benjamin Augustin (Autor:in), 2007, Besonderheiten und Potential der Krankenhauslogistik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/136231