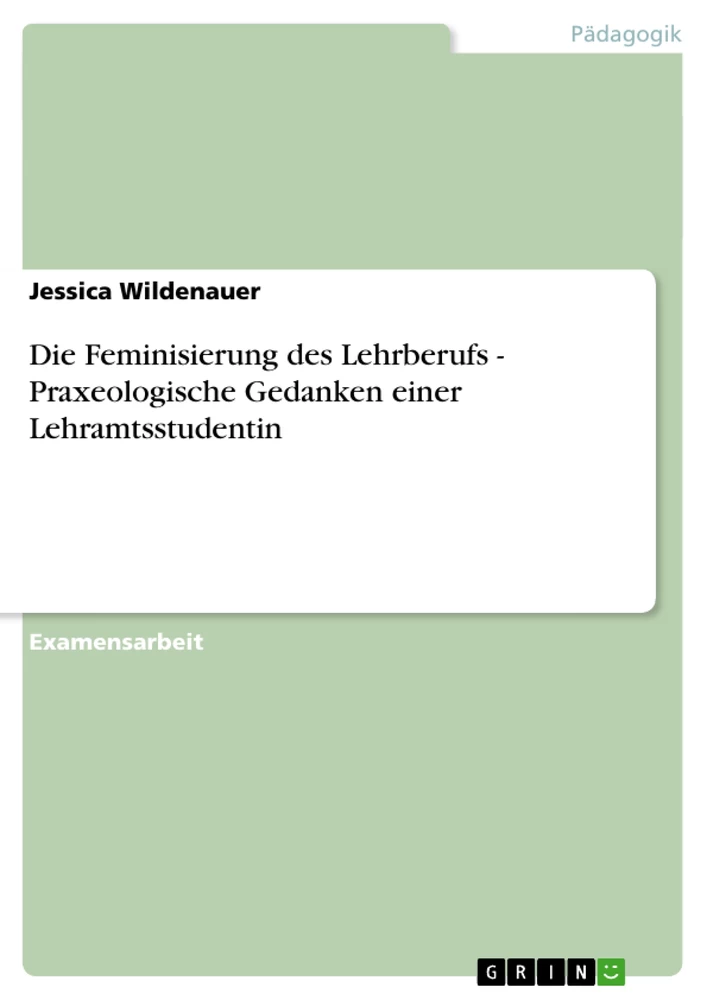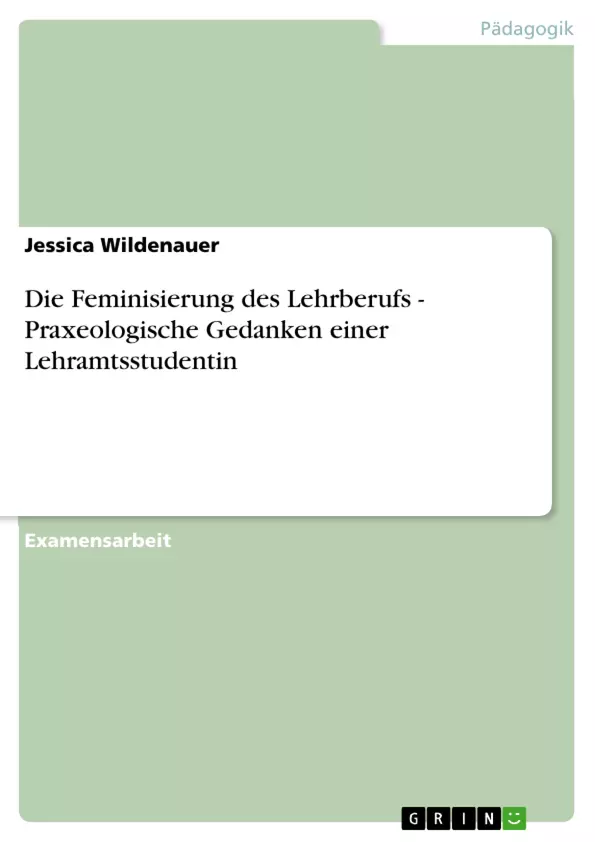Wenn das Augenmerk auf Frauen im Lehrberuf gelegt wird, bedeutet das, dass die Kategorie Geschlecht in Erörterungen Einzug gehalten hat, die außerhalb des eigentlich biologisch-wissenschaftlichen Rahmens stattfinden, weil sie gesellschaftliche Topoi diskutieren. Geschlecht als solches gestaltet sich recht facettenreich je nach Diskussionsrichtung. Im Zusammenhang mit dem Lehrberuf geschieht aber auch immer eine – bewusste oder unbewusste – Wertung, welche weder positiv für die Frauen noch für deren Arbeit ausfällt.
Nahezu überall in Politik und Medien kursieren Fragen, die unter dem Deckmantel der Fachkundigkeit problematisieren, ob Erziehung „Weibersache“ wird oder gar schon ist, und so die Arbeit von Frauen degradieren.
Was verbindet man mit Feminisierung des Lehrberufs also? Warum ist das Hervorheben des Geschlechts für einen Beruf und im Alltag scheinbar relevant? Teil I dieser Arbeit wird allgemeine Arbeitsdefinitionen für die „Feminisierung“ sowie „Geschlecht“ formulieren. Um diese Elemente und die folgende Diskussion des Leitthemas fundieren zu können, schließt sich außerdem eine Einordnung der Sozialisationsbegrifflichkeit an, die für die Instanz der Schule und geschlechtliche Ausprägung präzisiert werden soll.
Was genau bedeuten jedoch Forderungen nach mehr Männern im Schulsystem und warum wird die so genannte Feminisierung angeklagt, verurteilt und hinzurichten versucht?
Der Beantwortung dieser Fragen und vieler, die sich innerhalb meiner Darlegung ergeben werden, soll sich die vorliegende Arbeit annehmen. Dabei wird zum einen eruiert, inwiefern und ob tatsächlich ein Zuviel an Lehrerinnen existiert. Hierfür wird ein sozialgeschichtlicher Abriss über Frauen im Lehrberuf Grundlage des Teils II sein, der der unterstellten Übernahme des Berufsfeldes durch Frauen historisch begegnet und die Feminisierung so auch aktuell zu verorten weiß. Auf dieser Basis gestaltet sich die anschließende konkrete Erörterung der ‚Verweiblichung’ der Schule. Dazu werden Datensätze aus Sachsen zur Illustration verwendet sowie in Beziehung zu deutschlandweiten gesetzt.
Den anderen thematische Schwerpunkt bildet der Umgang mit Geschlecht in der pädagogischen Praxis, der im Teil III aufbereitet wird: Bildung ist nur dann wirklich eine erfolgreiche, wenn sie nicht einengt und für niemanden Chancen verbaut oder Möglichkeiten offen lässt. Deswegen soll am Ende der Ausarbeitung ein Konzept für den Umgang mit Geschlecht in pädagogischer Praxis beschrieben werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- Teil I - Theoretische Grundlagen
- 2. Zum Begriff „Feminisierung“
- 3. Arbeitsdefinition zur Kategorie „Geschlecht“
- 4. Sozialisation
- 4.1 Allgemeine Arbeitsdefinition
- 4.2 Schulische Sozialisation
- 4.3 Geschlechtsspezifische Sozialisation
- Teil II - Feminisierung
- 5. Sozialgeschichtlicher Abriss: Frauen im Lehrberuf
- 5.1 Frauen im Lehrberuf ab dem 19. Jahrhundert
- 5.1.1 Veränderungen der sozialen und familialen Position der Frau
- 5.1.2 Lehrerinnen im Spannungsfeld von Vorurteilen
- 5.1.3 Stand, Ausbildung und Arbeitsmarkt der Lehrerinnen
- 5.1.4 Lehrerinnenzölibat
- 5.2 Frauen im Lehrberuf zur Zeit der Weimarer Republik
- 5.3 Frauen im Lehrberuf zur Zeit des Nationalsozialismus
- 5.4 Frauen im Lehrberuf in der Nachkriegszeit bis in die 1950er Jahre
- 5.5 Frauen im Lehrberuf seit den 1960er Jahren
- 6. Feminisierung
- 6.1 Feminisierung – Geschichtliche Verortung
- 6.2 Feminisierung ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
- 6.2.1 Vorbemerkungen
- 6.2.2 Berufswahlmotivation von Frauen für den Lehrberuf
- 6.3 Feminisierung – aktuell diskutiert
- 6.3.1 Horizontale Verteilung
- 6.3.2 Vertikale Verteilung
- 6.4 Zusammenfassung
- Teil III - Geschlecht in pädagogischer Praxis
- 7. „Geschlecht“ in pädagogischer Praxis
- 7.1 Schulstruktur Koedukation - Gewinnerinnen und Verlierer?
- 7.2 Geschlechtsdifferenzen als problematische Grundlage der Pädagogik
- 7.3 Heimlicher Lehrplan: Geschlechtsstereotype und Unterricht
- 8. Geschlechtersensibler und -gerechter Unterricht
- 9. Abschließende Erörterung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Feminisierung des Lehrberufs aus praxeologischer Perspektive einer Lehramtsstudentin. Ziel ist es, die gängigen Diskurse um eine angebliche "Überweiblichung" des Schulsystems kritisch zu hinterfragen und den Umgang mit Geschlecht in der pädagogischen Praxis zu beleuchten. Die Arbeit vermeidet eine einseitige Bewertung und strebt nach einer ausgewogenen Betrachtungsweise.
- Geschlechterrollen und Stereotype im Bildungssystem
- Historische Entwicklung des Frauenanteils im Lehrberuf
- Sozialisation und ihre Auswirkungen auf die Berufswahl
- Geschlechtersensible Pädagogik und Unterricht
- Kritische Auseinandersetzung mit dem Diskurs um die "Feminisierung" der Schule
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Feminisierung des Lehrberufs ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Relevanz des Geschlechts für diesen Beruf in den Mittelpunkt. Sie problematisiert die gängigen, oft wertenden Diskurse und hebt die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtungsweise hervor. Die Autorin kündigt die Struktur der Arbeit an und benennt die Leitfragen, die im Laufe der Arbeit beantwortet werden sollen. Die Einleitung betont die Komplexität des Themas und die Notwendigkeit interdisziplinärer Ansätze.
Teil I - Theoretische Grundlagen: Dieser Teil legt die theoretischen Grundlagen für die spätere Analyse fest. Er definiert die Begriffe "Feminisierung" und "Geschlecht" und beleuchtet den Einfluss von Sozialisationsprozessen, insbesondere der schulischen und geschlechtsspezifischen Sozialisation, auf die Entwicklung von Geschlechterrollen und -identitäten. Dieser Teil liefert das konzeptionelle Fundament für die anschließende Auseinandersetzung mit der historischen Entwicklung und der aktuellen Situation.
Teil II - Feminisierung: Dieser Teil bietet einen sozialgeschichtlichen Abriss der Entwicklung des Frauenanteils im Lehrberuf, beginnend mit dem 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Er analysiert die Veränderungen der sozialen und familiären Position der Frau, die Vorurteile gegenüber Lehrerinnen und ihre Auswirkungen auf deren Stand, Ausbildung und Arbeitsmarkt. Der Teil beleuchtet auch den Lehrerinnenzölibat und die Entwicklungen in verschiedenen historischen Epochen (Weimarer Republik, Nationalsozialismus, Nachkriegszeit). Dieser umfassende historische Überblick dient als Basis für die aktuelle Analyse der Feminisierungstendenzen und deren Auswirkungen. Die Kapitel untersuchen die geschichtliche Verortung des Begriffs "Feminisierung" und beleuchten die Berufswahlmotivation von Frauen für den Lehrberuf. Der Teil gipfelt in einer Zusammenfassung der geschichtlichen und aktuellen Entwicklungen, die als Grundlage für die Diskussion der Auswirkungen auf die pädagogische Praxis dient.
Teil III - Geschlecht in pädagogischer Praxis: Dieser Teil fokussiert auf den Umgang mit Geschlecht in der pädagogischen Praxis. Er untersucht die Auswirkungen der Schulstruktur (Koedukation) und problematisiert Geschlechterdifferenzen als Grundlage pädagogischer Ansätze. Ein wichtiger Punkt ist die Analyse des "heimlichen Lehrplans" und der damit verbundenen Geschlechtsstereotype im Unterricht. Der Teil mündet in die Beschreibung eines Konzepts für einen geschlechtersensiblen und -gerechten Unterricht. Dieser Teil integriert die vorhergehenden Analysen und schlägt konstruktive Wege für die zukünftige Gestaltung von Bildungsprozessen vor, um eine wirklich inklusive und chancengerechte Bildung für alle Kinder zu ermöglichen.
Schlüsselwörter
Feminisierung, Lehrberuf, Geschlecht, Sozialisation, Geschlechterrollen, Geschlechterstereotype, Pädagogik, Koedukation, geschlechtersensibler Unterricht, historische Entwicklung, Berufswahlmotivation, Schulsystem.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Feminisierung des Lehrberufs
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Feminisierung des Lehrberufs aus der Perspektive einer Lehramtsstudentin. Sie hinterfragt kritisch gängige Diskurse um eine vermeintliche „Überweiblichung“ des Schulsystems und beleuchtet den Umgang mit Geschlecht in der pädagogischen Praxis. Der Fokus liegt auf einer ausgewogenen Betrachtungsweise, die verschiedene Perspektiven berücksichtigt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Geschlechterrollen und -stereotype im Bildungssystem, die historische Entwicklung des Frauenanteils im Lehrberuf, Sozialisation und deren Auswirkungen auf die Berufswahl, geschlechtersensible Pädagogik und Unterricht sowie eine kritische Auseinandersetzung mit dem Diskurs um die „Feminisierung“ der Schule.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in drei Teile: Teil I legt die theoretischen Grundlagen (Definitionen von „Feminisierung“ und „Geschlecht“, Sozialisation) fest. Teil II bietet einen sozialgeschichtlichen Abriss des Frauenanteils im Lehrberuf vom 19. Jahrhundert bis heute, analysiert die Berufswahlmotivation von Frauen und diskutiert aktuelle feministische Diskurse. Teil III konzentriert sich auf den Umgang mit Geschlecht in der pädagogischen Praxis, untersucht die Auswirkungen der Koedukation, problematisiert Geschlechterdifferenzen in der Pädagogik und beschreibt ein Konzept für geschlechtersensiblen Unterricht.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Welche Relevanz hat das Geschlecht für den Lehrberuf? Die Arbeit hinterfragt kritisch die oft wertenden Diskurse um dieses Thema und strebt nach einer differenzierten Betrachtung.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine praxeologische Perspektive, d.h. sie betrachtet die Praxis des Lehrens und Lernens im Kontext der Geschlechterverhältnisse. Sie stützt sich auf sozialgeschichtliche Analysen, die Auswertung von Diskursen und die Berücksichtigung pädagogischer Theorien.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert eine detaillierte Analyse der historischen Entwicklung des Frauenanteils im Lehrberuf, beleuchtet die Einflüsse von Sozialisation und Geschlechterrollen auf die Berufswahl und diskutiert die Auswirkungen auf die pädagogische Praxis. Sie bietet schließlich Vorschläge für einen geschlechtersensiblen und -gerechten Unterricht.
Welche Kapitel gibt es und was ist ihr Inhalt?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, drei Hauptteile und eine abschließende Erörterung. Die einzelnen Kapitel befassen sich mit der Definition von Begriffen, der geschichtlichen Entwicklung des Frauenanteils im Lehrberuf, der Sozialisation, der Berufswahlmotivation, Geschlechterstereotypen im Unterricht und der Entwicklung eines geschlechtersensiblen Unterrichts.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Feminisierung, Lehrberuf, Geschlecht, Sozialisation, Geschlechterrollen, Geschlechterstereotype, Pädagogik, Koedukation, geschlechtersensibler Unterricht, historische Entwicklung, Berufswahlmotivation, Schulsystem.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Lehramtsstudierende, Lehrer*innen, Pädagog*innen, Wissenschaftler*innen im Bereich Bildungswissenschaften und alle, die sich für Geschlechterfragen im Bildungssystem interessieren.
Wo finde ich die vollständige Arbeit?
(Hier sollte der Ort angegeben werden, wo die vollständige Arbeit zugänglich ist. z.B. "Die vollständige Arbeit ist in der Universitätsbibliothek erhältlich.")
- Quote paper
- Jessica Wildenauer (Author), 2009, Die Feminisierung des Lehrberufs - Praxeologische Gedanken einer Lehramtsstudentin, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/136247