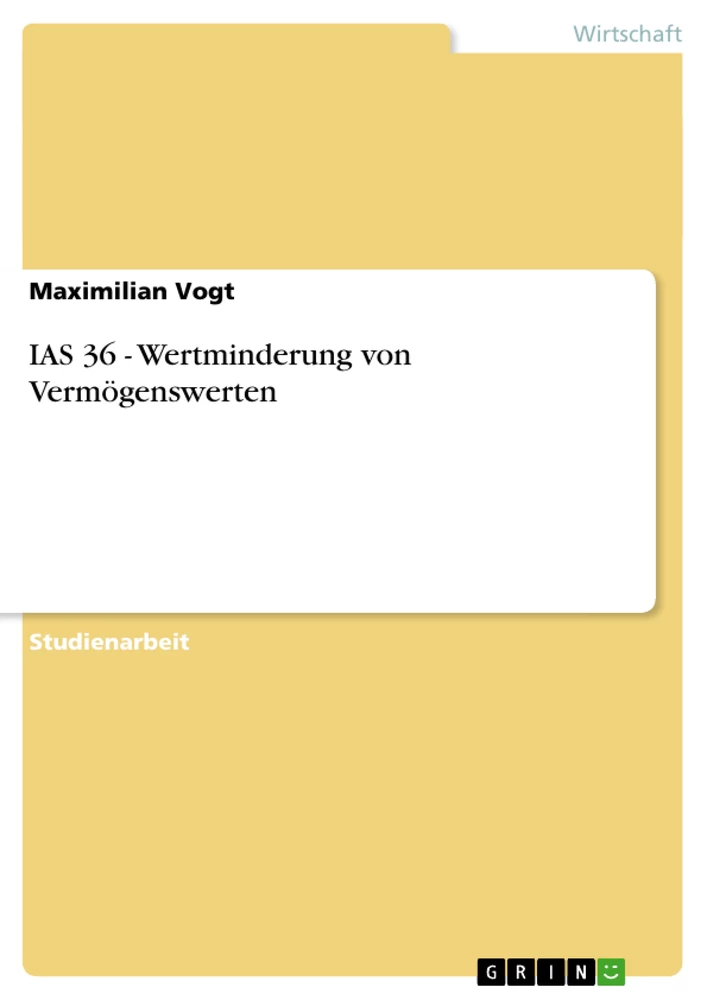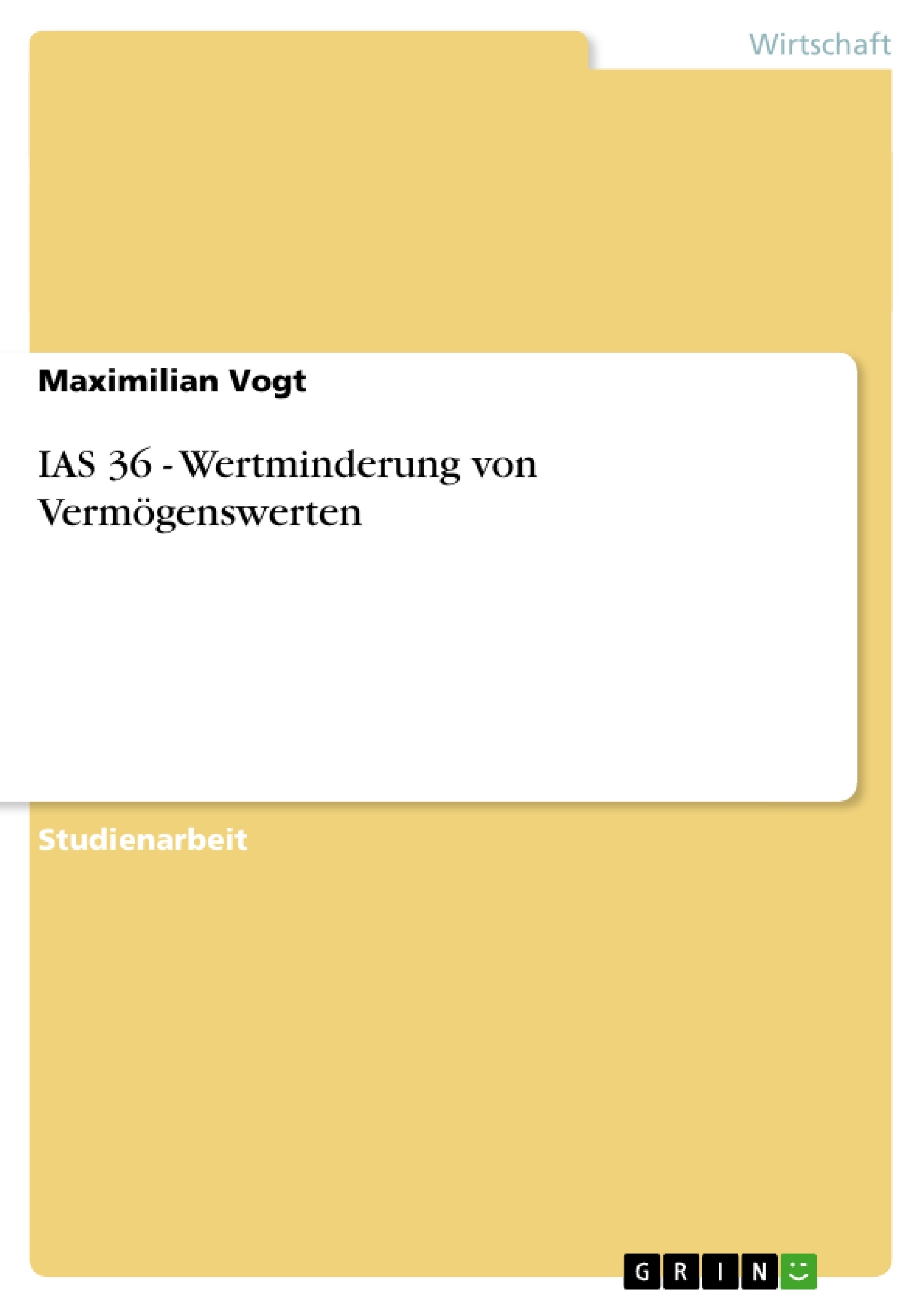Mit zunehmender Globalisierung sind in vielen Branchen
Konzentrationsprozesse zu beobachten, die für die beteiligten Unternehmen eine Vielzahl von Auswirkungen mit sich bringen. Die damit einhergehende Internationalisierung der Rechnungslegungsvorschriften, die sich in den letzten Jahren zunehmend an die US-amerikanischen Regelungen angeglichen haben, stellt für viele Firmen eine Herausforderung dar, zu der in besonderem Maße die Werthaltigkeitsprüfung (sog. Impairment-Test) gem. IAS 36 beiträgt. Ziel ist es auch hier, dass der IFRS-Abschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens sowie der Zahlungsströme vermittelt.
Die vorliegende Arbeit stellt die einzelnen Schritte zur Durchführung eines Impairment-Tests chronologisch dar und erläutert, inwiefern das externe Rechnungswesen hierbei auf Unterstützung angewiesen ist, welche Restriktionen zu beachten sind, welche Freiheitsgrade sich für das Management ergeben, welche generellen Nachteile ein Wertminderungstest mit sich bringt und welche Chancen sich gleichzeitig daraus ergeben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Zielsetzung der Arbeit
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 2. Anwendungsbereich des IAS 36
- 3. Durchführung des Impairment-Tests
- 3.1 Triggering Events
- 3.2 Abgrenzung des Bewertungsobjekts
- 3.3 Bestimmung des erzielbaren Betrags
- 3.3.1 Beizulegender Zeitwert
- 3.3.2 Nutzungswert
- 3.4 Erfassung der Wertminderung
- 3.5 Wertaufholung
- 4. Angaben im Anhang
- 5. Beispiel für einen Impairment-Test
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Durchführung eines Impairment-Tests gemäß IAS 36 im Kontext der internationalen Rechnungslegung. Sie beleuchtet die Herausforderungen, die sich durch die zunehmende Globalisierung und Internationalisierung der Rechnungslegungsvorschriften ergeben. Die Arbeit beschreibt den Ablauf des Tests und analysiert die Rolle des externen Rechnungswesens, die Restriktionen, die Freiheitsgrade des Managements, sowie die Vor- und Nachteile des Verfahrens.
- Durchführung eines Impairment-Tests nach IAS 36
- Anwendungsbereich des IAS 36 und relevante Vermögenswerte
- Bestimmung des erzielbaren Betrags (Zeitwert und Nutzungswert)
- Erfassung von Wertminderungen und Wertaufholungen
- Angaben im Anhang des Jahresabschlusses
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Impairment-Tests gemäß IAS 36 ein und beschreibt die steigende Bedeutung der internationalen Rechnungslegung im Zuge der Globalisierung. Sie betont die Herausforderungen für Unternehmen, die sich aus der Werthaltigkeitsprüfung ergeben und benennt das Ziel der Arbeit: die chronologische Darstellung der einzelnen Schritte des Impairment-Tests und die Analyse der Rolle des externen Rechnungswesens, der Restriktionen, Freiheitsgrade des Managements, sowie der Vor- und Nachteile des Verfahrens.
2. Anwendungsbereich des IAS 36: Dieses Kapitel definiert den Anwendungsbereich des IAS 36, der Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte (mit bestimmter und unbestimmter Nutzungsdauer) sowie Goodwill umfasst. Es werden Beispiele für die verschiedenen Assetklassen genannt und der Unterschied zum deutschen Handels- und Steuerrecht bezüglich der planmäßigen Abschreibung immaterieller Vermögenswerte mit unbestimmter Nutzungsdauer (insbesondere Goodwill) hervorgehoben. Die zunehmende Bedeutung immaterieller Vermögenswerte im Kontext von Unternehmenskäufen wird ebenfalls diskutiert.
3. Durchführung des Impairment-Tests: Das Herzstück der Arbeit. Hier wird der Ablauf des Impairment-Tests detailliert dargestellt, beginnend mit den „Triggering Events“, die eine Wertminderungsprüfung auslösen. Die Abgrenzung des Bewertungsobjekts und die Bestimmung des erzielbaren Betrags (Beizulegender Zeitwert und Nutzungswert) werden ausführlich erläutert, wobei die Komplexität der Nutzungswertermittlung besonders hervorgehoben wird. Schließlich werden die Erfassung der Wertminderung und die Möglichkeit einer Wertaufholung beschrieben.
Schlüsselwörter
Impairment-Test, IAS 36, Internationale Rechnungslegung, Werthaltigkeitsprüfung, Sachanlagen, Immaterielle Vermögenswerte, Goodwill, Beizulegender Zeitwert, Nutzungswert, Triggering Events, Wertaufholung, Jahresabschluss, Anhang.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Durchführung eines Impairment-Tests gemäß IAS 36
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit befasst sich mit der Durchführung eines Impairment-Tests gemäß IAS 36 im Kontext der internationalen Rechnungslegung. Sie analysiert den Ablauf des Tests und untersucht die Herausforderungen, die sich aus der Globalisierung und Internationalisierung der Rechnungslegungsvorschriften ergeben. Ein besonderer Fokus liegt auf der Rolle des externen Rechnungswesens, den Restriktionen und Freiheitsgraden des Managements sowie den Vor- und Nachteilen des Verfahrens.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Durchführung eines Impairment-Tests nach IAS 36, den Anwendungsbereich des IAS 36 und die relevanten Vermögenswerte (Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte, Goodwill), die Bestimmung des erzielbaren Betrags (Zeitwert und Nutzungswert), die Erfassung von Wertminderungen und Wertaufholungen sowie die notwendigen Angaben im Anhang des Jahresabschlusses. Die zunehmende Bedeutung immaterieller Vermögenswerte im Kontext von Unternehmenskäufen wird ebenfalls diskutiert.
Wie ist die Seminararbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Einleitung mit Zielsetzung und Aufbau, Anwendungsbereich des IAS 36, detaillierte Durchführung des Impairment-Tests (inkl. Triggering Events, Bewertungsobjekt, erzielbarer Betrag, Wertminderung und Wertaufholung), Angaben im Anhang, ein Beispiel für einen Impairment-Test und ein Fazit. Ein Inhaltsverzeichnis bietet eine Übersicht.
Was sind die „Triggering Events“ im Rahmen eines Impairment-Tests?
Die Seminararbeit beschreibt die „Triggering Events“, also die auslösenden Ereignisse, die eine Wertminderungsprüfung notwendig machen. Diese werden im Kapitel zur Durchführung des Impairment-Tests detailliert erläutert.
Wie wird der erzielbare Betrag im Rahmen des Impairment-Tests bestimmt?
Die Bestimmung des erzielbaren Betrags ist ein zentraler Bestandteil des Impairment-Tests. Die Arbeit erklärt ausführlich die Berechnung des beizulegenden Zeitwerts und des Nutzungswerts, wobei die Komplexität der Nutzungswertermittlung besonders hervorgehoben wird.
Welche Rolle spielt der Anhang im Jahresabschluss im Zusammenhang mit dem Impairment-Test?
Die Seminararbeit beschreibt, welche Angaben im Anhang des Jahresabschlusses im Zusammenhang mit dem Impairment-Test erforderlich sind. Dies ist ein wichtiges Thema für die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Wertminderungsprüfung.
Welche Schlüsselwörter sind für die Seminararbeit relevant?
Relevante Schlüsselwörter sind: Impairment-Test, IAS 36, Internationale Rechnungslegung, Werthaltigkeitsprüfung, Sachanlagen, Immaterielle Vermögenswerte, Goodwill, Beizulegender Zeitwert, Nutzungswert, Triggering Events, Wertaufholung, Jahresabschluss, Anhang.
Welche Herausforderungen werden im Kontext der Internationalisierung der Rechnungslegung betrachtet?
Die Seminararbeit beleuchtet die Herausforderungen für Unternehmen, die sich aus der zunehmenden Globalisierung und Internationalisierung der Rechnungslegungsvorschriften und der Werthaltigkeitsprüfung ergeben.
Wie wird der Unterschied zum deutschen Handels- und Steuerrecht dargestellt?
Die Arbeit hebt den Unterschied zum deutschen Handels- und Steuerrecht bezüglich der planmäßigen Abschreibung immaterieller Vermögenswerte mit unbestimmter Nutzungsdauer (insbesondere Goodwill) hervor.
- Citar trabajo
- Bachelor of Arts Maximilian Vogt (Autor), 2008, IAS 36 - Wertminderung von Vermögenswerten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/136253