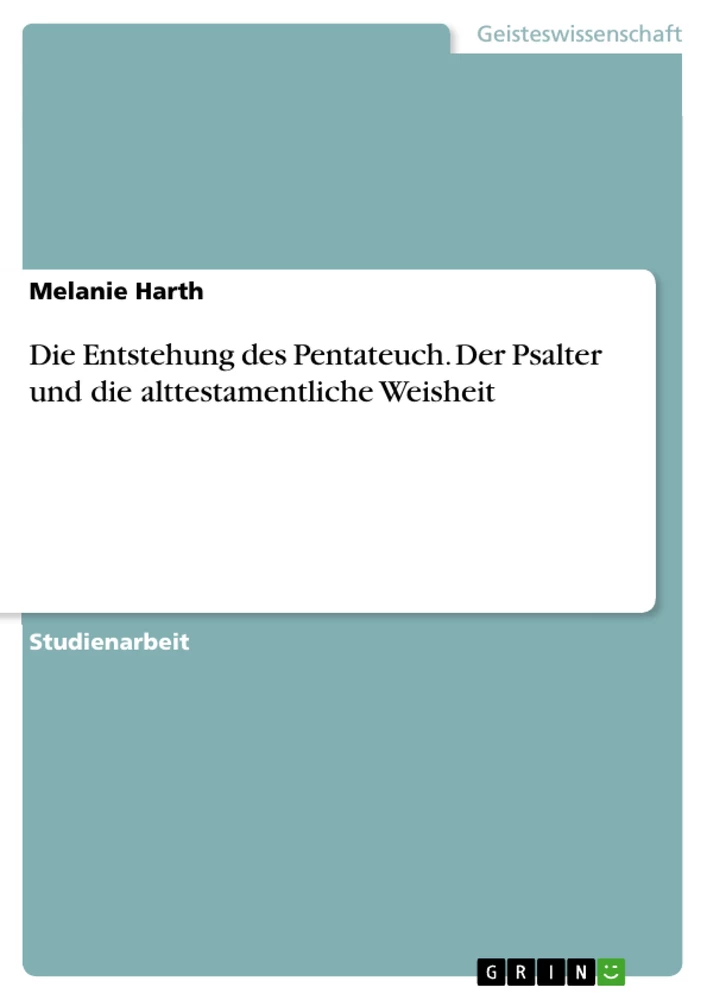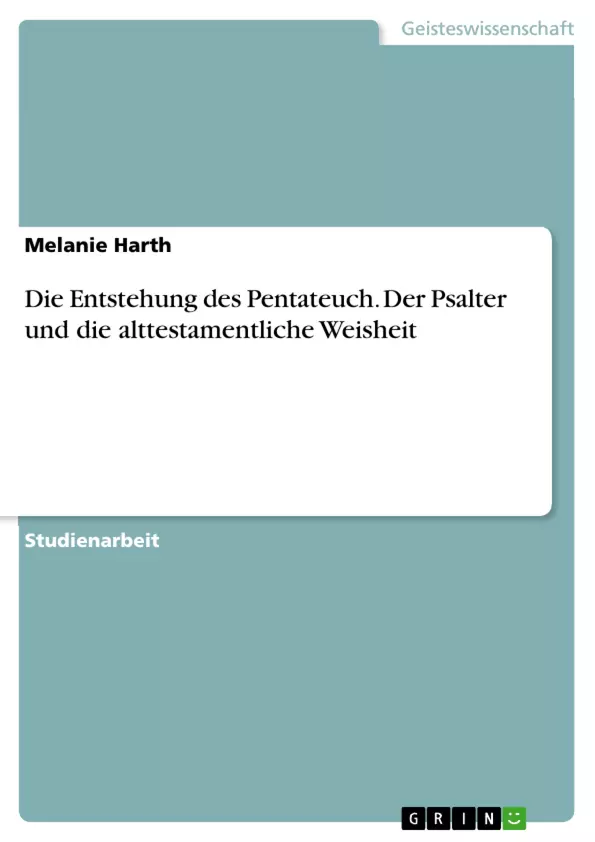Die Entstehung des Pentateuch ist ein sehr komplizierter Vorgang, wobei die Meinungen der Forscher auseinandergehen. Sicher ist nur, dass „die fünf Bücher Mose“ nicht von Mose stammen, sondern das Werk eines langen Überlieferungsprozesses sind. Die Bücher wurden wegen des großen Umfangs zur besseren Handlichkeit auf fünf Schriftrollen verteilt. Daher der Name Pentateuch (Fünfrollenbuch, von griech. pente = fünf, teuchos = Behälter zur Aufbewahrung der Buchrollen). Jahrhunderte lang wurde das Werk für einheitlich gehalten, da eine endgültige Gestaltung die vielen Stoffe in eine grobe inhaltliche und zeitliche Ordnung gebracht hat. Beobachtungen aus der Neuzeit lassen aber erkennen, dass die Entstehung des Pentateuch langwierig und uneinheitlich gewesen ist.
Übereinstimmung erreicht die Forschung am ehesten bei der Abgrenzung der Priesterschrift. Die Einheitlichkeit ihrer Sprache ermöglicht die Wiederherstellung dieser Quellenschrift des Pentateuch. Die Priesterschrift hat die verschiedenen Stoffe in eine Reihenfolge gebracht. Zu Beginn steht die Ur-und Vätergeschichte. Dies ist der Hauptteil des Buches Genesis und wird in 10 Toledot (hebr. = Entstehungsgeschichten) eingeteilt. Als Nächstes steht die Befreiung aus Ägypten an. Darauf folgt die Berufung von Mose und Aaron. Hier erreicht die Offenbarung des Gottesnamens seine Vollendung. Nun heißt Gott nicht mehr Elohim oder El Schaddai, sondern JHWH. Darauf folgen die Plagen Ägyptens und anschließend das Paschafest, der Auszug, das Wunder am Schilfmeer, der Weg zum Berg Sinai und die Manna- und Wachtelspeisung. Die Priesterschrift ist insgesamt ein lückenloses Werk. Die nicht-priesterlichen Texte des Pentateuch sind das Ergebnis eines schwierigen Überlieferungsprozesses.
Inhaltsverzeichnis
1 Die Entstehung des Pentateuch
1.1 Der Pentateuch
1.2 Die Priesterschrift (= P)
1.3 Geschichtswerke und Redaktionen vor der Priesterschrift
2 Der Prophet als sichtbares Zeichen für den Willen JHWHs
2.1 Der Prophet
2.2 „Die vorderen Propheten“
2.3 „Die hinteren Propheten“
2.4 Die vier großen Prophetenbücher
3 Der Psalter – mehr als eine zufällige Sammlung überlieferter Lieder und Gebete Israels?
3.1 Die Psalmen
3.2 Die Entstehung der Psalter
3.3 Die Psalmengattungen
3.3.1 Die Hymnen
3.3.2 Danklied des Einzelnen und Klagelieder
3.3.3 Vertrauenspsalm, Weisheitspsalm und Königspsalm
3.3.4 Klagelieder und das Hohelied
4 Die alttestamentliche Weisheit – eine nationale Besonderheit Israels und seines Glaubens?
4.1 Die Weisheit und der Tun-Ergehens-Zusammenhang
4.2 Grundströmungen weisheitlicher Überlieferungen
4.3 Die Redegattungen
4.3.1 Der Spruch
4.3.2 Die Lehrrede, das Lehrgedicht und die Lehrerzählung
4.4 Weisheitsliteratur am Beispiel des Buches der Sprichwörter und Kohelet
5 König David – alttestamentliche Idealisierung und historische Wirklichkeit
5.1 Charakterisierung Davids
5.2 König David und sein Königreich
5.3 Zentrale Rolle Davids
5.4 David als Dichter und Sänger
Literaturverzeichnis
1 Die Entstehung des Pentateuch
1.1 Der Pentateuch
Die Entstehung des Pentateuch ist ein sehr komplizierter Vorgang, wobei die Meinungen der Forscher auseinandergehen. Sicher ist nur, dass „die fünf Bücher Mose“ nicht von Mose stammen, sondern das Werk eines langen Überlieferungsprozesses sind. Die Bücher wurden wegen des großen Umfangs zur besseren Handlichkeit auf fünf Schriftrollen verteilt. Daher der Name Pentateuch (Fünfrollenbuch, von griech. pente = fünf, teuchos = Behälter zur Aufbewahrung der Buchrollen). Jahrhunderte lang wurde das Werk für einheitlich gehalten, da eine endgültige Gestaltung die vielen Stoffe in eine grobe inhaltliche und zeitliche Ordnung gebracht hat. Beobachtungen aus der Neuzeit lassen aber erkennen, dass die Entstehung des Pentateuch langwierig und uneinheitlich gewesen ist.[1]
1.2 Die Priesterschrift (= P)
Übereinstimmung erreicht die Forschung am ehesten bei der Abgrenzung der Priesterschrift. Die Einheitlichkeit ihrer Sprache ermöglicht die Wiederherstellung dieser Quellenschrift des Pentateuch. Die Priesterschrift hat die verschiedenen Stoffe in eine Reihenfolge gebracht. Zu Beginn steht die Ur-und Vätergeschichte. Dies ist der Hauptteil des Buches Genesis und wird in 10 Toledot (hebr. = Entstehungsgeschichten) eingeteilt. Als Nächstes steht die Befreiung aus Ägypten an. Darauf folgt die Berufung von Mose und Aaron. Hier erreicht die Offenbarung des Gottesnamens seine Vollendung. Nun heißt Gott nicht mehr Elohim oder El Schaddai, sondern JHWH. Darauf folgen die Plagen Ägyptens und anschließend das Paschafest, der Auszug, das Wunder am Schilfmeer, der Weg zum Berg Sinai und die Manna- und Wachtelspeisung. Die Priesterschrift ist insgesamt ein lückenloses Werk. Die nicht-priesterlichen Texte des Pentateuch sind das Ergebnis eines schwierigen Überlieferungsprozesses.
1.3 Geschichtswerke und Redaktionen vor der Priesterschrift
Als „deuteronomistische Redaktionen“ werden Einflüsse im Pentateuch bezeichnet, die von einer theologischen Schule in exilischer Zeit kommen und auf deren literarische Tätigkeiten man im Zusammenhang mit dem DtrG gestoßen ist. In der frühen Königszeit (10. Jh. v.C.) sind ältere Einzelüberlieferungen zu einem Gesamtentwurf vereinigt worden. Dies ist das jahwistische Geschichtswerk (= J), da man schon in der Schöpfungsgeschichte den Namen Jahwe verwendet hat. Eine jüngere Reihe von Überlieferungen heißt „Elohist“ (=E), weil sie bis zur Offenbarung des Namen Gottes an Mose für Gott den Namen Elohim verwendet wurde. Von ihr sollen aber nur Ausschnitte in die spätere Tradition gefunden haben. Das jehowistische Werk (=JE) ist zur Zeit des Königs Hishija (728 – 699 v. Chr.) entstanden, dass Überlieferungen aus Juda und Samaria zu einem größeren Werk verbunden hat.
2 Der Prophet als sichtbares Zeichen für den Willen JHWHs
2.1 Der Prophet
Der Prophet spricht und handelt auf göttliche Eingebung hin und im Redeauftrag Gottes. Seine zentrale Aufgabe ist es, in seinen Worten und Taten die Gemeinschaft des Volkes mit JHWH und die sich entstehenden Forderungen zu vergegenwärtigen. Durch die Treue zum Bund nimmt der Prophet dem Volk gegenüber kritisch Stellung zu religiösen und sozialen Problemen. Außerdem warnt er vor kommendem Unheil und verdeutlicht Zusammenhänge zwischen menschlicher Schuld und göttlicher Strafe. Er erinnert aber auch an Gottes Beistand und an die Verheißungen. Somit weckt er Hoffnung und Vertrauen auf JHWH.[2]
2.2 „Die vorderen Propheten“
„Die vorderen Propheten“ bezeichnet die Bücher Josua, Richter, Samuel und Könige. In diesen Büchern sieht man oft ein deuteronomisches Geschichtswerk (= DtrG), da sie nahen Anschluss an Themen des Deuteronomiums haben. Das DtrG stellt den Zeitraum vom Betreten des Landes unter Josua bis zur Verbannung ins Exil dar. Das Werk wird vom Zeitabschnitt Saul, David und Salomo dominiert. Dabei wird deutlich, dass die Verfasser viele ältere Quellen hatten, wie z. B. Annalen („Jahrbücher“) des Hofes Salomo.
2.3 „Die hinteren Propheten“
Diese Bücher haben keine durchgängige Handlung. Der Beginn ihrer Entstehung waren wahrscheinlich mündliche Texte. Die schriftliche Verfassung dieser Texte ist oft mit einer Verlebendigung für die Umstände dieser Zeit verknüpft. Unheil wurde verstanden als Bestätigung der prophetischen Drohungen und gleichzeitig als Chance für einen Neuanfang.
2.4 Die vier großen Prophetenbücher
Das Jesajabuch ist eine Büchersammlung mit 3 Hauptteilen. Der 1. Teil beinhaltet Worte des Propheten Jesaja. Im 2. Teil ergreift ein Unbekannter das Wort. Daher benutzt man dem Namen Deuterojesaja (griech. = 2. Jesaja). Deuterojesaja tröstet sein Volk und weckt z. B. Hoffnung auf eine neue Chance. Der 3. Teil wird Tritojesaja (griech. = 3. Jesaja) genannt. Dies sind Beiträge unbekannter Verfasser aus nachexilischer Zeit. Auch das Buch Jeremia ist einem langen Entstehungsprozess unterworfen. Die Erzählung Jer 36 hält den Grund für eine erste schriftliche Niederlegung mündlicher Unheilsworte aus den Jahren 627 – 605 v. Chr. fest. Das Buch Ezechiel, welches Worte und Erlebnisse des Propheten Ezechiel widerspiegeln, lässt einen klaren Aufbau erkennen. Nachdem Ezechiel 598 v. Chr. nach Babylon verschleppt wurde, wurde er dort 593 v.Chr. zum Propheten ernannt. Ezechiel will durch seine Warnungen Entscheidungen herausfordern. Er kreiert seinen Gottesauftrag als Berichte über Visionen, symbolische Handlungen, Bildreden und geschichtliche Abhandlungen. Das letzte Buch, nämlich das Zwölfprophetenbuch (griech. = Dodekapropheton) beinhaltet kleinere prophetische Texte. Diese Propheten kann man nicht in eine Zeit einordnen. Die Zeitspanne ist vom 8. bis 4. Jh. v.Chr angesetzt. Einzig das Buch Jona hat keine Prophetenworte. Weitere Propheten sind u. a. Hosea, Amos und Micha.
3 Der Psalter – mehr als eine zufällige Sammlung überlieferter Lieder und Gebete Israels?
3.1 Die Psalmen
Der Begriff „Psalm“ kommt aus dem Griechischen ist heißt „Saitenspiel“. Psalmen sind also „Lieder“, welche zum „Saitenspiel“ gesungen werden. Das Buch der Psalmen beinhaltet eine Sammlung von 150 Liedern, dessen Überschriften meist David als Autor zeigt. Diese Sammlung wird im Griechischen auch „Psalter“ (gr. Psalterion = „Saiteninstrument“) genannt. Die beiden Bezeichnungen gehen auf die LXX (Septuaginta) zurück. In der hebräischen Bibel allerdings wird das Buch der Psalmen „Buch der Preisungen“ genannt. Die Psalmen werden bei wiederkehrenden, typischen Anlässen, wie z. B. bei kultischen Vorgängen verwendet.
3.2 Die Entstehung der Psalter
Der masoretische Text beinhaltet 150 Psalme, die LXX hat allerdings noch einen Zusatzpsalm, der David nach seinem Kampf mit Goliat geschrieben haben soll. Dieser 151. Psalm beinhaltet zudem vier weitere Psalme und syrische Handschriften. “Dass auch diesen Psalmen hebräische Originale zugrunde liegen, ist durch die Psalmenhandschrift aus der Höhle 11 von Qumran erwiesen.“[3] Der Psalter ist, wie der Pentateuch, in fünf Bücher aufgeteilt “[…], wodurch der Psalter analog […] [zu den fünf Büchern Mose] gestaltet wird […]. “[4] Die fünf Einzelbücher enden jeweils mit einem Lobpreis. Viele der Psalmen sind zweimal überliefert. Daran erkennt man, dass der Psalter eine Zusammenfassung von verschiedenen Psalmen ist. Bei dem „Elohistischen Psalter“ wird Gott nicht “Jahwe“, sondern „Elohim“ genannt. Viele Psalme werden einzelnen Menschen oder Gruppen zugeordnet. Die meisten Psalme beziehen sich aber auf König David. Er wird als ein hervorragender Sänger und Dichter beschrieben. “[…]; die Qumran-Gemeinde schreibt ihm gar 4050 Lieder zu.“[5] Ein Psalm Davids wurde zur griechischen Bibel hinzugefügt. Dort berichtet er von seiner Berufung zum König. Weitere Verfasser der Psalmen sind die Asafiten und die Korachiten. Das Psalmenbuch ist kein gegliedertes, durchgehend klares Werk, trotzdem sind “[…] gewisse Ordnungs- bzw. Zuweisungskriterien erkennbar […]. “[6] Ein Zuweisungskriterium sind die Überschriften. Die meisten Überschriften handeln von König David. Diese Überschriften zeigen ihre Herkunft auf, indem sie ihren Verfasser nennen. “Manche Überschriften verweisen auf eine konkrete Situation oder auf den Anlass, zu dem ein Psalm gesungen wurde […].“[7] Manche Überschriften nennen musikalische Anweisungen und die letzte Art von Überschriften zeigen die literarische Gattung des jeweiligen Psalm auf, wie z. B. „Gebet“ oder „Lied“. Die Überschriften wurden allerdings erst in späterer Zeit hinzugefügt. Darum kann man keine genauen Aussagen über Herkunft und Verwendung machen.
[...]
[1] vgl. Notizen aus dem Seminar
[2] vgl. Notizen aus dem Seminar
[3] vgl. Arbeitsbuch zum AT, S. 414
[4] vgl. Arbeitsbuch zum AT, S. 414
[5] vgl. Israel und sein Gott – Einleitung in das AT, S. 53
[6] vgl. Israel und sein Gott – Einleitung in das AT, S. 52
[7] vgl. Israel und sein Gott – Einleitung in das AT, S. 53
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff "Pentateuch"?
Der Begriff stammt aus dem Griechischen und bedeutet "Fünfrollenbuch". Er bezeichnet die ersten fünf Bücher des Alten Testaments (die fünf Bücher Mose).
Was ist die Priesterschrift (P)?
Die Priesterschrift ist eine der Hauptquellenschriften des Pentateuch, die durch eine einheitliche Sprache und eine chronologische Ordnung der Stoffe gekennzeichnet ist.
Was sind die "vorderen" und "hinteren" Propheten?
Die vorderen Propheten umfassen Geschichtsbücher wie Josua und Samuel, während die hinteren Propheten die eigentlichen Prophetenbücher wie Jesaja und Jeremia beinhalten.
Wie entstand der Psalter?
Der Psalter ist eine Sammlung von 150 Liedern und Gebeten, die über Jahrhunderte gewachsen ist und traditionell oft König David zugeschrieben wird.
Was ist der "Tun-Ergehens-Zusammenhang" in der Weisheitsliteratur?
Es ist das Prinzip, wonach gutes Handeln zu gutem Ergehen und böses Handeln zu Unglück führt – ein zentrales Thema in Büchern wie den Sprichwörtern.
Welche Rolle spielt König David im Alten Testament?
David wird als idealisierter König, tapferer Krieger sowie als begnadeter Dichter und Sänger der Psalmen dargestellt.
- Quote paper
- Melanie Harth (Author), 2009, Die Entstehung des Pentateuch. Der Psalter und die alttestamentliche Weisheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/136367