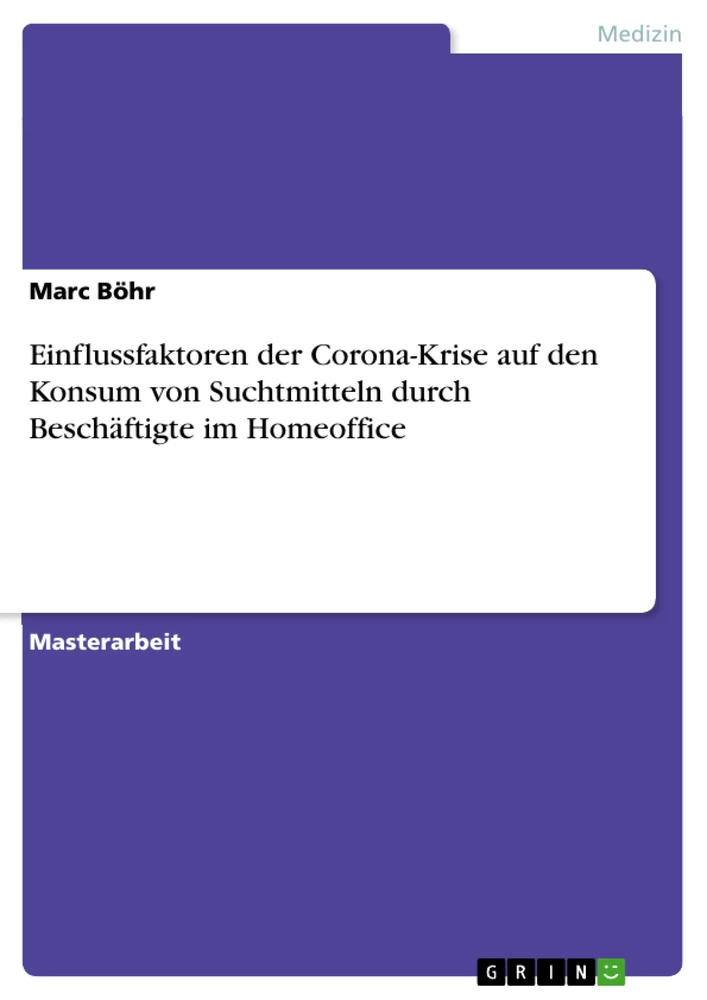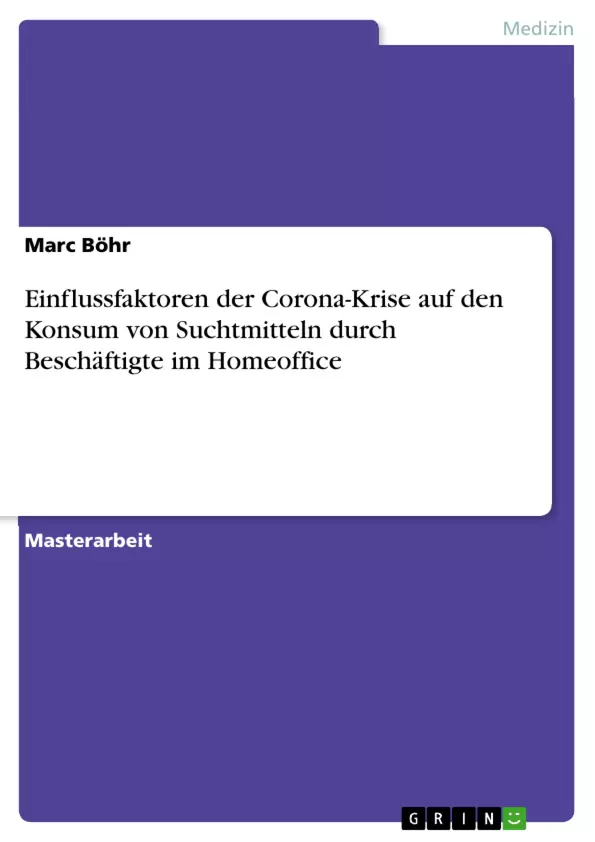Ziel der Arbeit ist es, die Belastungs- sowie die Entlastungsfaktoren im Homeoffice und deren Auswirkungen auf den Suchtmittelkonsum von Mitarbeitende im Homeoffice zu untersuchen, um Handlungsempfehlungen für zeitgemäße betriebliche Suchtprävention zu erarbeiten, die auch bei gegebener physischer Distanz aufgrund von Homeoffice betrieben werden muss. Dies erfolgt mittels qualitativer Forschungsmethodik. Dabei wurden 12 Homeoffice-Beschäftigte aus verschiedenen Bereichen des Öffentlichen Dienstes und der Privatwirtschaft befragt. Auch wenn damit keine repräsentativen Ergebnisse erzielt werden können, so schafft dies dennoch eine Grundlage für weitergehende repräsentative Forschung mittels quantitativer Methodik, was ebenso ein Ziel dieser Arbeit ist.
Die Corona-Krise beeinflusst das Arbeitsleben der Menschen maßgeblich. Im Februar 2021 waren ca. 30 Prozent der deutschen ArbeitnehmerInnen im Homeoffice beschäftigt. Gleichzeitig steigen u. a. aufgrund von sozialer Isolation und zunehmender Müdigkeit der Bevölkerung im Zuge der Corona-Krise die mentale Belastung und folglich auch die Suchtgefährdung. Die Zahl an Erstberatungen bei Suchtberatungsstellen ist, je nach Region, 50 bis 70 Prozent angestiegen. Dabei ist nicht zu verkennen, dass die Homeoffice-Beschäftigung neben anderen Belastungsfaktoren aufgrund der Corona-Krise bei betroffenen ArbeitnehmerInnen einen Faktor darstellen kann, der psychische Belastungen, Krankheiten und folglich auch das Suchtrisiko zusätzlich erhöhen kann.
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Relevanz der Thematik
1.2 Ziel
2 Theoretische Fundierung
2.1 Forschungsfragen
2.2 Grundannahmen, Forschungsrahmen und Begründung für die Auswahl der Variablen 4
2.3 Aktueller Forschungsstand
2.3.1 Mitarbeiterführung im Homeoffice während der Corona-Krise
2.3.1.1 Mitarbeiterführung auf persönlicher Ebene
2.3.1.2 Bedingungen für eine gute Life-Balance im Homeoffice
2.3.1.3 Kommunikation im Homeoffice
2.3.1.4 Ergebnisse des WSI zur Life-Balance von Mitarbeitende im Homeoffice - Ein Auszug
2.3.1.5 Wichtige Einflussfaktoren für gute Homeoffice-Bedingungen
2.3.2 BetrieblicheSuchtprävention
2.3.2.1 Sucht am Arbeitsplatz und ihre Folgen
2.3.2.2 Süchte imBetrieb
2.3.2.3 Betriebliche Suchtprävention in der Praxis
2.4 Forschungslücke
3 Methodisches Vorgehen
3.1 Sekundärforschung: Die Theorie
3.2 Primärforschung: Empirische Forschung durch qualitative Methodik
3.2.1 Semistrukturiertes Interview
3.2.2 Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring
3.3 Umgang mit Gütekriterien der qualitativen Forschung
3.3.1 Intersubjektivität
3.3.2 Reichweite
3.3.3 Transparenz
4 Ergebnisse und Handlungsempfehlungen
4.1 Auswertung und Interpretation der Ergebnisse aus den geführten Interviews 27
4.1.1 Gemeinsamkeiten
4.1.1.1 Reichhaltigkeit der Kommunikation
4.1.1.2 Intensität von Beziehungen
4.1.1.3 Sonstige Gemeinsamkeiten
4.1.2 WahrgenommeneArbeitsfähigkeitim Homeoffice
4.1.3 Life-Balance der Befragten
4.1.4 Suchmittelkonsum der Befragten im Überblick
4.1.5 Hervorzuhebende Besonderheiten und Unterschiede
4.1.6 Öffentlicher Dienst
4.1.6.1 Belastungsfaktoren im Homeoffice
4.1.6.2 Unterstützende Faktoren im Homeoffice
4.1.6.3 Suchtmittelkonsum der Befragten
4.1.7 Unternehmen mit ausbaufähigen Homeoffice-Bedingungen
4.1.7.1 Belastungsfaktoren im Homeoffice
4.1.7.2 Unterstützende Faktoren im Homeoffice
4.1.7.3 Suchtmittelkonsum der Befragten
4.1.8 Unternehmen mit überwiegend guten Homeoffice-Bedingungen
4.1.8.1 Belastungsfaktoren im Homeoffice
4.1.8.2 Unterstützende Faktoren im Homeoffice
4.1.8.3 Suchtmittelkonsum der Befragten
4.2 Handlungsempfehlungen
4.2.1 BGM und betriebliche Suchtprävention aktiv betreiben
4.2.1.1 Suchtprävention: Kategorisierung nach Zielgröße und Zeitpunkt
4.2.1.2 Dienstleistungen von Krankenkassen in Anspruch nehmen
4.2.2 Maßnahmenempfehlungen im Öffentlichen Dienst
5 Diskussion
5.1 Eigene Beiträge
5.1.1 Ergebnisse - EinAuszug
5.1.2 NeueErkenntnisse
5.1.3 Belastbarkeit und Anwendung der Ergebnisse
5.2 Grenzen der Arbeit
5.3 Anschlussmöglichkeiten für Folgearbeiten
6 Schlussfolgerung
6.1 Einschätzung der aktuellen Situation
6.2 Beantwortung der Forschungsfragen
6.3 Einordnung in den aktuellen Forschungsstand
6.4 Abschließendes Fazit
Literaturverzeichnis
Bibliografie
Internetseiten
Anhang
Anm. der Red.: Anhang 3), 4), 5) und 6) wurden entfernt.
Abstract
Die Corona-Krise beeinflusst das Arbeitsleben der Menschen maßgeblich. Im Februar 2021 waren ca. 30 Prozent der deutschen ArbeitnehmerInnen im Homeoffice beschäftigt. Gleichzeitig steigen u. a. aufgrund von sozialer Isolation und zunehmender Müdigkeit der Bevölkerung im Zuge der Corona-Krise die mentale Belastung und folglich auch die Suchtgefährdung. Die Zahl an Erstberatungen bei Suchtberatungsstellen ist, je nach Region, 50 bis 70 Prozent angestiegen. Dabei ist nicht zu verkennen, dass die Homeoffice-Beschäftigung neben anderen Belastungsfaktoren aufgrund der Corona-Krise bei betroffenen ArbeitnehmerInnen einen Faktor darstellen kann, der psychische Belastungen, Krankheiten und folglich auch das Suchtrisiko zusätzlich erhöhen kann.
Ziel der Arbeit ist es daher, die Belastungs- sowie die Entlastungsfaktoren im Homeoffice und deren Auswirkungen auf den Suchtmittelkonsum von Mitarbeitende im Homeoffice zu untersuchen, um Handlungsempfehlungen für zeitgemäße betriebliche Suchtprävention zu erarbeiten, die auch bei gegebener physischer Distanz aufgrund von Homeoffice betrieben werden muss. Dies erfolgt mittels qualitativer Forschungsmethodik. Dabei wurden 12 Homeoffice-Beschäftigte aus verschiedenen Bereichen des Öffentlichen Dienstes und der Privatwirtschaft befragt. Auch wenn damit keine repräsentativen Ergebnisse erzielt werden können, so schafft dies dennoch eine Grundlage für weitergehende repräsentative Forschung mittels quantitativer Methodik, was ebenso ein Ziel dieser Arbeit ist.
Die Ergebnisse zeigen, dass besonders die Reichhaltigkeit der RemoteKommunikation wesentlichen Einfluss auf die wahrgenommene Arbeitsfähigkeit und die Intensität der Beziehungen hat (unter Mitarbeitenden sowie auf die wahrgenommene Fairness und Unterstützung durch Vorgesetzte), wenngleich sich alle der drei Faktoren auch gegenseitig beeinflussen. Diese wahrgenommene Arbeitsfähigkeit und die Intensität der Beziehungen beeinflussen wiederum maßgeblich die mentale Verfassung und somit die Suchtgefährdung von Mitarbeitenden im Homeoffice.
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Verhältnis zwischen Arbeitsfähigkeit und Suchtmittelkonsum
Abbildung 2: Verhältnis zwischen Kommunikationsreichhaltigkeit und Suchtmittelkonsum
Abbildung3: Verhältnis zwischen Beziehungsintensität und Suchtmittelkonsum
Abbildung 4: Wahrscheinlichkeit, ausschließlich positive Vereinbarkeitserfahrungen im Homeoffice zu machen, in Betrieben mit und ohne betriebliche Vereinbarkeitsmaßnahmen (Quelle: in Anlehnung an Lott 2020: 7)
Abbildung 5: Wahrscheinlichkeit, ausschließlich positive Vereinbarkeitserfahrungen im Homeoffice zu machen, nach wahrgenommener Fairness von Führungskräften (Quelle: in Anlehnung an Lott 2020: 8)
Tabellenverzeichnis
Tabellel:JellineksfünfTypen vonAlkoholabhängigen (Quelle: Hoppenstedt2016:32 f.)
Tabelle 2: Kategorisierungen von Suchtprävention (Quelle: Hoppenstedt 2016: 7ff.)
Tabelle 3: Grundkonzepte der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (Quelle: Mayring 2015)
Tabelle 4: Positive und negative Faktoren der Life-Balance, die von den Befragten genannt wurden
Tabelle 5: Empfundene Fairness des Vorgesetzten von zwei Befragten des Öffentlichen Dienstes
Tabelle 6: Fairness der Vorgesetzten bei den drei Befragten der Gruppe„Unternehmen mit ausbaufähigen Homeoffice-Bedingungen"
Tabelle 7: Wahrgenommene Arbeitsfähigkeit der Befragten aus der Gruppe „Unternehmen mit ausbaufähigen Homeoffice-Bedingungen"
Tabelle 8: Einfluss der Remote-Kommunikation aufdie Arbeitsfähigkeit bei vier Befragten der Gruppe „Unternehmen mit überwiegend guten Homeoffice-Bedingungen"
Tabelle 9: Reichhaltigkeit der Kommunikation bei zwei Befragten der Gruppe„Unternehmen mit überwiegend guten Homeoffice-Bedingungen"
Tabelle 10: Intensität von Beziehungen von vier Befragten der Gruppe„Unternehmen mit überwiegend guten Homeoffice-Bedingungen"
Tabelle 11: Einfluss der Remote-Kommunikation auf das Teambuilding und die wahrgenommene Arbeitsfähigkeit
1 Einleitung
1.1 Relevanz der Thematik
Im Zuge der Corona-Krise arbeiten immer mehr ArbeitnehmerInnen im Homeoffice. Im Februar 2021 arbeiteten über 30 Prozent der ArbeitnehmerInnen mindestens teilweise im Homeoffice. 56 Prozent der Jobs könnten mindestens teilweise im Homeoffice durchgeführt werden (vgl. Alipour et al. 2021: 1). Zeitgleich stieg in Deutschland die Suchtgefährdung stark an. Einer Studie des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim und des Klinikums Nürnberg zufolge haben 35,5 Prozent der über 3000 Befragten mehr Alkohol konsumiert. Suchtberatungsstellen und Selbsthilfegruppen hatten im Jahr 2020 deutlich mehr InteressentInnen und erhielten deutlich mehr Anrufe und schriftliche Anfragen (vgl. ZDF 2020). Insgesamt hat die Zahl der Sucherstberatungen mittlerweile um 50 bis 70 Prozent (je nach Region) zugenommen (vgl. Kaufmann 2021). In einem Artikel des SPIEGEL von Ende Februar 2021 beschreibt ein Betroffener, dass sein Alkoholkonsum im Zuge der Corona-Krise und seine Homeoffice-Beschäftigung stark zugenommen habe. Er habe angefangen, mehr Feierabendgetränke zu sich nehmen und die Wohnung seltener verlassen. „Es fehlte nicht viel, und ich hätte während der Arbeitszeit zur Flasche gegriffen.“(Kaufmann 2021)
Eine Onlineumfrage des Arbeitskreises Chancengleichheit der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG), die zwischen Mittel April und Ende Juni 2020 durchgeführt wurde, ergab, dass die hauptsächlichen Stressfaktoren der Home- office-Beschäftigung die fehlende Trennung von Beruf und Familie sowie das Gefühl der Isolation waren (vgl. DPG 2021: 3).
Betriebliche Suchtprävention ist einer der wesentlichen Instrumente des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM). Sie sollte nicht nur aus sozialen, sondern auch aus ökonomischen Gründen betrieben werden. Zudem haben Arbeitgebende eine Sorgfaltspflicht gegenüber ihren Mitarbeitenden, die auch für Beschäftigte im Homeoffice Geltung hat. Viele Arbeitgebende vernachlässigen jedoch vor allem den psychischen Aspekt des BGM, bei dem betriebliche Suchtprävention eine tragende Rolle spielt. Daher ist davon auszugehen, dass das BGM aufgrund gegebener Distanz von Arbeitgebenden und Mitarbeitenden insgesamt noch inkonsequenter betrieben wird. Die fehlende Kontrolle und fehlende Fürsorge durch Arbeitgebende sowie schlechte Arbeitsbedingungen stellen ein Risiko dar, dass zu einer vermehrten psychischen Belastung und somit auch zu einer höheren Suchtgefährdung von Mitarbeitenden im Homeoffice führen kann.
Die Arbeitsmarktexpertin Annelie Buntenbach wies in einem Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ) bereits auf die Risiken des Homeoffice hin. Sie warnte vor der extremen Belastung und Überlastung bei Homeoffice während der Corona-Krise. Es könne nicht sein, das eine Erreichbarkeit Tag und Nacht besteht und es keine Trennung mehr zwischen Arbeit und Freizeit gäbe. Höchstarbeitszeiten und Ruhezeiten müssten eingehalten werden. Arbeits- und Gesundheitsschutz dürften nicht zu kurz kommen (vgl. Deutscher Gewerkschaftsbund 2020).
Ausgehend davon beschäftigt sich diese Arbeit mit Faktoren der Corona-Krise, die sich auf den Konsum von Suchtmittel durch Mitarbeitende im Homeoffice auswirken können. Arbeitgebende müssen aufgrund der erhöhten Suchtgefahr während der Corona-Krise handeln und betriebliche Suchtprävention auch im Homeoffice nach bestem Gewissen betreiben.
1.2 Ziel
Ziel und Anspruch der Arbeit ist es nicht, eine repräsentative Erhebung durchzuführen. Die Arbeit soll lediglich eine Richtung für zukünftige Forschung weisen.
Diese Richtung soll in den Bereich der betrieblichen Suchprävention im Homeoffice gehen. Da diese durch Arbeitgebende im Rahmen des BGM eher vernachlässigt wird, ist aufgrund der höheren Isolation von Mitarbeitenden im Homeoffice von der Möglichkeit eines schlechteren BGM und somit auch einer weniger konsequenten Suchtprävention auszugehen.
Die vorliegende Arbeit soll einen Beitrag dazu leisten, dieser Problematik entgegenzuwirken und ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Homeoffice neben all den durchaus gegebenen Chancen auch erhebliche Risiken aufweisen kann, wie die Wahrscheinlichkeit eines stärkeren Konsums von Suchtmitteln durch Mitarbeitende im Homeoffice. Neben den Risiken, die sich aus der Suchtgefährdung ergeben, soll diese Arbeit allerdings auch Chancen aufzeigen. Mit einer guten betrieblichen Suchtprävention könnte die Homeoffice-Beschäftigung für ArbeitnehmerInnen sogar der allgemeinen psychischen und emotionalen Belastung durch die Corona- Krise entgegenwirken. Aus einem potenziellen Belastungsfaktor, dem Homeoffice, könnte im Rahmen der Corona-Krise somit ein effektives Hilfsinstrument werden, dass ArbeitnehmerInnen in dieser Krise und auch in möglichen künftigen Krisen (z. B. weitere Pandemien) unterstützt. Diese Arbeit soll mittels einer qualitativen Analyse eine Grundlage für weitere Forschung schaffen, damit zukünftig repräsentative Ergebnisse erarbeitet werden können.
2 Theoretische Fundierung
Zu näheren Erforschung des Suchtmittelkonsums bei Homeoffice-Beschäftigten bedarf es der Untersuchung von Faktoren, die innerhalb der Homeoffice-Tätigkeit von besonderer Bedeutung sind. Die folgenden Forschungsfragen und Grundannahmen beziehen drei dieser Faktoren als Variablen ein, die im Rahmen der Arbeit untersucht werden.
2.1 Forschungsfragen
Frage 1
Inwiefern beeinflusst die wahrgenommene Reichhaltigkeit der Kommunikation im Homeoffice den Konsum von Suchtmitteln?
Frage 2
Inwiefern beeinflusst die wahrgenommene Intensität von Beziehungen der Mitarbeitenden im Homeoffice zu KollegInnen und Führungskräften den Konsum von Suchtmitteln?
Frage 3
Inwiefern beeinflusst die wahrgenommene Arbeitsfähigkeit im Homeoffice den Konsum von Suchtmitteln?
2.2 Grundannahmen, Forschungsrahmen und Begründung für die Auswahl der Variablen
In den Grundannahmen gibt es jeweils zwei Variablen: Der Einflussfaktor (A) und das Bedürfnis zum Konsum von Suchtmitteln (B), das durch diese Einflussfaktoren (die sich aus der Corona-Krise und der Homeoffice-Beschäftigung ergeben) entweder erhöht oder gesenkt wird. Für diese Arbeit wurden drei entscheidende Einflussfaktoren ausgewählt. Zwar gibt es noch eine Reihe anderer Einflussfaktoren, jedoch würde deren Berücksichtigung den Rahmen der Arbeit sprengen und somit zu qualitativ schlechteren Ergebnissen führen. Daher ist der Fokus auf wenige besonders relevante Faktoren sinnvoll.
Ebenso ist zu erwähnen, dass der Suchtmittelkonsum sich aus der mentalen Verfassung ergibt, die durch die drei gewählten A-Variablen beeinflusst und sich somit auf den Suchmittelkonsum auswirken. Der Suchtmittelkonsum als Variable ist somit als Kombination von mentaler Verfassung und daraus folgender Suchtgefährdung zu betrachten.
1) Je schlechter die wahrgenommene Arbeitsfähigkeit im Homeoffice ist, desto mehr neigen ArbeitnehmerInnen zum Konsum von Suchtmitteln.
Abbildung 1: Verhältnis zwischen Arbeitsfähigkeit und Suchtmittelkonsum
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2) Je weniger reichhaltig die wahrgenommene Kommunikation im Homeoffice ist, desto mehr neigen ArbeitnehmerInnen zum Konsum von Suchtmitteln.
Abbildung 2: Verhältnis zwischen Kommunikationsreichhaltigkeit und Suchtmittelkonsum
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3) Je weniger intensiv die Beziehungen zu KollegInnen und Führungskräften im Homeoffice ist, desto mehr neigen ArbeitnehmerInnen zum Konsum von Suchtmitteln.
Abbildung 3: Verhältnis zwischen Beziehungsintensität und Suchtmittelkonsum
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2.3 Aktueller Forschungsstand
2.3.1 Mitarbeiterführung im Homeoffice während der Corona-Krise
Dominic Lindner (2020) hat in seinem Werk „Virtuelle Teams und Homeoffice“ Empfehlungen zur Führung virtueller Teams während der Corona-Krise erarbeitet. Dabei verweist erauf die Notwendigkeit von Mitarbeiterpartizipation und auf ein enges Vertrauensverhältnis zwischen Mitarbeitenden und Führungskräften.
Dabei geht Lindner auch auf die Risiken bei der Führung virtueller Projektteams ein. Virtuelle Teams bieten neben den Chancen, die in der Steigerung von Flexibilität, Agilität und der Ermöglichung einer besseren Work-Life-Balance (in den folgenden Ausführungen „Life-Balance“ genannt, da auch die Arbeit Bestandteil des Lebens ist) für Mitarbeitende bestehen, auch Risiken. Im Folgenden werden Risiken aufgezählt, die u.a. auch von Lindner aufgezeigt werden:
Der organisatorische Aufwand ist hoch
Dieser Aufwand ergibt sich aus den Strukturen. Mitarbeitende haben oft eigene Vorstellungen zum Ablauf von Projekten, die sich nicht immer hundertprozentig mit
denen des Unternehmens decken. Das erschwert folglich die Zusammenarbeit (vgl. Lindner 2020: 11).
Die Kommunikation wird erschwert
Die Kommunikation aus der Distanz ist herausfordernd. Sprachbarrieren und kulturelle Missverständnisse können die Kommunikation erschweren. Es kann in kulturübergreifend Meetings zu Konflikten aufgrund verschiedenster Vorstellungen kommen, z. B. in Bezug auf Qualität und Pünktlichkeit. (vgl. ebd.: 11).
Es ist schwerer, die Mitarbeitermotivation aufrechtzuerhalten bzw. zu erreichen
Aufgrund kultureller Unterschiede und der unpersönlicheren Zusammenarbeit fällt es Mitarbeitenden schwer, ein Vertrauensverhältnis zu ihren KollegInnen aufzubauen. Im schlimmsten Fall kann dieser zu einer fehlenden Identifikation der einzelnen Mitarbeitenden bei der Bearbeitung von Projekten führen. Unter der mangelnden Kommunikation kann zudem die Qualität der Endergebnisse leiden. Außerdem besteht das Risiko, das Mitarbeitende überarbeitet sind und dies zu spät von Führungskräften bemerkt wird (vgl. ebd.).
2.3.1.1 Mitarbeiterführung auf persönlicher Ebene
Teambuilding: Virtuelle Teams müssen erst gebildet werden und auch funktionieren. Dabei sind erste reale und punktuelle Treffen hilfreich (vgl. Lindner 2020: 52). Allerdings kann eine hohe Infektionsrate reale Treffen erschweren und es ist abzuwägen, ob man dieses Risiko eingehen kann. Gegebenenfalls empfiehlt es sich, kleinere Teams zu bilden, um die das Infektionsrisiko entsprechend zu mindern. Die Mitarbeitenden müssen sich sicher fühlen.
Konkrete Ziele: Es ist empfehlenswert, virtuelle Teams mittels vereinbarter Ziele zu steuern. Regelmäßige Statusmeldungen zur Zielkorrektur sind hier sinnvoll.
Klare, verständliche Rollenverteilung: Eine klare Rollenverteilung nach PullPrinzip (d. h. durch Delegation von Verantwortung an die Mitarbeitenden) kann die Führungskraft entlasten. Jedem Teammitglied muss vermittelt werden, dass es wichtig für das Team ist. Die Führungskraft muss die Rolle der jeweiligen Mitarbeitenden respektieren und deren Identifikation mit der Rolle fördern.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Basis: Es herrscht das einheitliche Verständnis, dass eine Führungskraft nicht perfekt sein muss. Sie darf Fehler zugeben und auch einen „schlechten Tag“ haben.
Primärcharakteristika: Führung auf Augenhöhe, Vertrauen in Mitarbeitenden, Experimente, Echtzeitinformationen und Inspiration sind hier förderlich.
Sekundärcharakteristika: Echtzeitfeedback, Agilität vorleben, Mitarbeiterpartizipation, zur Veränderung motivieren.
Neue Kompetenzen: Antizipation neuer Trends, agile Methoden, neue Arbeitskonzepte, Motivation der Mitarbeitenden und die Evaluation geeigneter Technologien.
Learning by Doing: Stellt für Führungskräfte die am meisten verbreitete Lernmethode dar. Das Führungsleitbild sollte entsprechend gestaltet und gelebt werden. Es erfordert Experimentierfreude (vgl. Lindner 2020: 52). Dies formt auch die Persönlichkeit. Mit der Zeit werden neue Wege gelernt und hilfreiche Verhaltensweisen erworben, die im Arbeitsalltag umgesetzt werden können.
Interkulturelle Kompetenz: Aus den zuvor erwähnten Risiken der heutigen Zeit ist es unabdingbar, dass Führungskräfte und auch Mitarbeitende ein gewisses Maß an interkultureller Kompetenz mitbringen. Das gilt besonders bei international zusammengestellten Teams. Englischkenntnisse sollten somit vorhanden sein. Ebenso ist ratsam, Führungskräfte und Mitarbeitenden zu interkulturellen Umgang zu befähigen (z. B. durch Schulungen bzw. Webinare).
Diese persönliche Ebene der Führung im Homeoffice ist eine wichtige persönliche Ressource und wirkt sich stressmildernd auf Mitarbeitenden aus. Dies ist ein wichtiger Bestandteil der betrieblichen Suchtprävention, auf die im Kapitel „Betriebliche Suchtprävention“ näher eingegangen wird. Relevant für die Stressminderung sind auch die betrieblichen Bedingungen.
2.3.1.2 Bedingungen für eine gute Life-Balance im Homeoffice
Häufigkeit und Dauer von Homeoffice
Nach Gajendran und Harrision (2007) zweieinhalb Tage oder mehr. Die ausschließliche Arbeit zu Hause kann zu Stress und Vereinsamung führen (vgl. Golden et al. 2008, zitiert nach Lott 2020: 4).
Kontrolle über Arbeitszeit und Ort
Mitarbeitenden müssen frei entscheiden können, ob sie zu Hause arbeiten können oder nicht. Steht ihnen die Entscheidung frei, sind sie weniger gestresst als Beschäftigte, die ausschließlich im Büro arbeiten und Homeoffice als Zwang empfinden. ArbeitnehmerInnen, die mitentscheiden können, wo sie arbeiten, sind weniger gestresst und erkranken seltener an Burnout und Depressionen, haben weniger Kündigungsabsichten und weisen eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit auf (vgl. Kaduk et al. 2019; Kossek et al. 2006; zitiert nach Lott 2020: 4). Das „Zwangs-Homeoffice“ zu Beginn der der Corona-Krise war daher zwar notwendig, um das Infektionsgeschehen effektiv auszubremsen, aber aus arbeitspsychologischer Sicht problematisch.
Wahrgenommene Unterstützung durch Vorgesetzte und Betriebe
Vorgesetzte und Betriebe müssen ihre Mitarbeitenden unterstützen, damit der Konflikt zwischen Beruf und Privatleben so gering wie möglich gehalten wird. Diese kann emotional (z. B. Verständnis zeigen für die Probleme der Mitarbeitenden) oder instrumentell (z. B. Vertretungslösungen organisieren) erfolgen (vgl. Hammer et al. 2009; zitiert nach Lott 2020: 4) erfolgen. Ebenso hilfreich ist eine Vorbildfunktion, in denen Vorgesetzte ihren Beschäftigten zeigen, wie die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben möglich ist.
Relevant ist auch die wahrgenommene Unterstützung durch den Betrieb. So müssen Tage, an denen Beschäftigte im Homeoffice arbeiten können, auch dem Vereinbarkeitsbedarf der Beschäftigten entsprechen. Dabei ist es wichtig, die Kriterien, nach denen die Konditionen für das Homeoffice vereinbart werden, einheitlich sind. Dadurch soll die Bevorzugung bestimmter Gruppen vermieden werden, damit Mitarbeitenden sich nicht benachteiligt fühlen (vgl. Ryan und Kossek 2008; zitiert nach ebd.: 5).
Klare Beurteilungskriterien
Klare Beurteilungskriterien geben Mitarbeitenden im Homeoffice Sicherheit. Vor allem Frauen nutzen vorzugsweise die Homeoffice-Option, um eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erreichen. Das bedeutet für Mitarbeitenden oft eine sehr starke Belastung, da sie auch nach wie vor in Vergleich zu Männern die meiste Hausarbeit erledigen. Die Gleichberechtigung von Mann und Frau im Berufsalltag ist somit nicht erreicht. Aufgrund der Mehrbelastung müssen sie oft ne- gative Leistungsbewertungen fürchten. Klare Beurteilungskriterien schaffen hier Sicherheit.
Universalität und Verhandelbarkeit
Homeoffice muss prinzipiell allen offenstehen bzw. es sollte geprüft werden, ob ein Teil der Arbeit zu Hause erbracht werden kann. Ist aus technischen Gründen nicht möglich, müssen Alternativen erarbeitet werden (z. B. zeitflexibles Arbeiten wie Gleitzeiten). Allerdings sind Mitarbeitenden in niedrigen Positionen, insbesondere ethnische Minderheiten und Frauen, hier oft ausgeschlossen (vgl. Lambert und Waxmann 2005; zitiert nach Lott 2020: 5).
2.3.1.3 Kommunikation im Homeoffice
Wenn nicht alle Teammitglieder am gleichen Ort (z. B. im Büro) sind, ist es von hoher Relevanz, dass die Kommunikation mit KollegInnen und Vorgesetzten trotzdem funktioniert. Wie zuvor erwähnt ist die Kommunikation im Homeoffice bzw. bei virtuellen Teams unpersönlicher als in der Präsenzarbeit, was die Kommunikation erschwert. Um für eine bestmögliche Kommunikation bei virtuellen Teams zu sorgen, können verschiedene Arbeitsmittel angewendet werden. Zu diesen gehören beispielsweise:
- Telefonkonferenzen,
- Webkonferenzen,
- E-Mail,
- Cloudspeicher und Dateiübertragung,
- Kollaborative Arbeitswerkzeuge.
Zu ihnen gehört z. B. die Software „Microsoft Teams“. Diese Arbeitswerkzeuge erlauben Mitgliedern von erstellten Gruppen (z. B. Channels, Teams) den Austausch von Kurznachrichten, Videokonferenzen und Dokumenten. Solche Dokumente können dann in thematische Gruppen gegliedert werden (z. B. Marketing, Controlling). Kollaborative Arbeitswerkzeuge stellen eine gute Alternative zur isolierten Nutzung von Telefon- und Webkonferenzen, E-Mails und Cloudspeichern dar, da sie sämtliche dieser Dienstleistungen kombinieren und die Kommunikation somit erleichtern. Eine Nutzung verschiedenster Tools kann wiederum Verwirrung stiften und die Arbeitsfähigkeit sowie die Kommunikationsfähigkeit einschränken.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Kommunikation zwischen Menschen beschränkt sich nicht allein auf den sachlichen Informationsaustausch. Die Kommunikationspsychologie greift hier auf das Eisbergmodell zurück, um die Kommunikation zwischen Menschen zu erklären. Von einem Eisberg sind nur 10 bis 20 Prozent zur erkennen, der bedeutendere Teil befindet sich allerdings unter Wasseroberfläche (vgl. Bruhn 2020: 28).
Bei der menschlichen Kommunikation wird zwischen der Sachebene (verbale Kommunikation) und der Beziehungsebene unterschieden (nonverbale Kommunikation). Die Sachebene entspricht dem Teil des Eisbergs, während die Beziehungsebene dem Teil des Eisbergs entspricht, der unterhalb der Wasseroberfläche liegt. Für eine erfolgreiche Kommunikation ist es daher von großer Bedeutung, dies nicht auf die verbale Kommunikation zu beschränken (z. B. bei einem Telefonat). Mimik und Gestik übermitteln viele wichtige Informationen. Sind GesprächspartnerInnen nicht nur zu hören, sondern auch zu per Video zu sehen, sind Mimik und Gestik erkennbar (vgl. ebd.).
2.3.1.4 Ergebnisse des WSI zur Life-Balance von Mitarbeitenden im Homeoffice - Ein Auszug
Im Fazit eines Reports von Januar 2020 des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI), der sich mit der Life-Balance im Homeoffice beschäftigt, wird die Bedeutung der Rahmenbedingungen des Homeoffice stark hervorgehoben. Dabei ist jedoch anzumerken, dass diese Studie vor Beginn der Corona-Krise erstellt wurde. Die Rahmenbedingungen sind zu Krisenzeiten somit andere. Daher werden nun jene Studienergebnisse dargestellt, die im Rahmen der Homeoffice- Beschäftigung unter Pandemiebedingungen relevant erscheinen.
Das WSI kommt u. a. zu folgenden Ergebnissen:
Beschäftigte, die im Homeoffice arbeiten, sind im Vergleich zu ArbeitnehmerInnen ohne Homeoffice einsatzbereiter und zufriedener mit ihrem Beruf. Allein die Möglichkeit, im Homeoffice arbeiten zu dürfen, sorgt für mehr Zufriedenheit, höhere Einsatzbereitschaft, engagierteres Arbeiten und eine höhere Produktivität. Das Vertrauen zwischen Arbeitgebenden und Beschäftigten wird durch dieses Angebot gestärkt (vgl. Lott 2020: 10).
Jedoch ist der Forschungsstand in Bezug auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht eindeutig, da hier die betrieblichen Rahmenbedingungen eine erhebli-
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
che Rolle spielen. Allerdings werden betriebliche Vereinbarkeitsmaßnahmen, die eine Life-Balance sicherstellen sollen, i. d. R. als unvereinbar mit der Führungsverantwortung gesehen, was den betrieblichen Wandel hemmt (vgl. Lott 2020: 10). Die Studie des WSI zeigt allerdings die Bedeutung flexibler Arbeitszeiten im Homeoffice, besonders bei ArbeitnehmerInnen in Führungspositionen. Führungskräfte mit flexiblen Arbeitszeiten empfanden ihre Life-Balance als wesentlich positiver (siehe Abbildung 1). Dies wird wegen der aktuell gegebenen Einschränkungen im Privatleben aufgrund der Corona-Krise eine noch höhere Bedeutung haben.
Abbildung 4: Wahrscheinlichkeit, ausschließlich positive Vereinbarkeitserfahrungen im Homeoffice zu machen, in Betrieben mit und ohne betriebliche Vereinbarkeitsmaßnahmen (Quelle: in Anlehnung an Lott 2020: 7)
Wahrscheinlichkeit, ausschließlich positive Vereinbarkeitserfahrungen mit Homeoffice zu machen, in Betrieben mit und ohne betriebliche Vereinbarkeitsmaßnahmen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Zudem empfinden ArbeitnehmerInnen, die ihre Führungskräfte als fair wahrnehmen, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie besser als jene Beschäftigte, die ihre Vorgesetzten eher als unfair wahrnehmen (siehe Abbildung 2). Fairness vermittelt Mitarbeitenden ein Sicherheitsgefühl und gibt eine Berechenbarkeit bezüglich der Vorteile, die Homeoffice für sie bietet (vgl. Lott 2020: 10).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5: Wahrscheinlichkeit, ausschließlich positive Vereinbarkeitserfahrungen im Homeoffice zu machen, nach wahrgenommener Fairness von Führungskräften (Quelle: in Anlehnung an Lott 2020: 8)
Die Studien des WSI zeigen zudem, dass ein Großteil der Mitarbeitende im Homeoffice von zu Hause arbeiten können, um den erforderlichen Arbeitsaufwand zu leisten und somit mehr Aufgaben abzuarbeiten, als sie eigentlich sollten (vgl. Lott 2020: 11). Unter Pandemiebedingungen könnte dies bedeuten, dass Mitarbeitende im Homeoffice durch fehlende Kontrolle und Fürsorge seitens der Arbeitgebenden Überstunden leisten könnten. Somit birgt Homeoffice ohne klare Regelungen und unflexibler Arbeitszeiten die Gefahr, zu einer zusätzlichen Belastung zu werden. Dies gefährdet u. a. auch den Arbeitsschutz und ArbeitnehmerInnen nehmen ihre Verantwortung gegenüber den eigenen Mitarbeitenden nicht ausreichend wahr. Ist Homeoffice allerdings vertraglich geregelt, machen ArbeitnehmerInnen häufiger gute Erfahrungen. Ein schriftlich festgehaltenes Recht auf Homeoffice bzw. eine verbindliche und offizielle Homeoffice-Regelung fördert somit die Vereinbarkeit von Beruf und Familie bzw. Privatleben. Jedoch hatten nur 17 Prozent der Mitarbeitenden im Homeoffice (Stand Januar 2020) eine vertragliche Regelung (vgl. Lott 2020: 11). Im Rahmen der Corona-Krise ist von folgenden zwei Möglichkeiten auszugehen:
- Aufgrund der zunehmenden Bedeutung von Homeoffice könnte sich die Zahl an vertragliche Homeoffice-Regelungen erhöht haben. Es ist möglich, dass viele Arbeitgebende auch nach der Corona-Krise planen, Homeoffice aufgrund gegebener Vorteile weiterhin möglich zu machen.
- Die Zahl der vertraglichen Homeoffice-Regelungen könnte weiterhin auf vergleichbar niedrigem Niveau sein, da viele Arbeitgebende Homeoffice ggf. nur als zeitweilige Notlösung betrachten. Zudem besteht das Risiko, dass bereits bestehende vertragliche Homeoffice-Regelungen im Rahmen der Corona-Krise nicht angepasst wurden bzw. entsprechende Betriebsverordnung fehlen, die eine Homeoffice-Beschäftigung während der Corona-Krise regeln.
2.3.1.5 Wichtige Einflussfaktoren für gute Homeoffice-Bedingungen
Aus den vorherigen Ausführungen gehen die drei Variablen, die im Hinblick auf den Suchtmittelkonsum von Homeoffice-Beschäftigten untersucht werden, besonders hervor. Sie sind für das Funktionieren virtueller Teams und das Wohlbefinden von Homeoffice-Mitarbeitenden von hoher Relevanz:
- Wichtig für Mitarbeitende im Homeoffice ist eine hohe Arbeitsfähigkeit, die durch ihre Wahrnehmung bestimmt wird. Die Arbeitsfähigkeit steht hier für die Arbeitsbedingungen selbst und deren Einfluss auf die Produktivität von ArbeitnehmerInnen im Homeoffice bzw. möglicher Einschränkungen, die den Beschäftigten ihre Arbeit erschweren können.
- Die Reichhaltigkeit der Kommunikation ist für eine hohe Arbeitsfähigkeit von hoher Relevanz. Gute Kommunikation ermöglicht einen reichhaltigen Informationsaustausch, der z. B. hinsichtlich Beurteilungskriterien und Zielvorgaben relevant ist und auch die Intensität von Beziehungen beeinflussen kann.
- Auch die sozialen Beziehungen unter KollegInnen und zu Vorgesetzten sind wichtig, weil Homeoffice-Beschäftigung deren Entstehung aufgrund der gegebenen Distanz erschweren kann. Die persönlichere Form der Kommunikation, z. B. im Rahmen von Präsenztreffen, wird gerade in Krisenzeiten erschwert.
2.3.2 Betriebliche Suchtprävention
Betriebliche Suchtprävention ist ein wichtiger Bestandteil des BGM, dass vom BGM nicht isoliert betrachtet werden darf. Maßnahmen wie die Sicherstellung gesundheitsfördernder Arbeits- und Umweltbedingungen sowie zur Sicherstellung einer guten Life-Balance sind ebenso Maßnahmen, die der Suchtgefährdung entgegenwirken. Die psychische Verfassung von Mitarbeitenden ist einer der wesentlichen Faktoren, die die Suchtgefährdung steigern bzw. senken kann.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2.3.2.1 Sucht am Arbeitsplatz und ihre Folgen
Diese Arbeit beschränkt den Suchtbegriff auf die Abhängigkeit von Substanzen. Alkohol, Tabak und Medikamente gehören zu jenen Suchtmitteln, die in Deutschland am häufigsten konsumiert werden (vgl. Klein 2021: 112). Alkohol und Zigaretten sind gesellschaftlich akzeptiert, sei es nun im privaten Bereich oder auf Feierlichkeiten. Stress und psychische Belastungen nehmen im Arbeitsalltag immer weiter zu, da der Leistungsdruck steigt. Der Mensch muss permanent „funktionieren“, was zu stärkeren Konsum von Alkohol, Tabak und auch stärkeren Medikamentenmissbrauch führen kann.
Problematisch ist in diesem Zusammenhang, dass Suchtprobleme im Alltag lange Zeit tabuisiert werden. Viele Mitarbeitende erkennen zwar Suchtprobleme bei ihren KollegInnen, fühlen sich aber hilflos oder schweigen aus Loyalität. Daher sind Führungskräfte, Betriebsräte, Personalräte und Mitarbeitendenvertretungen gefordert, frühzeitig zu intervenieren (vgl. ebd.). Dies bedarf allerdings eines umfassenderen Wissens über Sucht, suchtgefährdende Arbeitsbedingungen und psychische Belastungen (vgl. Wienemann 2018: 11; zitiert nach Klein 2021: 112). Folglich gehören Information, Aufklärung, Schulung und Fortbildungen im Bereich der betrieblichen Suchtprävention zu den Kernaufgaben des BGM. In der Praxis bewähren sich hier kombinierte Seminare an zwei Tagen, die aus einer Kombination aus Inhalten zu psychischen Erkrankungen und Suchtprävention bestehen und deren zentrale Inhalte auch im Nachhinein digital verfügbar gemacht werden (vgl. Klein 2021: 112).
Maßnahmen dieser Art sind nicht nur aus sozialer, sondern auch aus ökonomischer Sicht von hoher Relevanz. Nach Hoppenstedt (2016) hat Sucht auch erhebliche wirtschaftliche Folgen für Unternehmen. SuchtmittelkonsumentInnen fehlen demnach deutlich länger und häufiger, während das Risiko von Arbeitsunfällen signifikant erhöht wird. Zudem leidet aufgrund der verminderten Leistungsfähigkeit die Arbeitsqualität, während die Mehrbelastung das Betriebsklima verschlechtert. Eine weitere Belastung stellen zudem die negativen Folgen des Rauchens da. Das Risiko, an Krebs zu erkranken und einen Schlaganfall zu erleiden, ist um ein Doppeltes höher als die von NichtraucherInnen (vgl. Hoppenstedt 2016: 1 f.).
Mitarbeitende im Homeoffice sind aufgrund der Corona-Krise verstärkt psychischen Belastungen ausgesetzt. Den Ausführungen Hoppenstedts nach liegt ein
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
noch stärkerer Konsum bzw. Missbrauch von Suchtmitteln durch Mitarbeitende Homeoffice nahe, wenn die Homeoffice-Situation aufgrund schlechter Bedingungen eine zusätzliche Belastung darstellt.
2.3.2.2 Süchte im Betrieb
Die Suchtprobleme, die unter ArbeitnehmerInnen besonders auftreten, beziehen sich auf legal erwerbliche Suchtmittel, v. a. auf Alkohol, Medikamente und Tabak.
Alkohol
Alkoholsucht ist in Deutschland eine der am meisten verbreiteten Süchte (vgl. Hoppenstedt 2016: 29). Alkohol fällt nicht unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) und ist somit leicht zu beschaffen, bezahlbar und eines der am meisten gesellschaftlich akzeptierten Suchtmittel. Gerade in Deutschland ist Alkohol ein wichtiger Bestandteil traditioneller Kultur. Zwar ist Alkoholkonsum in Deutschland gesunken, allerdings ist der Konsum im internationalen Vergleich mit 10,5 Litern Reinalkohol im Jahr 2017 (pro BundesbürgerIn ab 15 Jahren) dennoch überdurchschnittlich hoch (vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e. V. 2020: 33). Laut einer Pressemitteilung der DHS wiesen 2018 drei Millionen Erwachsene zwischen 18 und 64 Jahren eine Alkohol-bezogene Störung auf. Bei 1,4 Millionen lag Alkoholmissbrauch vor, 1,6 Millionen waren abhängig (Rummel 2020: 1). Zudem ist davon auszugehen, dass der Alkoholkonsum in der Corona-Krise gestiegen ist, was auch einen erhöhten Missbrauch und zunehmende Alkoholabhängigkeit nahelegt.
Nach Jellinek lassen sich Alkoholabhängige in fünf verschiedene Typen unterteilen, die in der folgenden Tabelle kurz dargestellt werden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 1: Jellineks fünf Typen von Alkoholabhängigen (Quelle: Hoppenstedt 2016: 32 f.)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Medikamente
Zu den am meisten in der Arbeitswelt missbrauchten Medikamenten zählen Benzodiazepine, Non-Benzodiazepine und opioidhaltige Schmerzmittel. Aufgrund ihres Suchtpotenzials sind sie i. d. R. verschreibungspflichtig und unterliegen dem BtMG (vgl. Hoppenstedt 2016: 34).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Zu Schmerz- und Betäubungsmitteln gehören Opiate (pflanzlich, z. B. durch Schlafmohn gewonnen, insbesondere Morphin) und Opioide (voll- oder teilsynthetisch mit morphinähnlicher Wirkung). Beide wirken entweder auf das periphere oder das zentrale Nervensystem aus und entfalten damit eine starke, schmerzstillende Wirkung. Ohne kontrollierte, therapeutische Bedingungen stellen sie ein hohes Suchtpotenzial dar (höher als das von Alkohol), da sie Spannungsgefühle und Unlust durch Euphorie und Zufriedenheit ersetzen (vgl. Hoppenstedt 2016: 34 f.).
Zu den Benzodiazepinen gehören verschreibungspflichtige Beruhigungs- und Schlafmittel. Sie wirken bei Angst- und Erregungszuständen sedierend (d. h., das zentrale Nervensystem wird eingeschränkt) und beruhigend. Diese werden oft bei Schlafstörungen verschrieben. Benzodiazepine sollten nicht länger als zwei bis vier Wochen verwendet werden, da das Risiko von Nebenwirkungen wie Schlafstörungen, Unruhe und Stimmungsschwankungen ansonsten immer weiter zunimmt. Folglich treten bei Entzugserscheinungen jene Symptome auf, gegen die solche Mittel eigentlich helfen sollen (vgl. ebd.: 35). Studien haben allerdings gezeigt, dass rund ein Drittel der Menschen, die Benzodiazepine zu sich nehmen, diese länger verwenden als empfohlen. Zwar werden Benzodiazepine immer weniger verordnet, jedoch werden vermehrt Non-Benzodiazepine, sogenannte „Z- Drugs“, verschrieben, die laut WHO ein ähnliches Suchtpotenzial bieten (vgl. Rummel 2020: 12 ff.; zitiert nach Hoppenstedt 2016: 35 f.). Stand heutzutage sind geschätzt 1,5 bis 1,9 Millionen Menschen medikamentenabhängig. Benzodiazepine und Z-Drugs spielen hier, neben Schmerzmitteln, eine entscheidende Rolle.
Tabak
In den Industrienationen ist das Rauchen die führende Ursache vorzeitiger Sterblichkeit. Zu den Erkrankungen, die bei RaucherInnen vermehrt auftreten, gehören u. a. Herz-Kreislauf-, Krebs- und Atemwegserkrankungen (vgl. Rummel 2020: 50). Zigaretten und andere Darreichungsformen von Tabak sind suchterzeugend, wobei Nikotin als wesentlicher Suchtstoff eine Rolle spielt. Die pharmakologischen Prozesse sowie die Verhaltensprozesse ähneln jenen, die eine Heroin- oder Kokainabhängigkeit verursachen und aufrechterhalten (vgl. Marschall et al. 2019, 74). RaucherInnen weisen daher klassische Verhaltensweisen von Süchtigen auf: Zwanghafter fortgesetzter Konsum trotz Schädigung, hohe Priorität des Konsums im Vergleich zu anderen Aktivitäten, Toleranzentwicklung, Entzugssymptome und das Risiko des Rückfalls bei Abstinenzversuchen (vgl. ebd.: 75). Klassische Ent-
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
zugserscheinungen, an denen man sogenannte „SuchtraucherInnen“ erkennen kann, sind:
- Reizbarkeit und Ruhelosigkeit,
- Starkes Verlangen nach Rauchen,
- Bei anhaltender Abstinenz (bis zu 6 Wochen):
Konzentrationsstörungen,
Angstsymptome,
Appetitsteigerung, Schlafstörungen,
In extremen Fällen depressive Symptome bis hin zur Suizidalität.
2.3.2.3 Betriebliche Suchtprävention in der Praxis
Mithilfe von Suchtprävention werden im Rahmen des BGM Maßnahmen angewendet, die den Konsum von legalen als auch illegalen Suchtmitteln vermeiden und vermindern soll. So sollen Folgen des Drogenkonsums verringert werden. Präventionsmaßnahmen sind nach dem Zeitpunkt und der Zielgröße kategorisierbar (vgl. Hoppenstedt 2016: 7).
Tabelle 2: Kategorisierungen von Suchtprävention (Quelle: Hoppenstedt 2016: 7 ff.)
Kategorisierung nach Zeitpunkt
- Primärprävention
Sie zielt darauf ab, der Sucht vorzubeugen, setzt somit vor ihrer Entstehung an und richtet sich somit an gesunde Menschen. Schädigendes bzw. risikohaltiges Verhalten soll frühzeitig erkannt und verhindert werden (vgl. Hoppenstedt 2016: 7 f.), z. B. durch Schulungen und Betriebsvereinbarungen, auch durch gesetzliche Vorgaben.
- Sekundärprävention
Sie dient dazu, Krankheiten wie Süchte frühmöglich zu erkennen und eine Verschlimmerung der Sucht zu vermeiden. Symptome sollen frühzeitig erkannt werden, um Gegenmaßnahmen einzuleiten. Sie richtet sich an gesunde Menschen und auch an jene mit dem Willen, wieder gesund zu werden und Rückfälle zu vermeiden (vgl. ebd.: 8).
- Tertiärprävention
Sie setzt bei bereits bestehender Krankheit oder Sucht an. Es geht darum, deren Folgen zu mildern, wieder von der Sucht wegzukommen und Rückfälle zu verhindern. Die Tertiärprävention weist somit viele Parallelen zur medizinischen Rehabilitation, stationären Drogenentzügen und Selbsthilfegruppen auf (vgl. ebd.).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Kategorisierung nach Zielgröße
- Verhaltensprävention
Das individuelle Verhalten der Mitarbeitenden soll verbessert werden und diese in die Verantwortung ziehen, auf ihre Gesundheit zu achten und gesundheitsschädigende Verhaltensweisen (z. B. hoher Alkoholkonsum) abzulegen. Dies kann z. B. durch Information und Aufklärung, Entwöhnungskurse, Schulungen zur Stressbewältigung und Stärkung der persönlichen Ressourcen erfolgen (vgl. Hoppenstedt 2016: 8). Ein Beispiel für Stärkung persönlicher Ressourcen ist die Stärkung der Beziehung zwischen Mitarbeitenden und Führungskräften. So haben die Beschäftigten eine Vertrauensperson, an die sie sich bei Problemen wenden können.
- Verhältnisprävention
Sie soll die Ursachen von Krankheiten und Süchten am Arbeitsplatz beseitigen und vermeiden (vgl. ebd.: 8 f.). Dazu gehören z. B. Gesundheitsaufklärung und -betreuung, Gesundheitserziehung und -bildung, Gesundheitstraining und Gesundheitsselbsthilfe. Es geht somit um Maßnahmen, um suchtfördernde Arbeitsbedingungen zur vermeiden, auch um Regelungen zur Einschränkung des Konsums bis hin zum Verbot (vgl. ebd.: 9). Leider wird die Verhältnisprävention im Rahmen des BGM oft vernachlässigt. Dies kann dazu führen, dass Mitarbeitenden durchaus gut über suchtbedingte Risiken aufgeklärt sind, sie aber dennoch unter suchtförderliche Arbeitsbedingungen arbeiten (vgl. ebd.).
Betriebliche Suchtprävention sollte somit auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht ernst genommen werden. Sie ist eine wichtige, komplexe Führungsaufgabe. Daher sollten frühzeitig z. B. Investitionen, Schulungen und effektive Gesundheitsprogramme erfolgen, um auch ökonomische Schäden (z. B. durch vermehrte Fehlzeiten und geringer Arbeitsqualität des Personals) vom Betrieb abzuwenden (vgl. Feser 1997: 23).
In Bezug auf Tabak- und Alkoholsucht ist es somit wichtig, bestimmte Risikofaktoren erkannt werden. Darunter zählen:
- Trinken im Freundeskreis,
- Gesellschaftliche Anerkennung,
- Zu hoher Leistungs- und/oder Konkurrenzdruck bei der Arbeit,
- Schlechtes Arbeits- bzw. Betriebsklima,
- Mobbing,
- Mangelnde Anerkennung und Wertschätzung bei der Arbeit (vgl. Schneider 2014: 333).
2.4 Forschungslücke
Bisher wurde nicht gezielt erforscht, wie sich potenzielle Belastungen und Risiken durch Arbeiten im Homeoffice auf den Konsum von Suchtmitteln bei betroffenen ArbeitnehmerInnen auswirken können. Diese Arbeit soll einen Beitrag dazu leisten, diese Lücke zu schließen. Die Ergebnisse dieser Arbeit sollen dahin gehend sensibilisieren, ...
- ... dass die nähere Erforschung zur Erstellung repräsentativer Studien zum Konsum von Suchtmitteln durch Mitarbeitende im Homeoffice wichtig ist, damit betriebliche Suchtprävention sich weiterentwickeln und zeitgemäßer gestaltet werden kann. Diese muss nicht nur in Betrieb vor Ort, sondern auch im Homeoffice aus größerer Distanz funktionieren. Die vorliegende Arbeit soll eine Grundlage dafür schaffen.
- ... die Bedeutung der Verantwortung hervorzuheben, die Arbeitgebende für die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden haben, auch wenn diese im Homeoffice arbeiten und nicht im Betrieb sind. Betriebliches Gesundheitsmanagement, darunter auch betriebliche Suchtprävention, gehört zu den wichtigsten Managementaufgaben. Dieser Verantwortung kommen viele Arbeitgebende scheinbar nicht konsequent nach.
Bei einem Großteil der Mitarbeitenden im Homeoffice scheinen die Rahmenbedingungen für die Mitarbeitende im Homeoffice noch nicht zu stimmen. Nur eine knappe Mehrheit sah Homeoffice vor Krisenbeginn als Entlastung an (vgl. Lott 2020: 1). Es besteht die Gefahr, dass schlechte Rahmenbedingungen das Stressempfinden von Mitarbeitenden im Homeoffice und somit auch das Suchtrisiko zu Krisenzeiten noch weiter steigern, was im Sinne der Verhältnisprävention ein Risiko darstellt. Inwiefern diese Gefahr für Mitarbeitende im Homeoffice besteht und was dagegen unternommen werden kann, ist noch nicht ausreichend erforscht.
3 Methodisches Vorgehen
3.1 Sekundärforschung: Die Theorie
Die Thematik wurde anhand vorhandener Literatur, die sich mit dem Thema Sucht im Betrieb bzw. betrieblicher Suchprävention und Homeoffice befasst, aufgearbeitet. Dadurch soll LeserInnen ein Grundverständnis für die Thematik vermittelt werden. Dementsprechend wurde darauf wert gelegt, diese möglichst kurz und verständlich darzustellen, um die Ergebnisse der Primärforschung möglichst umfassend präsentieren zu können.
3.2 Primärforschung: Empirische Forschung durch qualitative Methodik
In diesem Kapitel wird die empirische Methodik beschrieben. Eine nähere Darstellung der Primärforschung lässt sich dem Anhang entnehmen.
3.2.1 Semistrukturiertes Interview
Bei einem semistrukturierten Interview wird die Reihenfolge der Fragen festgelegt, es bleiben jedoch zumindest überwiegend offene Fragen ohne Antwortkategorien. Somit wird das Themenfeld eingegrenzt, während der Befragte dennoch eigenen Assoziationen folgen kann. Die Fragen beziehen sich auf die relevanten Schwerpunkte des Themas und sollen Aufschluss darüber geben, wie hoch der Suchmittelkonsum der Befragten ist und wo die Ursachen liegen könnten.
Ziel ist es, die Interviews so persönlich wie möglich zu führen. Aufgrund der Corona-Krise wurde dazu auf Video-Telefonie gesetzt, um anhand von Tonlage, Betonung und auch Mimik der Befragten und bessere Rückschlüsse aus den Antworten ziehen zu können. Dazu wurden die Interviews entsprechend transkribiert und folglich analysiert.
Es wurden insgesamt 12 Mitarbeitende im Homeoffice befragt, die teilweise im öffentlichen Bereich und in der Privatwirtschaft tätig sind.
Im Rahmen dieser Arbeit wird der Suchtmittelkonsum besonders in Bezug auf Alkohol, Tabak und Medikamenten bewertet, da diese eine breite gesellschaftliche Akzeptanz erfahren, aber dennoch ein hohes Suchtpotenzial besitzen. Zudem ist der Konsum dieser Suchtmittel in Betrieben am meisten verbreitet.
Es wurde das Risiko in Betracht gezogen, dass die Befragten hinsichtlich ihres Suchtmittelkonsums nicht ehrlich antworten könnten. Um dem vorzubeugen, wurden bei der Durchführung der Interviews folgende Voraussetzungen geschaffen:
- Die Befragten haben zum Interviewer bereits ein Vertrauensverhältnis, d. h. sie kommen aus dem näheren Umfeld des Interviewers.
- Das semistrukturierte Interview wurde bewusst ausgesucht, um die Befragten zwar strukturiert mit bestimmten Schwerpunkten zu interviewen, allerdings mehr in Form eines ungezwungeneren Gesprächs. „Smalltalk“ wurde bewusst zugelassen, um das Interview für die Befragten angenehmer zu gestalten und eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, damit sie freier und offener antworten und ggf. auch wichtige Aspekte nennen, nach denen nicht gezielt gefragt wurde. Der Interviewer gab teilweise auch Einsicht in seine eigene persönliche Situation, um die Befragten dazu zu ermutigen, offen und ehrlich zu antworten.
- Die Interviews wurden per Video-Telefonie geführt und aufgezeichnet. Die Transkriptionen wurden mittels zuvor festgelegter Transkriptionsregeln durchgeführt. Den Befragten wurde eine schriftliche Zusicherung angeboten, dass lediglich die Transkriptionen für Dritte sichtbar werden, jedoch nicht die Videoaufzeichnungen selbst. Ebenso wurde versichert, dass die Namen der Befragten und deren Arbeitgebende in den Transkriptionen nicht erwähnt werden, um diese vor eventuellen Konsequenzen zu schützen. Einer der Befragten nahm dieses Angebot an, die restlichen Befragten sprachen ihr Vertrauen aus und verzichteten auf diese schriftliche Zusicherung.
3.2.2 Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring
Zur Erstellung des Interviewleitfadens und zur Analyse der Antworten wurden Mayrings Ausführungen zur qualitativen Inhaltsanalyse als maßgebliche Inspiration genutzt. Sie dient der Strukturierung des Interviewtextes (mithilfe von Kategorien) mit dem Ziel, zentrale Aussagen zu generieren. Dabei spielt aber nicht nur das Gesagte eine Rolle. Ebenso relevant ist die Umgebung. Der Interviewtext wird in den Forschungskontext eingeordnet. Zentrale Themen, die ein Interview dominieren, werden identifiziert. Die Strukturierung erfolgt mittels Zusammenfassung der einzelnen Abschnitte. Das erfordert eine Codierung des Textes, die durch ein erstelltes Sichtwortregister erfolgt.
Die Ergebnisse des codierten Textes werden ausgewertet und interpretiert. Wichtig ist hierbei das genaue Verbleiben am Originaltext, um den Sinn der Aussagen nicht zu verfälschen. Beim induktiven Vorgehen wird vom Einzelinterview auf eine eigene Theorie geschlossen, während beim deduktiven Verfahren vom Allgemeinen auf das jeweils Besondere geschlussfolgert wird. Jedoch ist nach Gläser und Laudel (2010; zitiert nach Steinhardt 2019) zu empfehlen, deduktive und induktive Vorgehensweise zu kombinieren. Es werden zunächst deduktive Kategorien aus der Theorie abgeleitet. Diese Kategorien erhalten Regeln bzw. Indikatoren, die eine klare Zuordnung der Kategorie ermöglichen, was den Codierregeln nach Mayring entspricht. Wird der Interviewtext codiert, können die Kategorien angepasst werden und induktiv neue Kategorien erarbeitet werden (vgl. Steinhardt 2019). Daher wurde in dieser Arbeit nach dieser Methodik verfahren. Der Interviewleitfaden wurde vom aktuellen Forschungsstand inspiriert und mögliche Kategorien zur Analyse abgeleitet, die sich auf die wahrgenommene Arbeitsfähigkeit, der Intensität von Beziehungen, die Reichhaltigkeit der Kommunikation, der mentalen Verfassung der Befragten und deren Suchtmittelkonsum beziehen. Während der Analyse der Interviews anhand der Transkriptionen wurden die Kategorien induktiv angepasst.
Die Methode nach Mayring folgt vier Grundkonzepten, die in der folgenden Tabelle dargestellt werden:
Tabelle 3: Grundkonzepte der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (Quelle: Mayring 2015)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3.3 Umgang mit Gütekriterien der qualitativen Forschung
Die klassischen Gütekriterien Validität, Reliabilität und Objektivität sind im Rahmen der qualitativen Forschung ungeeignet und nur schwer zu erfüllen. Daher wurden jene Gütekriterien gewählt, die überwiegend in Bezug auf qualitative Forschung angewendet und als erfüllbar bewertet wurden.
3.3.1 Intersubjektivität
Vollständige Objektivität ist bei qualitativer Forschung schwer umzusetzen. Die Ergebnisse der Interviews müssen subjektiv interpretiert werden. Daher sind die Interpretationen als mögliche Schlussfolgerungen und Annahmen, jedoch nicht als allgemein geltende Fakten zu betrachten. Diese Schlussfolgerungen und Annahmen können im durch weiterreichende quantitative Forschung überprüft werden, wofür diese Arbeit eine Grundlage schaffen soll. LeserInnen steht es somit frei, zu anderen Interpretationen und Meinungen zu kommen.
3.3.2 Reichweite
Es wurden insgesamt 12 Interviews mit ArbeitnehmerInnen geführt, die im Homeoffice beschäftigt sind. Damit soll eine gewisse Grundgemeinsamkeit herausgearbeitet werden. Somit ist bei einer Wiederholung der Forschung davon auszugehen, dass diese Grundgemeinsamkeiten erneut oder auf ähnliche Weise herausgearbeitet werden können. Die Wahrscheinlichkeit ist umso höher, umso mehr Interviews geführt werden können.
3.3.3 Transparenz
Die Arbeitsschritte wurden im Rahmen der Methodik beschrieben und dokumentiert. Zudem ist die Auswertung im Anhang einsehbar. Die Forschungsfrage, die gewählten Variablen sowie die Auswahl der Variablen wurden entsprechend begründet und im Rahmen der Sekundärforschung nachvollziehbar abgeleitet. Ebenso wurde die Auswahl der Forschungsinstrumente entsprechend begründet. Die Anwendung der qualitativen Analyse nach Mayring sowie die angegebenen Transkriptionsregeln, die gemeinsam mit den Analysen im Anhang hinterlegt sind, ermöglichen die Vorgehensweise nachzuvollziehen. Ebenso wurden bei der Beurteilung des Alkoholkonsums u. a. die fünf Suchttypen verwendet, die im Rahmen der Sekundärforschung genannt wurden. Somit ist für LeserInnen nachvollziehbar, was konkret untersucht und gemessen wird: Die drei genannten Variablen und deren Einfluss auf den Suchtmittelkonsum von Homeoffice-Beschäftigen unter den Bedingungen der Corona-Krise.
4 Ergebnisse und Handlungsempfehlungen
4.1 Auswertung und Interpretation der Ergebnisse aus den geführten Interviews
4.1.1 Gemeinsamkeiten
Hinsichtlich der Reichhaltigkeit der Kommunikation und der Intensität von Beziehungen im Homeoffice ergaben sich bei den belastenden Faktoren zwischen einem Großteil der Befragten Gemeinsamkeiten.
4.1.1.1 Reichhaltigkeit der Kommunikation
- Die meisten der Befragten glauben, dass die Remote-Kommunikation ihre Arbeitsfähigkeit gewährleistet, sie aber dennoch nicht dieselbe Qualität wie die Kommunikation im persönlichen Gespräch besitzt.
- Die Remote-Kommunikation ist zeitintensiver als die Kommunikation direkt vor Ort. Damit ist sie weniger effizient und effektiv, was die Arbeitsfähigkeit einschränken kann. Das liegt u. a. an der schwereren Erreichbarkeit von KollegInnen (z. B. telefonische Erreichbarkeit oder Erreichbarkeit per E-Mail).
- Die Remote-Kommunikation erschwert den informellen Austausch, da die Kommunikation überwiegend formell ist. Dadurch ist die Kommunikation unpersönlicher. Informelle Zwischengespräche unter KollegInnen, bei denen z. B. auch wichtige Projekte besprochen werden, sind nur eingeschränkt möglich. Daher ist die Remote-Kommunikation kein gleichwertiger Ersatz zum direkten Austausch in Betrieb.
- Die nonverbale Kommunikation ist auf niedrigerem Niveau. Während in Telefonaten Mimik und Gestik der GesprächspartnerInnen grundsätzlich nicht eingeschätzt werden können, schalten in Videokonferenzen nicht alle TeilnehmerInnen ihre Kameras ein. Des Weiteren wird vermehrt schriftlich kommuniziert. Dies erschwert eine Einschätzung des Gemütszustands eines Gegenübers und begünstigt Missverständnisse, die das Konfliktpotenzial erhöhen.
- Nur wenige sehen ein großes Verbesserungspotenzial in Bezug auf die Remote-Kommunikation. Manche halten die Kommunikation für ausreichend, andere scheinen ratlos hinsichtlich möglicher Verbesserungsoptionen zu sein.
4.1.1.2 Intensität von Beziehungen
- Ein Großteil der Befragten ist der Ansicht, dass die Bindungen zu vielen KollegInnen durch die geringere soziale Interaktion, die dem unpersönlicheren Austausch (überwiegend formell) aufgrund der Remote-Kommunikation zugrunde liegt, schwächer werden.
- Die Beziehungen beschränken sich auf einen engeren Kreis (z. B. zum eigenen Team oder befreundeten KollegInnen), da sich die Remote-Kommunikation aufwendiger gestaltet. Dadurch wird mit anderen KollegInnen weniger kommuniziert, wodurch die Bindungen zu ihnen schwächer werden. Zum engeren Kreis werden die Bindungen jedoch oft enger, da der Austausch in einem privateren Rahmen stattfindet.
- Es fehlt an den üblichen Ritualen unter KollegInnen (z. B. der gemeinsame Kaffee, das gemeinsame Mittagsessen, sonstige gemeinsame Aktivitäten außerhalb der Arbeitszeit), wodurch weniger miteinander kommuniziert und interagiert wird. Digitale Lösungen sind diesbezüglich kein gleichwertiger Ersatz und eher im engeren Kreis möglich, da die soziale Interaktion ansonsten erschwert wird.
4.1.1.3 Sonstige Gemeinsamkeiten
Der Großteil der Befragten empfand die plötzliche Umstellung zu Krisenbeginn von Realoffice (d. h. im Büro) und Homeoffice als herausfordernd, zum Teil auch überfordernd. Es ist zudem anzumerken, dass nur bei 2 von 12 Arbeitgebenden vertragliche Regelungen bestehen bzw. in Arbeit sind, die eine Homeoffice- Beschäftigung während der Corona-Krise regeln.
Alle drei Befragten aus dem Öffentlichen Dienst beklagen fehlende Unterstützung hinsichtlich der technischen Ausstattung durch ihre Arbeitgebenden, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Bei den meisten Mitarbeitenden im Homeoffice aus der Privatwirtschaft scheint die technische Ausstattung auf ausreichendem bis gutem Niveau zu sein. Diese unterschiedlichen technischen Voraussetzungen haben bei den Befragten unterschiedliche Auswirkungen auf die wahrgenommene Arbeitsfähigkeit.
4.1.2 Wahrgenommene Arbeitsfähigkeit im Homeoffice
Die wahrgenommene Arbeitsfähigkeit wurde bereits in Bezug auf die RemoteKommunikation erwähnt. Hinsichtlich der Produktivität kommen die Befragten allerdings zu unterschiedlichen Einschätzungen. Während manche glauben, dass ihre Produktivität im Vergleich zum Realoffice identisch oder sogar besser sei, glauben andere an eine geringere Produktivität. Manche der Befragten können diese wiederum nur schwer einschätzen. Eine Mitarbeitende begründet dies mit jeweiligen Vor- und Nachteilen der Realoffice-Beschäftigung und der Homeoffice- Beschäftigung.
Eine Befragte gibt an, dass die Nutzung kollaborativer Arbeitswerkzeuge die Arbeitsfähigkeit erhöht, da durch Videokonferenzen eine reichhaltigere Kommunikation ermöglicht werden kann. Beschränkt sie sich nur auf E-Mails und Telefonate, wäre die Arbeitsfähigkeit auf fehlender Kommunikationsreichhaltigkeit eingeschränkt.
4.1.3 Life-Balance der Befragten
Bezüglich der Life-Balance im Homeoffice nennen die Befragten positive sowie negative Faktoren, die sich überwiegend aus der Homeoffice-Beschäftigung während der Corona-Krise ergeben.
Tabelle 4: Positive und negative Faktoren der Life-Balance, die von den Befragten genannt wurden
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4.1.4 Suchmittelkonsum der Befragten im Überblick
Hinsichtlich des Suchmittelkonsums ist der erhöhte Alkoholkonsum besonders auffällig. Ursachen scheinen hier nicht nur die Homeoffice-Bedingungen selbst, sondern auch äußere Faktoren zu sein, die sich aus der Corona-Krise ergeben und eine mentale Belastung hervorrufen, die viele vor allem durch erhöhten Alkoholkonsum zumindest zeitweilig zu kompensieren schienen und somit Eigenschaften des von Jellinek beschrieben Alpha-Typs (KonflikttrinkerInnen) aufweisen. So empfinden die meisten die Einschränkung sozialer Kontakte als besonders belastend. Schlechte Homeoffice-Bedingungen scheinen die mentalen Belastungen zu verstärken hinsichtlich sozialer Isolationen, einer als schlechter wahrgenommenen Arbeitsfähigkeit im Vergleich zu Realoffice und einer weniger reichhaltigen Kommunikation im Vergleich zu Realoffice. Besonders Vollzeit-Homeoffice in Kombination mit einer Homeoffice-Pflicht stellt offenbar einen starken Verstärker dieser Belastung dar. Ebenso wurde von manchen Befragten die fehlende Unterstützung seitens der Arbeitgebenden bemängelt.
Jedoch scheinen gute Homeoffice-Bedingungen (auch in Vollzeit) wiederum eine Entlastung darzustellen und den Suchtkonsum zu lindern, sofern Reichhaltigkeit der Kommunikation als besser empfunden, Bindungen zu ArbeitskollegInnen als enger bewertet (zumindest zu einem engeren Kreis) und die wahrgenommene Arbeitsfähigkeit als verbessert oder zumindest gleichbleibend betrachtet werden. Ebenso scheinen ergriffene Life-Balance-Maßnahmen seitens der Arbeitgebenden sich positiv auf die mentale Verfassung auszuwirken und die Suchtgefährdung zu lindern, auch weil folglich die wahrgenommene Fairness und Unterstützung seitens der Arbeitgebenden positiv beeinflusst wird. Bei fast allen Befragten, die ihre Homeoffice-Bedingungen als überwiegend positiv wahrnehmen, liegt daher einen eher geringen Suchtmittelkonsum vor bzw. sie scheinen dem Alpha-Typ hinsichtlich ihres Alkoholkonsums nicht zu entsprechen.
4.1.5 Hervorzuhebende Besonderheiten und Unterschiede
Bei der Auswertung der Interviews ergab sich, dass es zwischen dem Öffentlichen Dienst, Unternehmen mit ausbaufähigen Homeoffice-Bedingungen und Unternehmen mit überwiegend guten Homeoffice-Bedingungen Unterschiede gab. Daher werden im Folgenden Besonderheiten von neun der Befragten dargestellt.
4.1.6 Öffentlicher Dienst
Eine Befragte arbeitete bis August 2020 im Homeoffice als Beamtin in einer Bankenaufsicht. Der andere Befragte ist als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einer Universität tätig.
4.1.6.1 Belastungsfaktoren im Homeoffice
Reichhaltigkeit der Kommunikation
Beide waren der Ansicht, dass die Kommunikation im Homeoffice (RemoteKommunikation, da sie aus der Distanz stattfindet) weniger reichhaltig sei als in Betrieb selbst. Die Beamten aus der Bankenaufsicht beschreibt folgende Situation:
- Ein kollaboratives Arbeitswerkzeug wurde zwar genutzt, allerdings wurde nicht das volle Potenzial genutzt (fehlende Einweisung bezüglich der Nutzung des Tools), was die Kommunikation einschränkte. Viele nützliche Funktionen (z. B. Bildschirm teilen) waren nicht bekannt.
- Die Einarbeitungsphase war für sie schwierig im Homeoffice, da ihr Arbeitsschritte per Telefon schwerer kommuniziert werden konnte.
Intensität von Beziehungen
Beziehungen zu KollegInnen
Beide sind der Meinung, dass die Bindungen zu vielen KollegInnen durch die geringere soziale Interaktion, die der unpersönlicheren Remote-Kommunikation zugrunde liegt, schwächer werden. Der soziale Kontakt zu KollegInnen beschränkt sich auf einen engeren Kreis (zu jenen, mit denen sie freundschaftliche Beziehun- gen pflegen), mit dem per Videokonferenz oder Telefon ein regelmäßiger Austausch stattfindet.
Beziehung zu Vorgesetzten, Fairness von Vorgesetzten
Während der wissenschaftliche Mitarbeiter angab, dass er eine gute Beziehung zu seinem direkten Vorgesetzten pflegt und dieser einen fairen Führungsstil aufweist, war die Beamtin aus der Bankaufsicht sehr unzufrieden.
Tabelle 5: Empfundene Fairness des Vorgesetzten von zwei Befragten des Öffentlichen Dienstes
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Wahrgenommene Arbeitsfähigkeit
Produktivität der Befragten
Der wissenschaftliche Mitarbeiter ist der Ansicht, dass seine Produktivität aktuell vergleichbar mit jener im Betrieb selbst wäre. Die Arbeitsfähigkeit wäre nur zu Krisenbeginn eingeschränkt gewesen. Die Beamtin aus der Bankenaufsicht hingegen berichtet von einer fehlenden Motivation, die sich negativ auf die Arbeitsfähigkeit auswirken kann.
Auswirkungen der Remote-Kommunikation auf die Arbeitsfähigkeit
Die Beamtin aus der Bankenaufsicht gibt an, dass die ihre Einarbeitungsphase durch die Remote-Kommunikation erschwert gewesen wäre. Wichtige Arbeitsvorgänge konnten schlechter vermittelt werden.
Sonstige Einschränkungen
Beide gaben an, zu Krisenbeginn nicht über die nötige technische Ausstattung zu verfügen, was ihr Arbeitsfähigkeit einschränkte. Der wissenschaftliche Mitarbeiter konnte seine Arbeitsfähigkeit erst durch Anschaffung besserer Ausstattung erhöhen. Während sich seine Ausstattung und die Arbeitsumstände mit der Zeit dadurch verbessert haben, war die technische Ausrüstung sowie die Büroausstattung bei der Beamtin aus der Bankenaufsicht durchgehend unzureichend. Ihr Laptop habe einen kleinen Bildschirm gehabt, ebenso habe ein Drucker gefehlt. Womöglich reichten ihre eigenen Finanzen nicht, um sich entsprechend gut auszurüsten.
4.1.6.2 Unterstützende Faktoren im Homeoffice
Reichhaltigkeit der Kommunikation
Der wissenschaftliche Mitarbeiter hat durch seine längere Zeit im Ausland Erfahrung darin, in einer Remote-Situation mit seinen ArbeitskollegInnen zu arbeiten. Die Umstellung wäre zusätzlich dadurch erleichtert worden, dass die zuständige Universität schnell ein kollaboratives Arbeitswerkzeug zur Verfügung stellte. Zudem wurde vorher bereits ein eigenes Tool genutzt, da sein Vorgesetzter für die Nutzung solcher Möglichkeiten eine allgemeine Offenheit und Vertrauen in seine Mitarbeitenden gezeigt habe.
Intensität von Beziehungen
Beziehungen zu KollegInnen
Zu manchen KollegInnen werden auch freundschaftliche Verhältnisse gepflegt, während die meisten Beziehungen eher professioneller Natur sind. Der wissenschaftliche Mitarbeiter spricht von einem guten Betriebsklima, während die Beamtin aus der Bankenaufsicht von einem akzeptablen Betriebsklima spricht.
Beziehung zu Vorgesetzten, Fairness der Vorgesetzten
Der wissenschaftliche Mitarbeitet bewertet den Führungsstil seines Vorgesetzten als gleichermaßen ziel- und mitarbeitendenorientiert und somit als partizipativ. Er nehme die Sorgen und Nöte seiner Mitarbeitenden ernst und würde sich um eine gute Life-Balance bemühen. So erlaube sein Vorgesetzter, auch aus psychischen Gründen das Büro aufsuchen zu dürfen, wenn sozialer Kontakt gewünscht ist. Ebenso wäre der geringe Arbeitsdruck zu Krisenbeginn auf die Fairness seines Vorgesetzten zurückzuführen.
Wahrgenommene Arbeitsfähigkeit
Aus den Aussagen des wissenschaftlichen Mitarbeiters lässt sich ableiten, dass das gute Betriebsklima trotz der gegebenen Distanz einen guten Zusammenhalt zwischen den KollegInnen sicherstellt. Dieser Umstand könnte die aus seiner Sicht identisch gebliebene Produktivität im Homeoffice erklären, da er in einem funktionierenden Team arbeitet. Dass seine Arbeitsfähigkeit aktuell mit der im Büro selbst vergleichbar ist, wird höchstwahrscheinlich auch mit zwei weiteren Umständen zusammenhängen:
- Seine Homeofficeausstattung ist durch eigene Investitionen auf einem höheren Niveau.
- Er kann mittlerweile bei Bedarf auch in sein Büro, um Tätigkeiten auszuführen, die er im Homeoffice nicht durchführen kann. Dies war zu Krisenbeginn nicht möglich.
Die Beamtin aus der Bankenaufsicht beschreibt zwar insgesamt schlechte Arbeitsbedingungen. Das Homeoffice selbst scheint ihre Produktivität aber zu steigern. Sie begründet dies damit, dass sie im Homeoffice mehr Ruhe habe. Im Realoffice gäbe es mehr Störgeräusche (z. B. Flurgeräusche bei offenen Bürotüren aufgrund lauter Gespräche). Dies scheint die durch ihre Wohnbedingungen gegebene Einschränkungen zu kompensieren und eine gute Arbeitsfähigkeit zu gewährleisten.
4.1.6.3 Suchtmittelkonsum der Befragten
Konsum des wissenschaftlichen Mitarbeitenden
Er selbst sagt, dass sein Alkoholkonsum seit Beginn der Corona-Krise geringer sei, da es aufgrund geringerer sozialer Kontakte weniger Konsumanlässe gäbe. Er gab zudem an, dass sein Konsum im Oktober und November zeitweilig gestiegen sei. Aktuell versuche er aber seinen Alkoholkonsum zu beschränken.
Dennoch spricht er davon, dass er zwei- bis viermal die Woche Alkohol konsumiere und er Ausnahmen machen würde, um mit ArbeitskollegInnen (wahrscheinlich virtuell) ein Feierabendgetränk zu sich nehmen.
Seinen Konsum betrachtet er als unproblematisch. Alkoholkonsum ist aus seiner Sicht ein übliches soziales Ritual. Seiner Meinung nach würde die WHO ihn wahr- scheinlich als alkoholabhängig bezeichnen, jedoch wären die WHO-Regeln auch entsprechend streng.
Möglicher Konsumanlass
Der Befragte bezeichnet sich als extrovertierten Menschen, weswegen ihn vor allem, der fehlende soziale Kontakt im Zuge der Kontaktbeschränkungen fehlt. Ebenso empfindet er seine Sorge um jene Verwandte als Belastung, die Risikogruppen angehören.
Die soziale Distanz, die aus seiner Sicht durch Homeoffice verstärkt wird, empfindet er in Bezug auf Homeoffice dahin gehend belastend, dass die üblichen Rituale fehlen (das gemeinsame Essen, nach der Arbeit etwas trinken, gemeinsame Festivitäten). Das bedrückt ihn aktuell noch stärker als zu Krisenbeginn oder im Sommer, wo Treffen unter Hygienebedingungen noch möglich waren.
Der Befragte scheint insgesamt ein Beta-Typ (Gewohnheitstrinker) zu sein. Er trinkt Alkohol vor allem zu besonderen Anlässen (Feierabendgetränk), allerdings nicht in geringen Mengen. Das würde bedeuten, dass er vor Krisenbeginn mehr Alkohol konsumiert hat, da es mehr Gelegenheiten für Alkoholkonsum mit Freunden und Bekannten gab. Ebenso merkmalstypisch für einen Gewohnheitstrinker ist, dass er seinen Alkoholkonsum als unproblematisch bewertet, obwohl er sehr regelmäßig konsumiert.
Ein Blick auf seinen erhöhten Alkoholkonsum im Oktober und November 2020 zeigt, dass er in diesem Zeitraum aufgrund einer erhöhten Belastung als AlphaTyp (Konflikttrinker) eingeordnet werden kann. Das hat folgende Gründe:
- Er beschreibt den aktuellen Lockdown zum Zeitpunkt der Befragung als belastender als zu Krisenbeginn und im Sommer.
- Im Zeitraum von Oktober und November 2020 wurden die Infektionsschutzmaßnahmen der Regierung aufgrund steigender Infektionszahlen verschärft. Die folgende erneute Einschränkung sozialer Kontakte (verstärkt durch vermehrtes Arbeiten im Homeoffice), die im Sommer 2020 in geringerem Maße nötig war aufgrund geringerer Infektionszahlen und schwächerer Maßnahmen durch die Regierung, wird ihn mit hoher Wahrscheinlichkeit stärker belastet haben.
Daher spricht vieles dafür, dass er in diesem Zeitraum ein Konflikttrinker war. Auch deswegen, weil er seinen Konsum danach wieder einschränken konnte. Auch die aktuelle Situation beschreibt er als belastender. Das Homeoffice selbst scheint einen nennenswerten Beitrag dazu zu leisten. Daher scheint er eine Mischung aus Alpha- und Beta-Typ zu sein. Er trinkt zwar auch aus Gewohnheit, sucht aber auch eine Kompensation des fehlenden Ausgleichs durch zwischenmenschlichen Austausch in Verbindung mit Alkohol.
Konsum der Beamtin in der Bankenaufsicht
Aktuell trinkt sie keinen Alkohol. Sie gibt aber an, nach Beginn der Corona-Krise und während ihrer Zeit im Homeoffice mehr Alkohol konsumiert zu haben. So habe sie auch zu Feierabendgetränken geneigt. Dieses Bedürfnis habe sie vor der Corona-Krise nicht verspürt.
Während ihrer Zeit im Homeoffice schätzt sie ihren Konsum auf zwei bis dreimal die Woche. Dabei habe sie eine Flasche Bier bzw. ein Glas Wein konsumiert, manchmal eine ganze Flasche Wein. Ihren Konsum selbst sieht sie auch in dieser Zeit nicht als problematisch an.
Möglicher Konsumanlass
Vieles spricht dafür, dass sie während ihrer Zeit im Homeoffice als Alpha-Typ (Konflikttrinkerin) einzuordnen ist. Grund dafür sind mit hoher Wahrscheinlichkeit die von ihr beschriebenen schlechten Arbeitsumstände. Sämtliche von ihr beschriebenen psychischen Belastungen beziehen sich auf ihre fehlende LifeBalance (die sich u. a. aus schlechten Wohnbedingungen ergeben) im Homeoffice und dem unfairen Verhalten ihres Vorgesetzten.
Nicht mehr im Homeoffice zu arbeiten beschreibt sie als starke Entlastung, weil Berufs- und Privatleben nicht mehr verschwimmen. Ebenso sei sie technisch besser ausgestattet. Daher verspüre sie trotz der Pandemielage keine akute Belastung. Das wird vermutlich mit ihrer Introvertiertheit zusammenhängen, die sie sich selbst zuschreibt. Dass sie aktuell keinen Alkohol trinkt spricht zusätzlich dafür, dass sie während ihrer Zeit im Homeoffice eine Konflikttrinkerin war, da sie den Konsum eigenständig beenden konnte.
4.1.7 Unternehmen mit ausbaufähigen Homeoffice-Bedingungen
Drei der Befragten arbeiten in Unternehmen, deren Homeoffice-Bedingungen insgesamt als ausbaufähig bezeichnet werden könnten. Eine Befragte arbeitet als Angestellte in einer Medienagentur, einer als Teilzeitkraft in der Baubranche. Die dritte Befragte arbeitet hauptberuflich als Geschäftsführerin ein privates Weiterbildungsinstitut, ebenso als pädagogische Mitarbeitende eines Fußballvereins. Das Weitbildungsinstitut und der Fußballverein sind demselben Unternehmen zugehörig.
4.1.7.1 Belastungsfaktoren im Homeoffice
Reichhaltigkeit der Kommunikation
Alle Befragten geben an, dass die Remote-Kommunikation schlechter und weniger reichhaltig ist als der direkte Austausch im Realoffice.
- Aufgrund der Remote-Kommunikation muss aus Sicht der Mitarbeitenden der Medienagentur präziser kommuniziert werden, damit Briefings per E-Mail richtig verstanden werden. Das wiederum gestaltet die Kommunikation formeller und somit weniger persönlich.
- Die Geschäftsführerin des Weiterbildungsinstituts gibt an, dass sie aufgrund des Konfliktpotenzials durch Missverständnisse in der Remote-Kommunikation Konflikte unter ihren Mitarbeitenden schlichten müsse. Sie telefoniere daher viel mit ihren Mitarbeitenden, um das Risiko von Missverständnissen durch schriftliche Kommunikation zu umgehen (was aufwendiger sei, als Mitarbeitende direkt im Realoffice anzusprechen).
- Lediglich der Mitarbeitende aus der Baubranche gibt an, dass durch die schriftliche Kommunikation keine Missverständnisse entstehen, da sich alle gut kennen.
Hinsichtlich des Verbesserungspotenzials in der Kommunikation sieht der Mitarbeitende aus der Baubranche die Lösung darin, wöchentliche, teaminterne Teams im engeren Kreis zu machen. Die aktuellen Großmeetings mit allen Abteilungen des NRW-Standortes betrachtet er als ineffektiv aufgrund des geringeren Informationsflusses.
Intensität von Beziehungen
Bei der Geschäftsführerin des Weiterbildungsinstituts sind die Beziehungen zur ihren Mitarbeitenden nach ihrer Beschreibung kompliziert. Privat hat sie gut Beziehungen zu ihren Mitarbeitenden, da diese sie seit ihrer Kindheit kennen. Das macht die beruflichen Beziehungen wiederum schwieriger und sorgt bei ihren Mitarbeitenden für Widerstände. Daraus lässt sich ableiten, dass hier die Trennung von Beruf und Privat eine Herausforderung darstellt.
Hinsichtlich des Betriebsklimas kann der Mitarbeitende aus der Baubranche keine Einschätzung geben, da er von seinen KollegInnen zu sehr isoliert ist. Die anderen Befragten beschreiben das Betriebsklima als schlecht, jedoch aus unterschiedlichen Gründen:
- In der Medienagentur herrschte vor Krisenbeginn ein gutes Betriebsklima. Seit der Corona-Krise jedoch fühlen sich die Mitarbeitenden durch Arbeitsbedingungen aufgrund der Corona-Krise sehr belastet, was das Betriebsklima verschlechtert.
- Im Weiterbildungsinstitut fehlt die Harmonie zwischen den Mitarbeitenden. Aufgrund bestehender Konflikte funktionieren sie nicht als Team. Daher muss die Befragte als Geschäftsführerin regelmäßig deeskalierend eingreifen.
Beziehungen zu Vorgesetzten, Fairness der Vorgesetzten
Bei der Geschäftsführerin des Weiterbildungsinstituts scheint eine einseitige Wertschätzung vorzuliegen. Während ihr Vorgesetzte sie schätzt, spielt sie ihm ihre Wertschätzung lediglich vor. Sie verbindet eher negative Gefühle mit ihrem Vorgesetzten.
Was die Fairness anbelangt, zeichnet sich hier ein unterschiedliches Bild ab, dass in der folgenden Tabelle dargestellt wird:
Tabelle 6: Fairness der Vorgesetzten bei den drei Befragten der Gruppe „Unternehmen mit ausbaufähigen Homeoffice-Bedingungen“
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Wahrgenommene Arbeitsfähigkeit
Der Arbeitsumfang und -aufwand hat sich für zwei der Befragten erhöht. Der Mitarbeitende der Baubranche berichtet lediglich über einen größeren Arbeitsaufwand. Hinsichtlich der Produktivität glauben der Mitarbeitende aus der Baubranche und die Geschäftsführerin des Weiterbildungsinstituts, dass ihre Produktivität im Homeoffice eher gesunken ist. Auch die Mitarbeiterin der Medienagentur gibt Gründe an, die ihre Produktivität im Homeoffice einschränkt.
Tabelle 7: Wahrgenommene Arbeitsfähigkeit der Befragten aus der Gruppe „Unternehmen mit ausbaufähigen Homeoffice-Bedingungen“
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4.1.7.2 Unterstützende Faktoren im Homeoffice
Intensität von Beziehungen
Die Beziehungen der Mitarbeiterin der Medienagentur sind zu den meisten KollegInnen professioneller Natur (beim Mitarbeiter der Baubranche ausschließlich professionell). Mit einer Kollegin arbeitet sie sehr eng zusammen, weswegen sie hier von einer freundschaftlichen Beziehung spricht. Durch die Homeoffice- Beschäftigung sei diese sogar intensiver geworden, da der Austausch in einem privaten Rahmen erfolgt (im Realoffice können KollegInnen und Vorgesetzte mithören).
Die Geschäftsführerin gibt an, dass die Beziehungen zu ihren Mitarbeitenden nicht weniger intensiv geworden wären, da ein Austausch in einem hohen Maße telefonisch erfolgt. Ihr Personal würde über ihre Sorgen und Nöte berichten, was zumindest für ein gewisses Vertrauensverhältnis spricht (das sich wohl aus den privaten Beziehungen ergibt, weniger aus den beruflichen Beziehungen).
Wahrgenommene Arbeitsfähigkeit
Die technische Ausstattung ist insgesamt zufriedenstellend (trotz technischer Einschränkungen beim Mitarbeiter aus der Baubranche) und wurden den Befragten durch ihre Arbeitgeber gestellt.
Die Mitarbeiterin der Medienagentur verfügt über einen Arbeitslaptop, einen Monitor und ein Diensthandy. Durch die plötzliche Umstellung war zunächst eine Gewöhnung an die Nutzung technischer Tools nötig, sie und ihr Team haben sich mittlerweile aber mit den Tools vertraut gemacht. Hinsichtlich der Produktivität nennt sie zudem auch Vorteile der Homeoffice-Beschäftigung, die ihrer Arbeitsfähigkeit dienlich sind. So könne sie im Homeoffice ruhiger arbeiten und Aufgaben, die Ruhe und Konzentration erfordern, besser lösen. Im Realoffice (ein Großraumbüro) herrsche wiederum ein hoher Lärmpegel. Daher kann sie aufgrund gegebener Vor- und Nachteile nicht beurteilen, ob sie im Realoffice oder im Homeoffice produktiver ist. Manche Aufgaben kann sie u. a. mittels Brainstorming mit KollegInnen im Realoffice besser erledigen. Durch Teilzeit-Homeoffice könne sie passende Aufgaben jeweils im Homeoffice und im Realoffice erledigen, um ihre Produktivität steigern zu können.
Die Geschäftsführerin des Weiterbildungsinstituts empfindet ihre Arbeitsbedingungen als verbessert, seitdem ihr Sohn in die Kitanotbetreuung kann. Zudem sei ihre Arbeitsfähigkeit trotz gegebener Umstände insgesamt gegeben. Die technische Ausstattung ist aus ihrer Sicht, bis auf den fehlenden Serverzugang, ausreichend. Dass sie über ein eigenes Arbeitszimmer verfügt und in einem großen Haus lebt, kommt offenbar unterstützend hinzu.
4.1.7.3 Suchtmittelkonsum der Befragten
Konsum der Mitarbeiterin der Medienagentur
Zu Krisenbeginn bis zum zweiten von Bund und Ländern verordneten verschärften Lockdown konsumierte sie ihre Aussagen nach täglich ein Glas Wein oder Bier am Abend. Aktuell trinke sie allerdings keinen Alkohol. Ihrer Ansicht war ihr zeitweise höherer Konsum nicht problematisch.
Möglicher Konsumanlass
Zu Krisenbeginn verspürte sie noch eine geringere Belastung, da sie aufgrund des besseren Wetters weniger an die eigene Wohnung gebunden war. Daher ist die Belastung aktuell wesentlich stärker. Sie fühlt sich eingeengt und isoliert und es fehlt an sozialem Austausch, was den Alltag eintönig erscheinen lässt. Dadurch empfindet sie in ihrer Wohnung ein Gefühl der Einsamkeit. Hinzu kommt die hohe Arbeitsbelastung, wodurch die Arbeit ihren Alltag überwiegend bestimmt und der nötige Ausgleich fehlt.
Vieles spricht dafür, dass sie während ihres erhöhten Konsums ein Alpha-Typ (Konflikttrinkerin) war. Aufgrund der psychischen Belastung, in der die Arbeitsbedingungen im Homeoffice eine nennenswerte Rolle spielen, versuchte sie, diese mit hoher Wahrscheinlichkeit mithilfe von Alkohol zu kompensieren. Dass sie selbstständig mit dem Konsum aufhören konnte, spricht für eine psychische Abhängigkeit. Die Reduktion ihres Konsums hängt wahrscheinlich mit der Tatsache zusammen, dass sie mittlerweile mehr Zeit bei ihren Eltern verbringt und deren Arbeitszimmer nutzt, was ihr mehr sozialen Austausch ermöglicht und ihre Arbeitsbedingungen verbessert. Die Tatsache, dass sie allerdings CDB-Öl zum Stressabbau testen will, zeigt jedoch, dass sie durch ihre Arbeit immer noch unter Druck steht. Zwar bezeichnet sie ihren zeitweilig höheren Alkoholkonsum als nicht problematisch. Es ist aber nicht auszuschließen, dass das CDB-Öl eine Alternative zum Alkohol darstellt.
Konsum der Geschäftsführerin des Weiterbildungsinstituts
Sie nimmt täglich ein rezeptfreies Schlafmittel, das körperlich allerdings nicht abhängig macht.
Möglicher Konsumanlass
Ihre psychische Belastung ist zwar auch auf den Mangel an sozialen Kontakten, vor allem aber auf ihre Arbeitsbedingungen und ihr Arbeitspensum zurückzufüh- ( 42 ) ren. So spricht sie davon, insgesamt ca. 70 Stunden pro Woche (Wochenenden einbezogen) zu arbeiten und unter hohen Arbeitsdruck zu sehen. Das führt bei ihr zu Zwangsverhalten (sie kontrolliert ihr Handy zwanghaft nach E-Mails, die die Arbeit betreffen könnten), Schlafstörungen und folglich aufgrund ihrer Schlafstörungen zu verstärkten Nacken- und Schulterschmerzen, die sie bereits vor Corona-Krise hatte, die aber im Zuge der Corona-Krise stärker wurden. Hinzu kommt die Unfairness ihres Vorgesetzten und die Doppelbelastung durch ihren Sohn (trotz der Möglichkeit der Kitanotbetreuung).
Sie selbst bestätigt eine psychische Abhängigkeit. Sie sei sehr unruhig, wenn sie dieses Schlafmittel nicht zur Verfügung hätte. Aufgrund ihrer starken Schlafstörungen und der verstärkten Schulter- und Nackenschmerzen könne sie ohne dieses Schlafmittel nicht zur Ruhe kommen. Zusätzlich nimmt sie, wenn auch ein selten, ein pflanzliches Beruhigungsmittel, dass wohl nicht als Suchtmittel bezeichnet werden kann. Es bestätigt aber den von ihr beschriebenen psychischen Stress.
Konsum des Mitarbeiters aus der Baubranche
Zum Zeitpunkt der Befragung war er bis vor wenigen Tagen noch aktiver Raucher. Er spricht von einem Konsum von durchschnittlich fünf Zigaretten pro Tag.
Möglicher Konsumanlass
Nach eigener Aussage versuchte er mit seinem Tabakkonsum Stress zu kompensieren. Er ist zudem unsicher, ob er diese Abstinenz durchhalten kann. Dies spricht für eine körperliche sowie psychische Abhängigkeit.
Die psychische Abhängigkeit lässt sich aufgrund der von ihm beschriebene Belastung vermuten, die er in Bezug auf die Homeoffice-Beschäftigung in Verbindung mit seinem Vollzeitstudium beschreibt. Nach eigener Aussage beschränkt sich seiner Belastung nur auf seine Arbeits- und Studienbedingungen und war zeitweilig so hoch, dass er sein politisches Engagement einstellen musste. In diesem Zusammenhang spricht er von einem Nervenzusammenbruch, den er im Herbst 2020 als Folge zu hoher Arbeitsbelastung (Prüfungsdruck, viel Arbeit aufgrund des Quartalsendes, Wahlkampf im Zuge des politischen Engagements) erlitten habe. Dabei habe er zeitweilig bis zu 100 Stunden wöchentlich gearbeitet. In sonstigen Hochphasen (die 6 bis 7 Wochen andauern können) käme er mit Studium und seinem Teilzeitberuf auf ca. 70 Stunden. Vieles spricht also dafür, dass sein Ta-
bakkonsum auch zur Stresskompensation dient und er deshalb unsicher ist, ob er den Konsum langfristig abstellen kann.
4.1.8 Unternehmen mit überwiegend guten Homeoffice-Bedingungen
Bei vier der Befragten ließen sich nennenswerte Besonderheiten bzw. Unterschiede erkennen. Sie alle kommen aus unterschiedlichen Unternehmen. Ihre Home- office-Bedingungen sind, bis auf Ausnahmen in Bezug auf ihre Wohnbedingungen, als überwiegend positiv zu bewerten. Für die Übersichtlichkeit und die Anonymität der Befragten zu wahren, bekommen die Befragen Pseudonyme:
- Herr R.: Standortleiter bei einem Dienstleistungsunternehmen im Bereich Digi- talisierung
- Frau H.: Unternehmen aus dem Bereich Telekommunikation und Digitalisierung
- Frau L.: Dänischer Pumpenhersteller
- Herr G.: IT-Unternehmen
4.1.8.1 Belastungsfaktoren im Homeoffice
Reichhaltigkeit der Kommunikation
Abgesehen von Herrn R. und Frau L. glauben alle Befragten, dass die RemoteKommunikation auf niedrigerem Niveau sei als die Kommunikation im Realoffice. Sie beschreiben sie als weniger reichhaltig und somit auch als weniger effektiv sowie effizient. Dafür nennen sie folgende Gründe:
- Frau H. beschreibt den Umstand, dass selbst für kürzere Gespräche Termine vereinbart werden müssen, die teilweise erst einige Wochen später stattfinden können.
- Die Kommunikation wird laut Herrn G. auch dadurch erschwert, dass man sich in Videokonferenzen oft unterbricht.
Hinsichtlich der Remote-Kommunikation sehen Frau L. und Herr G. kein Verbesserungspotenzial. Die anderen Befragten geben hier folgende Impulse:
- Herr R. ist der Ansicht, dass die Internetleitungen bundesweit verbessert werden müssen, damit es weniger zu Leitungsüberlastungen kommt.
- Frau H. wünscht sich kürzere Antwortzeiten bei wichtigen Anfragen seitens ihrer KollegInnen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Intensität von Beziehungen
Beziehungen zu KollegInnen
Frau H. gibt an, dass die Remote-Kommunikation als unpersönlichere Kommunikationsform in ihrem Unternehmen eine Herausforderung darstelle, da dieses vom Netzwerken lebe. Herr G. wiederum beschreibt, dass er vor allem mit einem engeren Kreis von KollegInnen kommuniziere, wodurch er zu anderen KollegInnen nur sehr wenig Kontakt habe.
Fairness der Vorgesetzten
Hinsichtlich der Fairness der Vorgesetzten haben die Befragten wenig zu beanstanden. Herr R. merkt an, dass ein Ausgleich steigender Energiekosten aufgrund der Homeoffice-Beschäftigung angebracht wäre. Frau L. wiederum fand es unbefriedigend, im November trotz hoher Infektionszahlen teilweise im Realoffice arbeiten zu müssen. Sie habe ihre Bedenken gegenüber Vorgesetzten und auch dem Betriebsrat geäußert, was jedoch ignoriert wurde.
Wahrgenommene Arbeitsfähigkeit
Produktivität der Befragten
Herr R. gibt an, dass seine Produktivität aufgrund seiner Wohnsituation geringer wäre. Hinsichtlich der Produktivität im Homeoffice hat der Rest der Befragten ansonsten wenig Negatives zu sagen. Zwar beschreiben die meisten von ihnen einen höheren Arbeitsaufwand, die Produktivität nehmen sie aber als nicht eingeschränkt wahr.
Einfluss der Remote-Kommunikation auf die Arbeitsfähigkeit
Bezüglich des Einflusses der Remote-Kommunikation geben drei der Befragten folgende Herausforderungen an:
Tabelle 8: Einfluss der Remote-Kommunikation auf die Arbeitsfähigkeit bei vier Befragten der Gruppe „Unternehmen mit überwiegend guten Homeoffice-Bedingungen“
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4.1.8.2 Unterstützende Faktoren im Homeoffice
Reichhaltigkeit der Kommunikation
Frau L. und Herr R. beschreiben im Gegensatz zu den anderen Befragten eine Verbesserung der Kommunikation.
Tabelle 9: Reichhaltigkeit der Kommunikation bei zwei Befragten der Gruppe „Unternehmen mit überwiegend guten Homeoffice-Bedingungen“
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Auch Herr G. gibt an, dass Remote-Kommunikation in seinem Unternehmen bereits vor der Corona-Krise üblich war, da eine Zusammenarbeit mit KollegInnen aus Amerika erfolgt. Zudem war er vor der Corona-Krise jeden Freitag im Homeoffice, weswegen sein Team an die Remote-Kommunikation gewöhnt ist. Dementsprechend war keine große Umstellung zu Krisenbeginn erforderlich.
Intensität von Beziehungen
Beziehungen zu KollegInnen bzw. Mitarbeitenden
Die Mehrheit beschreibt ein gutes und familiäres Betriebsklima, indem eine gegenseitige Unterstützung erfolgt.
Tabelle 10: Intensität von Beziehungen von vier Befragten der Gruppe „Unternehmen mit überwiegend guten Homeoffice-Bedingungen“
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Beziehung zu Vorgesetzten, Fairness der Vorgesetzten
Bei allen Befragten lässt sich ein partizipativer Führungsstil ihrer Arbeitgeber ableiten. Zudem wurden bzw. werden die Befragten durch ihren Arbeitgeber technisch und hinsichtlich der Büroausstattung bestmöglich ausgestattet (bei Herrn R. mit Einschränkungen, was aber mit seiner wohnlichen Situation zusammenhängt), ohne das sie eigene Kosten tragen müssen. Manche der Befragten erhalten zudem regelmäßig Geschenke. Besonders Frau E. beschreibt ein sehr enges Verhältnis zu ihrem Vorgesetzten, da eine enge Zusammenarbeit erfolgt sowie ein regelmäßiger Austausch stattfindet.
Auch Frau L. hebt die Fairness ihrer Vorgesetzten besonders hervor:
- Sie spricht von einer guten Teamführung und einer guten Fehlerkultur. Es gibt regelmäßig Entwicklungsgespräche gemeinsam mit den Mitarbeitenden.
- Sie hegt den Wunsch, in eine Führungsposition aufzusteigen. Ihre Vorgesetzten unterstützen sie diesbezüglich aktiv und geben ihr dementsprechend Sonderaufgaben, wodurch sie sich motiviert fühlt.
- Ihr Arbeitgeber möchte Teilzeit-Homeoffice auch nach der Corona-Krise fest einführen. Sie empfindet dies als positiv aufgrund der Einsparung von Fahrzeit und Fahrtkosten.
Herr R. gibt an, dass sein Arbeitgeber mittlerweile vertragliche Regelungen festgelegt hat, die eine Homeoffice-Beschäftigung während der Corona-Krise regeln. In diesem Rahmen wurde vertraglich festgelegt, dass Mitarbeitende sich sämtliche technische Ausstattung auf Kosten des Arbeitgebers bestellen können. Auch Frau E. gab an, dass ihr Arbeitsvertrag gerade angepasst würde, dass es in Belgien (wo sie wohnhaft ist) ein gesetzliches Recht auf Homeoffice gäbe.
Arbeitsfähigkeit
Positiver Einfluss der Remote-Kommunikation auf die Arbeitsfähigkeit
Im Fall von Herrn G. und Frau L. wurde die Arbeitsfähigkeit dadurch gewährleistet, dass Remote-Kommunikation bereits vor der Corona-Krise üblich war, dass viele Abteilungen über weitere Entfernungen zusammenarbeiten. Zudem hatte Herr G. zuvor am Freitag einen festen Homeoffice-Tag, wodurch er und sein Team zusätzlich an diese Form der Kommunikation gewöhnt waren.
Im Fall von Frau L. und Herrn R. scheint diese die Arbeitsfähigkeit sogar wesentlich zu verbessern. Herr R. gibt hier folgende Vorteile an:
- Die Kommunikation ist nicht mehr ortsgebunden, was dezentrales Arbeiten in Form von Homeoffice wesentlich vereinfacht.
- Die Arbeitsfähigkeit wird mithilfe des unternehmenseigenen Videotools durch die Möglichkeit des Bildschirmteilens verbessert, durch das er seinen Mitarbeitenden seine Anforderungen veranschaulichen kann. Zudem können Dateien datenschutzsicher an Mitarbeitende und Kunden versendet werden.
- Kunden sind durch die zunehmende Digitalisierung im Rahmen der Corona- Krise aufgeschlossener für virtuelle Beratungen, da man ihnen ein datenschutzsicheres Tool anbietet.
Homeoffice-Ausstattung der Befragten
Alle Befragten gaben an, durch ihre Arbeitgeber technisch gut ausgestattet zu sein. Das hängt bei den Befragten Herrn R., Frau H. und Herrn G. vor allem mit den Branchen zusammen, in denen sie tätig sind (Telekommunikation, Digitalisierung, IT).
Produktivität im Homeoffice
Die Produktivität ist nur bei einem der Befragten (Herrn R.) durch das Homeoffice eingeschränkt. Manche geben sogar eine Verbesserung der Produktivität an. Als Gründe dafür werden mehr Ruhe, die Einsparung des Arbeitsweges und ein geringeres Maß an Ablenkungen genannt, die Realoffice mehr gegeben wären. Gerade die Aussage in Bezug auf Ablenkungen ist interessant, da Befragte aus anderen Gruppen angaben, durch Haushaltstätigkeiten und andere Faktoren in der eigenen Wohnung abgelenkt zu werden.
4.1.8.3 Suchtmittelkonsum der Befragten
Zwei der Befragten (Frau H. und Frau L.) geben an, dass sie zu Krisenbeginn mehr Alkohol konsumiert hätten. Dies ist vermutlich auf die Belastung zu Krisenbeginn zurückzuführen, die bei beiden zu Anfang höher war. Somit wären sie in diesem Zeitraum klassische Alpha-Typen (Konflikttrinkerinnen) gewesen, da sie ihren Alkoholkonsum selbstständig reduzieren konnten.
Das zeugt von einer zeitweilig psychischen Abhängigkeit, die mittlerweile wieder abgeklungen ist. Grund dafür werden die überwiegend guten Homeoffice- Bedingungen sein, die einen Ausgleich schaffen und mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Life-Balance-Maßnahmen ihrer Arbeitgeber zurückzuführen sind (z. B. Onlinesportkurse u. a. mit Pilates, Meditation, Yoga, regelmäßige Videoleitfäden, medizinischer und psychologischer Dienst). Frau L. betrachtet Homeoffice u. a. deshalb als psychische Stütze.
Bei zwei der Befragten gibt es hinsichtlich des Suchtmittelkonsums jedoch gewisse Auffälligkeiten.
Konsum von Herrn R.
Sein Konsum sei seit der Corona-Krise stark angestiegen. Er schätzt, ca. drei- bis viermal pro Woche Alkohol konsumiert zu haben. Den Konsum habe er deshalb eingeschränkt, weil er ihn als problematisch ansah.
Möglicher Konsumanlass
Er selbst glaubt, dass der hohe Konsum mit Stress und seiner psychischen Belastung zusammenhängt. Diese Aussage ist naheliegend. Seine schlechten Wohnbedingungen (er arbeitet in der Küche, muss morgens hinsichtlich der Lautstärke Rücksicht auf seine Nachbarn nehmen und seine Internetleitung ist oft überlastet) und sein hohes Arbeitspensum verdeutlichen, dass trotz der ansonsten guten Homeoffice-Bedingungen hinsichtlich guter Arbeitsfähigkeit, reichhaltiger Kommunikation und gute Beziehungen zu Mitarbeitenden, KollegInnen und Vorgesetzten ein hohes Maß an Einschränkungen vorliegen. Die allgemeine Pandemielage und das Arbeitspensum, auch unabhängig vom Homeoffice selbst, scheinen hier aber die wesentliche Ursache. Er spricht in diesem Zusammenhang, wie auch die Geschäftsführerin des Weiterbildungsinstituts, von Schlafstörungen. Als extrovertierten Menschen fehlt es ihm vor allem am sozialen Austausch.
Betrachtet man seine Belastung und die Tatsache, dass er seinen Konsum selbstständig einschränken konnte, ist in seinem Fall von einem Alpha-Typen (Konflikttrinker) auszugehen. Die Abhängigkeit scheint psychischer Natur zu sein. Er konsumierte Alkohol offenbar zur Kompensation von Stress, d. h. zur Entspannung und um besser zu schlafen.
Konsum von Herrn G.
Herr G. gibt an, ca. drei Mal die Woche Alkohol zu trinken. Als Anlass nennt er virtuelle Treffen mit FreundInnen und ArbeitskollegInnen in Videokonferenzen (außerhalb der Arbeitszeit). Er gibt an, dass sein Konsum zu Krisenbeginn höher war, er ihn allerdings wieder eingeschränkt habe. Seinen Konsum selbst beschreibt er als zu hoch. Während des Interviews entstand jedoch nicht der Eindruck, als betrachte er die Lage selbst als sehr ernst. Vielmehr äußerte er dies mit einer gewissen Heiterkeit.
Möglicher Konsumanlass
Herr G. spricht von einer eher geringen Belastung. Das begründet er mit seiner Introvertiertheit, weswegen er soziale Kontakte nicht zwingend brauche und sie auch auf virtuellem Wege pflegen könnte. Ihn stört lediglich, dass er Freunde und Verwandte aufgrund der Kontaktbeschränkungen nicht sorgenfrei besuchen kann. Ebenso fehlen ihm die Arbeitsreisen, die im Zuge der Corona-Krise nicht mehr möglich sind und durch die er KollegInnen in Amerika besuchen konnte. Die Homeoffice-Situation selbst sieht er aber nicht als Belastung, eher als Entlastung. Die flexiblen Arbeitszeiten und die Arbeitszeit auf Vertrauensbasis ermöglichen ihm viele Freiheiten, wodurch er seinen Alltag flexibel gestalten kann. Daher empfindet er die Vermischung von Berufs- und Privatleben als bereichernd.
Herr G. scheint daher ein Beta-Typ (Gewohnheitstrinker) zu sein. Er trinkt zu besonderen Anlässen, d. h. mit ArbeitskollegInnen und FreundInnen, und scheint darin kein großes Problem zu sehen. Die Corona-Krise und die Homeoffice- Beschäftigung selbst scheinen für ihn keine wesentliche Belastung zu sein.
4.2 Handlungsempfehlungen
4.2.1 BGM und betriebliche Suchtprävention aktiv betreiben
Ein Faktor, der negativ auffiel, war die geringe Maßnahmenergreifung vieler Arbeitgebender hinsichtlich des BGM, ganz besonders in Bezug auf die betriebliche Suchtprävention. Nur zwei der Befragten nennen Maßnahmen, die ihre Arbeitgebenden hinsichtlich der Suchtprävention betreiben. Der Rest gibt an, dass sie nicht betrieben würde bzw. sie nichts davon wissen.
4.2.1.1 Suchtprävention: Kategorisierung nach Zielgröße und Zeitpunkt
Die Gestaltung der Homeoffice-Beschäftigung hat wesentlichen Einfluss auf die Life-Balance und somit auch auf die mentale Gesundheit des Personals, die wiederum das Suchtrisiko beeinflussen. Viele Arbeitgebende scheinen die Voraussetzungen für gute Homeoffice-Bedingungen, u. a. jene, die Lindner (2020) als Voraussetzungen nennt, nicht zu erfüllen. Daher werden im Sinne der Verhältnis- und der Verhaltensprävention, aber auch der Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention folgende Maßnahmen empfohlen:
Wahrgenommene Unterstützung und Fairness der Arbeitgebenden bei den Mitarbeitenden im Homeoffice sicherstellen
Flexible Arbeitszeiten, auch hinsichtlich der Pauseneinteilung, geben den Mitarbeitenden im Homeoffice die Möglichkeit, ihren Alltag flexibel zu gestalten. Die Motivation des Personals wird allerdings nur dann gewährleistet, wenn Fairness und Unterstützung der Vorgesetzten sowie konsequentes Teambuilding als Voraussetzungen gegeben sind. Ohne soziale Interaktion und Handlungssicherheit fühlen sich Mitarbeitende alleingelassen und können emotional vereinsamen, während sie sich bei einem autoritären Führungsstil und festen Arbeitszeiten in ihrer Freiheit beschränkt fühlen. Es darf somit weder eines Laissez-fair-Stils noch ein autoritärer Führungsstil vorliegen. Beides kann die mentale Gesundheit negativ beeinträchtigen und folglich das Suchtrisiko erhöhen.
Demzufolge sollten nicht nur die Engergebnisse geprüft werden, die Mitarbeitenden im Homeoffice liefern, sondern auch mittels deutlich kommunizierter und verständlicher Beurteilungskriterien und Zielvorgaben aktive Hilfestellung gegeben werden. Dies bedarf einer reichhaltigen Remote-Kommunikation, die eine Nutzung kollaborativer Arbeitswerkzeuge voraussetzt und somit einen schnellen Austausch per Direktnachricht, den Zugriff einen Cloudspeicher (in dem u. a. Zielvorgaben und Beurteilungskriterien hinterlegt werden können) und regelmäßige Teammeetings per Videokonferenz ermöglicht.
Homeoffice-Personal sollte aus ökonomischem und sozialem Interesse mit dem nötigen Equipment versorgt werden, um die Produktivität und die folglich vom Personal wahrgenommene Arbeitsfähigkeit auf möglichst hohem Niveau zu halten. Ansonsten besteht das Risiko, dass Mitarbeitende im Homeoffice sich mittels privater Investitionen ausrüsten und dies als Unfairness und mangelnde Unterstützung wahrnehmen. Dies belastet folglich die Beziehung zwischen Arbeitgebenden und Mitarbeitenden im Homeoffice, was wiederum das Risiko einer mentalen Belastung mit sich trägt und das Suchtrisiko erhöhen kann.
Vertragliche Regelungen bzw. Betriebsverordnungen, die eine Homeoffice- Beschäftigung in Krisenzeiten klar regeln, erscheinen sinnvoll. Rechte und Ansprüche der ArbeitnehmerInnen können schriftlich und transparent festgehalten werden und geben den Mitarbeitenden Sicherheit, wenn z. B. die Zurverfügungstellung von Homeoffice-Ausstattung, flexiblere Arbeitszeiten, auch z. B. auch Hilfe- leistungen (z. B. medizinische, psychologische und suchtpräventive Unterstützung) klar geregelt sind.
Effektives Teambuilding
Teambuilding im Homeoffice wird durch wahrgenommene Fairness und Unterstützung durch Vorgesetzte sowie durch reichhaltige Remote-Kommunikation maßgeblich beeinflusst. Diese Voraussetzungen müssen seitens der Arbeitgebenden geschaffen werden, um Bindungen unter den Mitarbeitenden und zwischen Mitarbeitenden und Vorgesetzten sicherzustellen. Kollaborative Arbeitswerkzeuge sind hier ein wichtiger Schlüssel. Die Kommunikation per E-Mail, Telefon und Direktnachricht genügen nicht, um ein gutes Teambuilding zu erreichen. Besonders die schriftliche Kommunikation birgt das Risiko, dass unpräzise kommuniziert wird und Missverständnisse aufgrund fehlender nonverbaler Kommunikation entstehen, die auch zu Konflikten führen kann. Zudem ist sie eher formeller Natur und erschwert soziale Interaktion unter den Mitarbeitenden.
Regelmäßige Teammeetings per Videokonferenz in kurzen Abständen sind daher wichtig, um eine persönlichere und reichhaltigere Form der Kommunikation zu gewährleisten. Allerdings ist diese Kommunikation nur dann reichhaltig, wenn Teammitglieder sich auch effektiv und auch informell miteinander austauschen können. Dies setzt voraus, dass Arbeitgebenden ihre Organisationsstrukturen entsprechend anpassen. Es braucht kleinere Teams, die eine reichhaltige Kommunikation unter den Teammitgliedern ermöglicht. Bei großen Videokonferenzen mit einer Vielzahl an TeilnehmerInnen ist ein interaktiver Austausch nicht möglich, wodurch auch Kreativität und Produktivität eingeschränkt werden. Das liegt u. a. daran, dass Videokonferenzen mit zu vielen TeilnehmerInnen sehr zeitintensiv sind und sich zwangsweise auf die formelle Kommunikation beschränken müssen, was für TeilnehmerInnen eine mentale sowie physische Anstrengung mit sich trägt. Folglich wird auch Suchtrisiko erhöht.
Führungskräfte im Bereich BGM und betrieblicher Suchtprävention schulen Führungskräfte müssen gesundheitsschädigendes Verhalten und Suchtsymptome bei Mitarbeitenden erkennen und Verhältnisse schaffen können, die der Gesundheitsförderung und der Suchtprävention dienlich sind. Dabei bedarf es umfangreicher Schulungen und Maßnahmen zur Umsetzung von BGM, die durch Zusam- menarbeit Krankenkassen oder anderen externe Anbieter ermöglicht werden können.
Umweltfaktoren der Makroumwelt beachten und nicht nur auf die unternehmens- bzw. organisationsinternen Rahmenbedingungen fokussieren
In Bezug auf Freiheiten und flexiblere Arbeitszeiten sollten auch die individuellen Lebenssituationen der Mitarbeitenden in Krisenzeiten bedacht werden. Ein Teil hat eine Doppelbelastung aufgrund ihrer Kinder, die zu Krisenzeiten im Homeschooling sind oder nicht bzw. begrenzt in die Kitas können. Ein weiterer Teil zwar in Teilzeit, sind deswegen aber nicht zwingend weniger belastet. Das sollte besonders hinsichtlich studentischer Mitarbeitenden bedacht werden. Der Fall des befragten Mitarbeiters aus der Baubranche beschreibt diesen Umstand besonders eingehend. Andere sind wiederum allein lebend und brauchen ein höheres Maß an sozialer Interaktion, weswegen eine reichhaltige Remote-Kommunikation besonders wichtig ist. Es erfordert somit einen partizipativen Führungsstil, der Mitarbeitenden die nötige Freiheit zur Entfaltung gibt und ihnen ermöglicht, ihre Aufgaben im Einklang mit ihrem Privatleben erfüllen zu können.
Auch wenn die Homeoffice-Bedingungen als zufriedenstellend wahrgenommen werden können äußere Faktoren, die sich aus der Corona-Krise ergeben, dennoch die mentale Belastung und folglich die Suchtgefährdung erhöhen. Ein Beispiel dafür sind die Kontaktbeschränkungen, die sich aus den aktuellen Infektionsschutzmaßnahmen von Bund und Ländern ergeben und dazu führen, das soziale Interaktion nur begrenzt möglich ist.
Daher erscheint es z. B. im Rahmen einer SWOT-Analyse als sinnvoll, Risiken und Chancen, die sich aus der Makroumwelt eines Unternehmens bzw. einer Organisation ergeben, sowie wie unternehmens- bzw. organisationsinterne Schwächen und Stärken herauszuarbeiten, die hinsichtlich erkannter Risiken und Chancen relevant sind. Die Makroumwelt kann mittels einer PESTEL-Analyse herausgearbeitet werden, die politische, ökonomische, soziale, technologische, ökologische und rechtliche Faktoren analysiert und aufzeigt.
Onlinesportkurse und andere Trainingsmethoden, die der Gesundheitsförderung dienen
Es empfehlen sich u. a. jene Life-Balance-Maßnahmen im Sinne des BGM, die von manchen Arbeitgebenden der Befragten ergriffen werden. In Krisenzeiten soll- ten Onlineangebote geschaffen werden, die eine Life-Balance bzw. die mentale und physische Gesundheit der Mitarbeitenden fördert und z. B. auch der Burnout- Vorbeugung dienen. Burnouts können zu Schlafstörungen und langfristig auch zu Depressionen führen, was das Suchtrisiko signifikant erhöhen kann.
Sportkurse und Gesundheitstrainings können mittels Videokonferenzen abgehalten werden und ermöglichen ein gewisses Maß an Ausgleich und sozialer Nähe. Neben gesundheitsfördernden Übungen kann dies den Zusammenhalt unter Mitarbeitenden aufgrund gemeinsamer Aktivitäten fördern. Zudem können Achtsamkeitsübungen Mitarbeitenden im Homeoffice helfen, ihre eigene mentale Gesundheit zu fördern.
Schulungen zur Gesundheitsförderung können Mitarbeitende hinsichtlich ihres eigenen Verhaltens sensibilisieren und entsprechende Hilfsangebote aufzeigen, um bei psychischen Belastungen und Suchtproblemen Hilfe zu suchen oder auch Anzeichen von psychischen Belastungen und Suchtsymptome bei sich selbst und anderen zu erkennen. Das bedeutet, Mitarbeitenden kann gezeigt werden, wie und warum sie sich bei akuten Belastungen und Suchtproblemen Hilfe suchen sollten und wie sie bei ArbeitskollegInnen erkennen können, ob psychische Belastungen und ggf. auch Suchtprobleme vorliegen.
Dies setzt allerdings voraus, dass eine entsprechende Unternehmens- bzw. Organisationskultur vorherrscht, die eine Sorge vor möglichen Sanktionen mindert oder diese bestenfalls ausschließt. Ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit, dass Mitarbeitende sich aktiv Hilfe suchen oder z. B. mögliche Belastungen und Suchtprobleme von ArbeitskollegInnen melden (Loyalitätskonflikt), eher gering. Es braucht daher einen Wechsel von einer Sanktionskultur zu einer Präventionskultur, die Suchtkonsum nicht verurteilt, sondern als zu lösendes Problem anerkennt und Mitarbeitende entsprechend unterstützt.
Hilfsangebote zur Verfügung stellen und diese regelmäßig kommunizieren
Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass Mitarbeitende anonym und unkompliziert auf diese zugreifen können (z. B. durch ein Intranet). Ebenso wichtig ist hier die zuvor beschriebene Präventionskultur.
Das Angebot von regelmäßigen psychologischen Sprechstunden
Diese sollten bestenfalls per Videokonferenz und stets im Zweiergespräch stattfinden. Es ist im Rahmen der Remote-Kommunikation erforderlich, eine möglichst persönliche Gesprächssituation zu schaffen. Sollte die Pandemielage Präsenzsitzungen unter Hygienemaßnahmen zulassen, ist es zu empfehlen diese auch anzubieten.
Vorgesetzte müssen sich regelmäßig über das Befinden ihrer Mitarbeitenden informieren
Dies bedeutet, Bedürfnisse abzufragen und die Bereitschaft, diese zu akzeptieren und zu berücksichtigen, zu signalisieren und in den eigenen Handlungen auch widerzuspiegeln und Mitarbeitende regelmäßig hinsichtlich eines gesundheitsfördernden Verhaltens zu sensibilisieren. Gesundheitsförderndes Verhalten bedeutet u. a., Pausen zu machen, psychologische Sprechstunden anzunehmen, an Schulungen zur Gesundheitsförderung teilzunehmen usw. Eine gute Gelegenheit hierzu sind regelmäßige Entwicklungs- bzw. Feedbackgespräche der Mitarbeitenden, in denen Vorgesetzte in einem Zweiergespräch mit Mitarbeitenden sprechen können. Ebenso sollten solche Appelle auch in regelmäßigen virtuellen Teammeetings erfolgen. Dies setzt wiederum eine reichhaltige Kommunikation sowie die wahrgenommene Fairness und Unterstützung der Arbeitgebenden voraus, die bereits beschrieben wurden.
Bei der Kategorisierung der Suchtprävention nach Zeitpunkt stellt die Distanz zum eigenen Homeoffice-Personal eine Herausforderung dar. Schädigendes Verhalten, Suchtsymptome oder auch Suchterkrankungen sind im Rahmen der RemoteKommunikation schwerer zu erkennen. Darum ist es auch im Sinne der Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention, die Hoppenstedt beschreibt, um so wichtiger eine möglichst reichhaltige Kommunikation mittels Videokonferenzen so aufrecht wie möglich zu erhalten.
Ebenso sollte ein medizinischer und psychologischer Dienst für das Personal verpflichtende Präsenzsitzungen abhalten (sofern die Pandemielage dies zulässt, ansonsten mindestens per Videokonferenz), um Anzeichen einer Sucht oder schädigendes Verhalten erkennen zu können.
4.2.1.2 Dienstleistungen von Krankenkassen in Anspruch nehmen
Krankenkassen bieten umfassende Unterstützung in Planung und Umsetzung von BGM an, die Arbeitgebende nutzen sollten. Dazu können u. a. folgende Leistungen gehören:
- Bedarfsermittlung durch Arbeitsunfähigkeits-, Arbeitssituations- und Altersstrukturanalysen, Befragung von Mitarbeitenden, Durchführung von Workshops etc.
- Beratung hinsichtlich der Gestaltung gesundheitsförderlicher Arbeitsbedingungen.
- Beratung hinsichtlich Ziel- und Konzeptentwicklung und Unterstützungsmöglichkeiten zur Schaffung einer Life-Balance.
- Unterstützung beim Aufbau eines Projektmanagements, dass BGM- Maßnahmen erarbeiten soll.
- Moderation von Arbeitsgruppen, Gesundheitszirkeln.
- Umsetzung verhaltenspräventiver Maßnahmen.
- Dokumentation, Evaluation und Qualitätssicherung des BGM (vgl. GKV2021).
4.2.2 Maßnahmenempfehlungen im Öffentlichen Dienst
Der Öffentliche Dienst schneidet im Vergleich zu privaten Wirtschaftssektor hinsichtlich des Digitalisierungsgrads und der Ausstattung von Mitarbeitenden im Homeoffice wesentlich schlechter ab. Alle Befragten des Öffentlichen Dienstes vermissen mangelnde Unterstützung hinsichtlich technischer Ausstattung. Zudem gibt es nur bei einer der Befragten einen Sozialdienst, der bei psychischen Problemen sowie Suchtproblemen Hilfe anbietet (allerdings nur telefonisch).
Die Ursache scheint aber nicht zwingend bzw. nicht ausschließlich in der allgemein fehlenden Unterstützung und Fairness durch Vorgesetzte im Öffentlichen Dienst zu liegen. Vielmehr liegt es mit hoher Wahrscheinlichkeit an einer Unterfinanzierung des Öffentlichen Dienstes.
Somit braucht es politische Maßnahmen, die eine bessere Finanzierung des Öffentliches Dienstes ermöglicht. Ebenso sollte die Digitalisierung im Öffentlichen Dienst, auch in Deutschland insgesamt (z. B. hinsichtlich besserer Internetleitungen), besser vorangebracht werden, damit z. B. an Universitäten wissenschaftliche Arbeit ohne Einschränkungen möglich ist. Öffentliche Universitäten und Hochschulen müssen die Finanzkraft besitzen, ihr Personal vollständig ausrüsten zu können, ohne dabei die im Fokus stehende Forschung aufgrund fehlender Finan (57 ) zen zu beeinträchtigen. Ebenso braucht es eine stärkere Finanzkraft, um die zuvor beschriebenen Maßnahmen zur Suchtprävention entsprechend durchführen zu können.
5 Diskussion
5.1 Eigene Beiträge
5.1.1 Ergebnisse - Ein Auszug
Bei der Analyse stellte sich heraus, dass die drei untersuchten Variablen hinsichtlich des Einflusses auf den Suchtmittelkonsum nicht isoliert voneinander zu betrachten sind. Vielmehr beeinflussen sie sich gegenseitig.
Tabelle 11: Einfluss der Remote-Kommunikation auf das Teambuilding und die wahrgenommene Arbeitsfähigkeit
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Diese Wechselwirkungen der Variablen beeinflussen wiederum die mentale Verfassung von Mitarbeitenden im Homeoffice und beeinflussen das Suchtrisiko. Es handelt sich um interne Faktoren, die Arbeitgebende beeinflussen können.
Allerdings spielen nicht nur interne Faktoren, sondern auch äußere Faktoren der Makroumwelt eine wesentliche Rolle. Denn auch durch diese sind Mitarbeitende im Homeoffice stärker an ihre eigene Wohnung gebunden, während Homeoffice diese Isolation wiederum verstärken und folglich das Suchtrisiko erhöhen kann. Für manche der Befragten wiederum war Homeoffice aufgrund guter Bedingungen sogar eine mentale Entlastung, die das Suchtrisiko senken kann. Darum ist u. a. eine Flexibilisierung der Arbeitszeit, ein gutes BGM (auch hinsichtlich betrieblicher Suchtprävention) sowie ein Sicherheitsgefühl seitens der Mitarbeitenden notwendig, das u. a. durch eine gute Homeoffice-Ausstattung und vertragliche Regelungen (die ihre Homeoffice-Beschäftigung während der Corona-Krise regeln) begünstigt werden kann. Arbeitgebende müssen somit die Chancen und Risiken ihrer Makroumwelt beachten und aus ihren vorhandenen Stärken und Schwächen Maßnahmen hinsichtlich des BGM und der betrieblichen Suchtprävention ableiten.
5.1.2 Neue Erkenntnisse
Neu ist, dass diese Arbeit einen Zusammenhang zwischen Homeoffice- Bedingungen in Zeiten der Corona-Krise, äußeren Einflussfaktoren der Corona- Krise und dem Suchtmittelkonsum von Mitarbeitende im Homeoffice herstellt, um in solchen Krisenzeiten ein BGM und vor allem eine betriebliche Suchtprävention trotz gegebener Distanz zwischen Arbeitgebenden und Mitarbeitenden im Homeoffice möglich zu machen. Angesichts steigender mentaler Belastungen und steigender Suchtgefährdung in Krisenzeiten erscheint dies als wichtiger Beitrag in der arbeits- und organisationspsychologischen Forschung. Die erarbeiteten Maßnahmenempfehlungen, die aus den Ergebnissen der Analyse erarbeitet wurden, bieten einen Ansatz dafür, wie BGM trotz gegebener Distanz zu den eigenen Mitarbeitenden im Homeoffice gelingen kann.
5.1.3 Belastbarkeit und Anwendung der Ergebnisse
Im Sinne der Intersubjektivität konnten Gemeinsamkeiten hinsichtlich der Reichhaltigkeit der Kommunikation, Intensität von Beziehungen unter Mitarbeitenden sowie zwischen Personal und Vorgesetzten sowie der wahrgenommenen Arbeitsfähigkeit ermittelt werden. Ebenso wurden Unterschiede und Besonderheiten hervorgehoben, die sich aus dem beschriebenen Verhalten der Arbeitgebenden sowie die Situationen einzelner Befragter ergeben. Diese Gemeinsamkeiten und Besonderheiten wurden hinsichtlich des Einflusses auf die mentale Verfassung der Befragten untersucht, die wiederum auf das Suchtrisiko der Befragten schließen lassen. Folglich wurde aus den Ergebnissen Maßnahmenempfehlungen hinsichtlich der betrieblichen Suchtprävention abgeleitet.
Es handelt sich allerdings um eine kleine Stichprobe. Dabei sind die gegebenen Gemeinsamkeiten belastbarer als die Besonderheiten und Unterschiede, die sich ergaben, auch wenn diese plausibel erscheinen. Daher ist es möglich, dass bei Betrachtung der Situationen einzelner Befragter andere Schlüsse hinsichtlich ihres Suchtmittelkonsums gezogen werden können. Die dargestellten Schlussfolgerungen stellen lediglich die Einschätzungen des Verfassers der Arbeit dar.
Des Weiteren ist zu erwähnen, dass wahrscheinlich nicht alle Maßnahmenempfehlungen von kleinen und mittleren Unternehmen angewendet werden können, da sie mit hohen Kosten verbunden sind. Allerdings haben besondere kleine Unternehmen den Vorteil, in kleineren Teams zu arbeiten und folglich eine engere Teambildung erreichen zu können. Für Großunternehmen stellt dies eine wesentlich größere Herausforderung dar.
5.2 Grenzen der Arbeit
Der Einfluss auf den Suchmittelkonsum durch die Reichhaltigkeit der Kommunikation, der Intensität von Beziehungen und der wahrgenommenen Arbeitsfähigkeit konnte zwar plausibel eingeschätzt, aber nicht bewiesen werden. Dazu bedarf es weiter Forschungsinstrumente, die nicht zur Verfügung standen. Die Belastbarkeit der Ergebnisse muss, besonders hinsichtlich der hervorgehobenen Besonderheiten, im Rahmen quantitativer Forschung oder ggf. auch weiterer qualitativer Forschung (z.B. Experteninterviews) erneut ermittelt und abgeglichen werden. Im Rahmen quantitativer Forschung, die die dargestellten Einflüsse auf die mentale Verfassung sowie den Suchtmittelkonsum untersuchen, sollten die herausgearbeiteten Gemeinsamkeiten und Besonderheiten untersucht und somit geprüft werden, ob die Ergebnisse dieser Arbeit auf eine repräsentative Anzahl von Mitarbeitenden im Homeoffice zutreffen.
Zudem war es nicht möglich, verschiedene Einschätzungsmöglichkeiten hinsichtlich des Suchtmittelkonsums darzustellen, da dies den Rahmen der Arbeit (aufgrund der begrenzten Wortzahl) überschritten hätte. Somit können die Ergebnisse dieser Arbeit nicht auf die Allgemeinheit geschlossen werden. Aufgrund ihrer Plausibilität wurden dennoch auch anhand gegebener Besonderheiten Maßnahmenempfehlungen abgeleitet.
Des Weiteren fehlte es an umfangreicher Literatur, die sich mit der Thematik dieser Arbeit befasst. Dies liegt wohl dem Umstand zugrunde, das erst nach Krisenbeginn im März 2020 Forschung betrieben wurde, die sich jeweils auf den Suchtmittelkonsum im Rahmen der Corona-Krise und der Homeoffice-Beschäftigung während der Corona-Krise beschäftigen. Literatur, die hier einen Zusammenhang herstellt, war nicht verfügbar. Daher musste u. a. auf Presseberichte zurückgegriffen werden, die sich mit den Thematiken befassen. Ebenso war die Verfügbarkeit von Sekundärliteratur im Rahmen der Coronapandemie erschwert und war in vielen Bibliotheken (die teilweise auch geschlossen waren) nicht verfügbar. Daher wurde notwendige Literatur auch durch eigene Finanzen erworben, während diese finanziellen Mittel allerdings begrenzt waren.
Eine weitere Herausforderung bestand in der ausführlicheren Beschreibung der Methodik, die sich auf der begrenzten Wortanzahl (15.000 Wörter +/- 10 Prozent) ergab. Eine tiefergehende Beschreibung der Methodik hätte der Ergebnisdarstellung inhaltlich geschadet. Folglich wurden Empirie und Interviewdurchführung im Anhang möglichst übersichtlich und nachvollziehbar dargestellt.
5.3 Anschlussmöglichkeiten für Folgearbeiten
Ziel der vorliegenden Arbeit war es, mittels qualitativer Forschung Ergebnisse zu erarbeiten, die durch quantitative Forschungsmethodik, d. h. repräsentativer Studien und Befragungen, überprüft werden können. Diese Arbeit stellt somit einen ersten Schritt dar, um den Einfluss von Faktoren der Corona-Krise auf den Suchtmittelkonsum zu Mitarbeitende im Homeoffice zu prüfen. Durch weitergehende quantitative Forschung, die auf den Ergebnissen dieser Arbeit beruht, können Ergebnisse erarbeitet werden, die die klassischen Gütekriterien Objektivität, Validität, Reliabilität und Repräsentativität erfüllen. Dabei sollte auch geprüft werden, inwiefern sich der Suchtmittelkonsum in Bezug auf das Geschlecht auswirkt. In den Interviews, die im Rahmen dieser Arbeit geführt wurden, fiel auf, dass die befragten Männer mehr Alkohol konsumierten als die weiblichen Befragten.
6 Schlussfolgerung
6.1 Einschätzung der aktuellen Situation
Es scheint, dass viele Arbeitgebende hinsichtlich der Schaffung guter Homeoffice- Bedingungen und in Bezug auf die betriebliche Suchtprävention starken Nachholbedarf haben. Arbeitgebende scheinen die sozialen wie auch die ökonomischen Auswirkungen einer unzureichenden betrieblichen Suchtprävention zu unterschätzen. Ebenso ist es möglich, dass vor allem Kleinbetriebe und mittlere Unternehmen ein umfassendes BGM nicht im ausreichenden Maße leisten können. Gleiches scheint für den Öffentlichen Dienst zuzutreffen, wofür es auch einer politischen Lösung bedarf.
Äußere Belastungsfaktoren, die sich aus der Corona-Krise ergeben, erzeugen in der Bevölkerung u. a. Zukunftsängste, Belastungen aufgrund eines Mangels an sozialen Austauschs und Sorgen hinsichtlich der eigenen Gesundheit bezüglich eines Infektionsrisikos. Daher sind gute Homeoffice-Bedingungen im Sinne der Verhältnisprävention von hoher Relevanz und können von Arbeitgebenden auch entsprechend beeinflusst werden. Eine gute Verhältnisprävention bspw. sorgt dafür, dass Mitarbeitende durch Homeoffice eine mentale Entlastung und eine bessere Life-Balance in Krisenzeiten erfahren, die wiederum das Suchtrisiko senken.
Auch wenn BGM aufgrund der gegebenen Distanz zwischen Arbeitgebenden und Mitarbeitende im Homeoffice erschwert wird und mit Kosten verbunden ist, darf dieses nicht vernachlässigt werden. Kosten aufgrund höherer Fehlzeiten, geringerer Arbeitsleistung und folglich geringerer Produktivität und Qualität der Arbeitsleistung sind i. d. R. höher als die Investition in Maßnahmen, die dies verhindern. Mentale Belastungen, die zu Burnouts und in Härtefällen auch zu psychischen Krankheiten wie Depressionen führen können, erhöhen die Suchtgefährdung des eigenen Personals (besonders in Krisenzeiten) und führen zu einer stärkeren ökonomischen Belastung in Pandemiezeiten, die für viele Arbeitgebende aufgrund gegebener Einschränkungen bereits ökonomische Folgen mit sich tragen. Zusätzliche ökonomische Belastungen sollten daher durch gutes und konsequentes BGM vermieden werden.
6.2 Beantwortung der Forschungsfragen
Frage 1
Inwiefern beeinflusst die wahrgenommene Reichhaltigkeit der Kommunikation im Homeoffice den Konsum von Suchtmitteln?
Die Reichhaltigkeit der Kommunikation beeinflusst die Arbeitsfähigkeit und die Intensität von Beziehungen maßgeblich. Mit Kommunikation ist wiederum sozialer Austausch verbunden, der Beziehungen unter Mitarbeitenden und zwischen Mitarbeitenden und Vorgesetzten stärken oder (sofern sie nicht reichhaltig ist) schwächen kann. Allerdings kann die Reichhaltigkeit der Remote-Kommunikation auf Grenzen stoßen. Sie ist lediglich in einem engeren Kreis von kommunizierenden Individuen erreichbar, während die Kommunikation zu vielen KollegInnen aufgrund des Zeitaufwands auf niedrigerem Niveau ist.
Gleichzeitig hat die Reichhaltigkeit der Kommunikation einen starken Einfluss auf die wahrgenommene Arbeitsfähigkeit. Sie hat somit keinen direkten Einfluss auf die Suchtgefährdung selbst, kann aber Beziehungen und die wahrgenommene Arbeitsfähigkeit je nach Reichhaltigkeitsgrad positiv oder negativ beeinflussen.
Frage 2
Inwiefern beeinflusst die wahrgenommene Intensität von Beziehungen der Mitarbeitenden im Homeoffice zu KollegInnen und Führungskräften den Konsum von Suchtmitteln?
Hier sind zwei Aspekte hervorzuheben:
- Je reichhaltiger die Kommunikation, desto enger sind auch die Bindungen untereinander, sofern diese sich nicht nur auf rein formelle Kommunikation beschränkt, sondern auch von persönlicherer Natur ist.
- Je besser die Fairness und die Unterstützung durch Vorgesetzte wahrgenommen werden, desto enger sind auch die Beziehungen zwischen Mitarbeitenden und Vorgesetzten.
- Sind beide Faktoren gegeben, wird dadurch wiederum das Teambuilding erleichtert, was die auch die wahrgenommene Arbeitsfähigkeit erhöht.
Die informellere Form der Kommunikation, die sich auch auf Arbeitsprozesse beziehen kann, aber eine persönlichere Form der Kommunikation und somit sozialen Austausch ermöglicht, darf nicht zu kurz kommen. Ansonsten besteht das Risiko, (64 ) dass Bindungen zwischen Mitarbeitenden sowie zwischen Mitarbeitenden und Vorgesetzten im Rahmen der Remote-Kommunikation, die ein hohes Maß an sozialer Distanz begünstigt, schwächer werden. Diese Bindungsschwächung erschwert wiederum das Teambuilding. Die daraus folgende Kombination aus mangelnder Arbeitsfähigkeit und fehlender sozialer Nähe kann zu einer verstärkten mentalen Belastung führen, die das Suchtrisiko erhöhen kann.
Allerdings können die Beziehungen zu KollegInnen aus einem kleineren Kreis, von dem zuvor in Bezug auf die Remote-Kommunikation gesprochen wurde, auch enger werden, da in einem privateren Rahmen gesprochen werden kann. Dies wiederum kann das Suchtrisiko potenziell senken, da soziale Nähe und wahrgenommene Arbeitsfähigkeit auf höherem Niveau sind.
Ist die Fairness und die wahrgenommene Unterstützung durch Vorgesetzte auf einem geringen Niveau, wirkt sich dies negativ auf die Beziehungen zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitenden, das Teambuilding und folglich auf die LifeBalance sowie die Arbeitsfähigkeit von Mitarbeitenden im Homeoffice aus. Durch mangelnde Führung (Laissez-faire-Stil) fehlen den Mitarbeitenden klare Zielvorgaben und transparente Beurteilungskriterien, während bei einem zu autoritären Führungsstil die Freiheiten der Mitarbeitenden (und folglich auch deren Kreativität und wahrgenommene Arbeitsfähigkeit) eingeschränkt werden. Die sich dadurch ergebene mentale Belastung kann das Suchtrisiko erhöhen, da Handlungen von Vorgesetzten als unfair und demotivierend empfunden werden.
Frage 3
Inwiefern beeinflusst die wahrgenommene Arbeitsfähigkeit im Homeoffice den Konsum von Suchtmitteln?
Die Remote-Kommunikation scheint die wahrgenommene Arbeitsfähigkeit nachhaltig zu beeinflussen. Sie ist zeitaufwendiger und verzögert bei geringer Reichhaltigkeit Arbeitsprozesse, da der Austausch mit KollegInnen und Vorgesetzten auf niedrigerem Niveau ist. Ist die Remote-Kommunikation wiederum sehr reichhaltig, erhöht dies die wahrgenommene Arbeitsfähigkeit, da Beurteilungskriterien und Zielvorgaben besser kommuniziert werden können. Dies gibt Mitarbeitenden wiederum ein Sicherheitsgefühl und mindert die Angst, Fehler zu machen, was sich positiv auf die mentale Verfassung auswirkt. Folglich ist die mentale Belas- tung bei einer nicht reichhaltigen Remote-Kommunikation höher, was die Suchtgefährdung von Mitarbeitenden im Homeoffice erhöht.
Die wahrgenommene Arbeitsfähigkeit wird zudem durch die gegebenen Wohnbedingungen und die Homeoffice-Ausstattung beeinflusst. Bei schlechten Wohnbedingungen und schlechter Ausstattung ist die wahrgenommene Arbeitsfähigkeit entsprechend eingeschränkt. Das wiederum führt ebenso zu einer mentalen Belastung, die das Suchtrisiko erhöhen kann.
6.3 Einordnung in den aktuellen Forschungsstand
Hinsichtlich der Schaffung guter Homeoffice-Bedingungen während der Corona- Krise und betrieblicher Suchtprävention bestätigen sich überwiegend alle Erkenntnisse, die in Bezug auf den aktuellen Forschungsstand beschrieben wurden. So bestätigen sich u. a. Bruhns Aussagen hinsichtlich des Eisbergmodells, in denen die Sachebene sowie die Beziehungsebene in der Kommunikation zwar beide relevant, die Beziehungsebene aber eine besonders relevante Rolle einnimmt. So sprachen viele der Befragten davon, dass sie Beschränkung auf die formelle Kommunikation als belastend empfinden und das folglich Missverständnisse und Fehlinterpretationen auftreten.
Lindners Erkenntnisse hinsichtlich der Relevanz wahrgenommener Unterstützung und Fairness durch Vorgesetzte, die auf der Kommunikation von verständlichen Beurteilungskriterien und Zielvorgaben beruht, der Notwendigkeit eines partizipativen Führungsstils und einer Fehlerkultur („Learning by Doing") bestätigen sich ebenso. Zudem bestätigt sich die von Bruhn beschriebene Erfordernis der Nutzung geeigneter Technologien, ganz besonders der Nutzung kollaborativer Arbeitswerkzeuge. Dabei zeigte auch die Analyse der Interviews, dass die von Lindner beschriebene Schaffung guter Homeoffice-Bedingungen sich aufgrund des Aufwands, der sich u. a. durch eine zeitaufwendigere Remote-Kommunikation ergibt, als herausfordernd darstellt.
In Bezug auf die betriebliche Suchtprävention lässt sich erkennen, dass die Einteilung der Suchttypen hinsichtlich des Alkoholkonsums nach Jellinek als sinnvoll erweisen. Jedoch ist in einem Fall eine Mischung aus zwei Suchttypen zu vermuten, weswegen eine exakte Abgrenzung schwierig ist. Manche SuchtmittelkonsumentInnen scheinen Eigenschaften verschiedener Suchttypen zu vereinen. Je-
doch wurde bestätigt, dass sich hinsichtlich des Suchtmittelkonsums vor allem Alkohol als problematisch zeigt.
6.4 Abschließendes Fazit
Abschließend kann hinsichtlich des Suchtmittelkonsums von Homeoffice- Beschäftigten festgestellt werden, dass Homeoffice das Risiko birgt, aufgrund schlechter Bedingungen das Suchtrisiko zu erhöhen. Die Homeoffice- Beschäftigung hat in der aktuellen Lage aber auch das Potenzial, das Suchtrisiko zu senken, sofern u. a. im Sinne der Suchtprävention nach Zielgröße und Zeitpunkt gute Homeoffice-Bedingungen geschaffen werden.
Wortzahl: 16.499
Literaturverzeichnis
Bibliografie
Alipour, J.-V., Falck, O., Peichl, A., Sauer, S. (2021) Homeoffice-Potenzial weiterhin nicht ausgeschöpft. In: ifo Schnelldienst digital: 2021, 6
Bruhn, P. und Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (2020) Homeoffice und mobiles Arbeiten im Team effektiv umsetzen Praxisratgeber: Remote Work und Heimarbeitsplatz technisch schnell einrichten.
DPG, A. K. C. (2021) A survey with 1500+ participants worldwide, Dpg-physik.de.
Verfügbar unter: https://www.dpg-
physik.de/vereinigungen/fachuebergreifend/ak/akc/covid-19-survey-results (Zugegriffen: 19. April 2021).
Feser, H. (1997) Umgang mit suchgefährdeten Mitarbeitern, insbesondere mit Alkoholabhängigen. Heidelberg, Deutschland: I. H. Sauer-Verlag.
Fuchs, R., Rainer, L. und Rummel, M. (Hrsg.) (1998) Betriebliche Suchtprävention. Göttingen: Hogrefe Verlag.
Hoppenstedt, I. (2016) Der Nutzen eines betrieblichen Gesundheits-managements am Beispiel, Fom.de. Verfügbar unter:
https://www.fom.de/fileadmin/fom/forschung/ifgs/Schriftenreihe/FOM-ifgs- Schriftenreihe-Band-02-Inga-Hoppenstedt-Betriebliches- Gesundheitsmanagement-2016.pdf (Zugegriffen: 19. April 2021).
Klein, M. (2021) Eine kleine Einführung in die Betriebliche Soziale Arbeit, Weinheimheim. Deutschland: Beltz Verlagsgruppe
Lindner, D. (2020) Virtuelle Teams und Homeoffice: Empfehlungen zu Technologien, Arbeitsmethoden und Führung.
Lott, Y. (2020) Work-Life Balance im Homeoffice: Was kann der Betrieb tun? Welche betrieblichen Bedingungen sind für eine gute Work-Life Balance im Homeoffice notwendig? Düsseldorf: Hans-Böckler-Stiftung, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut (WSI).
Marschall, J. u. a. (2019) DAK-Gesundheitsreport 2019. Hamburg, Deutschland: DAK Forschung
Mayring, P. (2015) Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken. 12. Aufl. Wiesbaden, Deutschland: Beltz Verlagsgruppe
Rummel, C. u. a. (2020) DHS Jahrbuch Sucht 2020. 1. Aufl. Lengerich: Pabst Science.
Schneider, V. (2015) Gesundheitspädagogik: Einführung in Theorie und Praxis. 2013. Aufl. Herbolzheim: Springer Fachmedien.
Uhle, T. und Treier, M. (2015) Betriebliches Gesundheitsmanagement: Gesundheitsförderung in der Arbeitswelt - Mitarbeiter einbinden, Prozesse gestalten, Erfolge messen. 3. Aufl. New York, NY, USA: Springer. doi: 10.1007/978-3-66246724-4.
Internetseiten
Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e. V. (o. J.) Pressemitteilung. DHS Jahresbuch Sucht 2020 ist erschienen. Verfügbar unter: https://www.dhs.de/fileadmin/user_upload/pdf/news/PM_Daten_Fakten_2020.p df (Zugegriffen: 02. Februar 2021).
Deutscher Gewerkschaftsbund (2020) „Homeoffice braucht klare Regeln“. Worauf es nach der Corona-Krise ankommt. Verfügbar unter:
https://www.dgb.de/themen/++co++4dbc5064-8dea-11ea-91ac-52540088cada (Zugegriffen: 02. Februar 2021).
Deutsches Ärzteblatt (o. J.) Die Covid-19-Pandemie als idealer Nährboden für Süchte. Verfügbar unter: https://www.aerzteblatt.de/archiv/214451/Alkohol-und- Rauchen-Die-COVID-19-Pandemie-als-idealer-Naehrboden-fuer-Suechte (Zugegriffen: 02. Februar 2021).
Gabler Wirtschaftslexikon (2018) SWOT-Analyse. Verfügbar unter: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/swot-analyse-52664 (Zugegriffen: 16. April 2021).
GKV-Spitzenverband (2021) Betriebliche Gesundheitsförderung. Verfügbar unter: https://www.gkv- spitzenver-
band.de/krankenversicherung/praevention_selbsthilfe_beratung/praevention_un d_bgf/bgf/BGF_s.jsp (Zugegriffen: 16. April 2021).
Kaufmann, M. (2021) Alkohol im Homeoffice: Wie leicht man in die Sucht rutscht, wo man Hilfe findet. Verfügbar unter: https://www.spiegel.de/karriere/alkohol-im- homeoffice-wie-leicht-man-in-die-sucht-rutscht-wo-man-hilfe-findet-a-aa7d67d6- ef9b-406f-8495-7033c699fe50, 28. Februar (Zugegriffen: 16. April 2021).
Merkur (2020) Alkoholsucht: Corona-Krise gefährlicher als bislang angenommen - Studie offenbar erschreckende Folgen. Verfügbar unter: https://www.merkur.de/welt/coronavirus-alkohol-sucht-job-arbeitsplatz- deutschland-zr-90030850.html (Zugegriffen: 03. Februar 2021).
-. V. (o. J.) Gesetz über den Verkehr mit Betäubungsmitteln (Betäubungsmittelgesetz - BtMG). Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Verfügbar unter: https://www.gesetze-im-internet.de/btmg_1981/anlage_iii.html (Zugegriffen: 03. Februar 2021).
Steinhardt, I. (2019) Induktives und deduktives Codieren. Verfügbar unter: https://sozmethode.hypotheses.org/842 (Zugegriffen: 16. April 2021).
Theobald, E. (o. J.) PESTEL-Analyse. Die wichtigsten Einflussfaktoren der Makroumwelt. Verfügbar unter: https ://www.management-
monitor.de/de/infothek/whitepaper_pestel_Analyse.pdf?m=1612427946 (Zugegriffen: 16. April 2021).
ZDF (2020) Deutschland im Coronarausch? Jeder Dritte trinkt mehr seit der Krise. Verfügbar unter: https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/coronavirus-trinken- alkohol-sucht-100.html (Zugegriffen: 03. Februar 2021).
Anhang
1) Interviewleitfaden
2) Transkriptionen der Interviews
3) Qualitative Inhaltsanalyse
4) Verschwiegenheitserklärung hinsichtlich der Interviews für Befragte
5) Vorgaben zur Gliederung und Aufbau der Masterarbeit
6) DAK-Gesundheitsreport 2019
Anm. der Red.: Anhang 3), 4), 5) und 6) wurden entfernt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Interviewleitfaden
Masterthesis: Einflussfaktoren der Corona-Krise auf den Konsum von Suchtmitteln durch Beschäftigte im Homeoffice
Informationen zur Durchführung:
Im Leitfaden werden Fragen gestellt, die hinsichtlich der
- wahrgenommenen Arbeitsfähigkeit (Variable A1),
- der Reichhaltigkeit der Kommunikation (Variable A2)
- und der Intensität von Beziehungen im Homeoffice (Variable A3)
relevant erscheinen. Ebenso werden die Befragten nach ihrer psychischen Verfassung sowie ihrem Suchtmittelkonsum (Variable B) befragt. Ziel ist es, den Einfluss der A-Variablen auf die psychische Verfassung der Befragten zu untersuchen und inwiefern die psychische Verfassung sich auf den Suchtmittelkonsum auswirken könnte.
Zu jedem der Befragten besteht zum Zeitpunkt der Befragung bereits ein gewisses Vertrauensverhältnis. Ebenso wird ihnen zugesichert, dass sie und ihr Arbeitgeber anonym bleiben, auch mit dem Angebot einer schriftlichen Zusicherung. Die soll hinsichtlich dieses sensiblen Themas sicherstellen, das die Befragten so ehrlich wie möglich antworten und sich wohlfühlen. Zudem wird hier die Variante eines semistrukturierten Interviews gewählt, um eine Atmosphäre zu schaffen, die einem ungezwungenen Gespräch nahekommt.
Instruktionen an die jeweils befragte Person (vor der Aufnahme):
- Direkt zur Information: Ich werde das Interview aufzeichnen. Du bleibst völlig anonym. Niemand außer mir bekommt dieses Video zu sehen, lediglich die Transkription ohne Angabe des Namens und des Arbeitsgebers. Das halte ich hinsichtlich dieses sensiblen Themas für sehr wichtig, außerdem sind Name und Arbeitgeber der Befragten für die Erhebung völlig irrelevant. Das bekommst du von mir auch gerne schriftlich zur deiner Absicherung.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
- Im Schnitt hast du 3 Minuten Zeit zur Beantwortung jeder Frage. Das wird nicht immer klappen, keine Frage, aber versuche das möglichst einzuhalten. 3 Minuten klingen zudem kurz, sind aber eigentlich recht lang und viele Fragen können wahrscheinlich problemlos unter dieser Zeit beantwortet werden.
- Aus dem Bauch heraus antworten. Sag die ersten Gedanken, die dir in den Sinn kommen.
- Wenn du fertig mit der Beantwortung bist, hebe einfach kurz den Daumen, damit die nächste Frage gestellt werden kann oder gib zu einfach kurz Bescheid (im Zweifel frage ich aber auch nach). Je nachdem muss ich dich aufgrund der Zeit dann unterbrechen, führe deinen letzten Satz aber in Ruhe zu Ende aus. Kein Stress.
- Ich werde dir die Fragen bei Bedarf zusätzlich per Chat schicken (z.B. wenn sie für dich schwer verständlich ist).
- Wenn du eine Frage nicht richtig verstehst, gebe ich gerne Hilfestellung.
- Ich lasse dich frei antworten und werde dir lediglich Fragen stellen, ohne die Antworten groß zu kommentieren. Es geht vor allem um deine Gedanken zu dem Thema, nicht um meine Gedanken.
- Falls dir irgendwelche Fragen außer deiner Sicht anders stellen würdest oder Verbesserungsvorschläge für das Interview insgesamt hast, bitte nach dem Interview sagen.
- Wir machen kurz eine Testaufzeichnung, bevor wir dann beginnen.
- Der Test hat geklappt. D.h. wir beginnen JETZT mit der Aufzeichnung und ich stelle dann die erste Frage (Aufzeichnung starten).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Einstiegsfragen
Frage 1: Wie alt bist du?
Frage 2: Arbeitest du im öffentlichen Bereich oder in der Privatwirtschaft?
Frage 3: In welcher Branche bzw. in welchem konkreten Bereich arbeitest du?
Frage 4: Arbeitest du in einer Führungsposition bzw. in einer führenden Rolle?
Frage 5: Würdest du dich selbst eher als introvertiert oder als extrovertiert bezeichnen?
2 Kategorie H: Homeofficebedingungen
2.1 Arbeitsfähigkeit
Frage 1: Arbeitest du derzeit Vollzeit im Homeoffice oder nur teilweise?
- Frage zum Nachhaken was „teilweise“ geantwortet wird:
- Wie oft?
Frage 2: Hast du beim ersten Shutdown im Frühjahr Vollzeit im Homeoffice gearbeitet? (Falls in der ersten Frage mit„teilweise“ geantwortet wird)
Frage 3: Hast du gute wohnliche Bedingungen, um im Homeoffice arbeiten zu können? Wenn ja bzw. nein, warum?
- Optionale Zusatzfragen:
- Wohnst du alleine?
- Hast du Kinder?
- Kann das manchmal schwierig mit den Nachbarn werden?
- War das beim ersten Shutdown auch so?
Frage 4: Gibt es bei deinem Arbeitgeber betriebliche Maßnahmen, damit dein Berufs- und dein Privatleben gut miteinander harmonieren? Und welche wären das?
- Optionale Zusatzfragen:
- Gibt es vertragliche Regelungen zur Homeoffice-Tätigkeit bei deinem Arbeitgeber?
- War das beim ersten Shutdown im Frühjahr auch so?
- Findest du, dass sich Arbeits- und Berufsleben dadurch dann mischen? Oder kannst du das klar trennen?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Frage 5: Wie ist die Arbeitszeit im Homeoffice bei deinem Arbeitgeber geregelt?
- Optionale Zusatzfragen:
- Gibt es feste Homeofficetage?
- Arbeitest du stundenweise?
- Hast du flexible Arbeitszeiten?
- Gibt es denn Pausregelungen? Und nutzt du diese Pausen auch entsprechend, um Pause zu machen?
- War das beim ersten Shutdown Frühjahr auch so geregelt?
Frage 6: Nutzt du Homeoffice auch, um die Arbeitsmenge bewältigen zu können? Z.B. um Arbeit nachzuholen oder diese vor der eigentlichen Arbeitszeit vorzubereiten?
- Optionale Zusatzfrage: Wie viele Stunden sind das die Woche? Ungefähr?
Frage 7: Gibt es Situationen im Homeoffice, in denen du dich überfordert fühlst?
- Optionale Zusatzfragen:
- Warum?
- Fällt es dir manchmal schwer, die Motivation zu behalten? Schwerer, als es jetzt im Betrieb wäre?
- Wie empfandest du die Situation im ersten Shutdown im Frühjahr? Was sie besser oder schlechter?
- Würdest du sagen, du arbeitest insgesamt produktiver?
Frage 8: Würdest du sagen, dass du durch Homeoffice mehr oder weniger Arbeit bewältigen musst? Und warum siehst du das so?
- Optionale Zusatzfragen:
- Musst du denn vielleicht für die gleiche Arbeit größeren Aufwand betreiben?
- Hast du beim ersten Shutdown im Frühjahr genauso empfunden? Oder war die Situation besser bzw. schlechter?
Frage 9: Ergreift dein Arbeitgeber konkrete Maßnahmen für betriebliche Suchtprävention, die dir bekannt sind?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Frage 10: Wie empfindest du deine Arbeitsbedingungen im Homeoffice insgesamt?
- Optionale Zusatzfrage: Hast du beim ersten Shutdown im Frühjahr genauso empfunden? Oder war die Situation besser bzw. schlechter?
2.2 Reichhaltigkeit der Kommunikation
Frage 1: Wie steht es denn um die technische Ausstattung im Homeoffice? Ist die zufriedenstellend oder eher nicht?
Frage 2: Ist die Kommunikationsfähigkeit im Betrieb im Vergleich zum Homeoffice besser oder schlechter?
Frage 3: Trägt die Kommunikation im Homeoffice dazu bei, dass du deine Arbeit machen kannst? Wenn ja bzw. nein, warum?
- Optionale Zusatzfragen:
- Hast du beim ersten Shutdown im Frühjahr genauso empfunden?
- Könntest du die Arbeit im Betrieb besser machen?
Frage 4: Findest du, dass die Kommunikationsfähigkeit im Homeoffice besser sein könnte? Wenn ja, warum und was sollte besser sein?
Frage 5: War die Situation im ersten Shutdown im Frühjahr besser oder schlechter hinsichtlich der Kommunikationsfähigkeit?
2.3 Intensität zwischenmenschlicher Beziehungen zu KollegInnen und Vorgesetzten
Frage 1: Hast du gute Beziehungen zu deinen KollegInnen? Wenn ja bzw. nein, warum?
- Optionale Zusatzfragen:
- Sind die Beziehungen zu deinen KollegInnen eher professioneller Natur? Oder sind sie intensiver?
- Sind die Beziehungen während der Homeofficebeschäftigung weniger intensiv geworden?
- Fehlt dir die soziale Interaktion mit ihren KollegInnen, weil diese durch Homeoffice weniger geworden ist?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Frage 2: Findest du, dass deine Vorgesetzten fairer mit dir umgehen könnten? Und wenn ja: Warum?
- Optionale Zusatzfrage:
- Ist die Beziehung eher professioneller Natur oder nicht?
Frage 3: Wie ist das Betriebsklima bei deinem Arbeitgeber insgesamt?
- Optionale Zusatzfrage:
- Wie war das Betriebsklima beim ersten Shutdown im Frühjahr im Vergleich zu heute? Besser? Schlechter?
3 Fragen zum Homeoffice allgemein (Einschätzung der befragten Person zur Gesamtsituation der Homeoffice- Beschäftigten)
Frage 1: Glaubst du, dass Homeoffice die Arbeitsfähigkeit anderer Homeoffice- MitarbeiterInnen während der Corona-Krise allgemein eher verschlechtert oder verbessert hat?
Frage 2: Glaubst du, dass die Kommunikationsfähigkeit für andere Homeoffice- Beschäftigte während der Corona-Krise sich allgemein eher verbessert oder verschlechtert hat?
Frage 3: Glaubst du, dass die Beziehungen zwischen KollegInnen und zwischen MitarbeiterInnen und Vorgesetzten sich durch Homeoffice verschlechtern können?
- Optionale Zusatzfrage: Gerade in Bezug auf die Corona-Krise?
4 Psychische Belastung durch die Corona-Krise
Frage 1: Wie stark belastet dich die Corona-Krise psychisch?
- Optionale Zusatzfrage:
- Wie war die Situation im ersten Shutdown im Frühjahr im Vergleich zu heute? Besser oder schlechter? Und warum?
Frage 2: Inwiefern trägt die Homeoffice-Tätigkeit zu dieser Belastung bei?
- Optionale Zusatzfragen:
- Was belastet Sie hier besonders?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
- Wie stark hat Homeoffice Sie im ersten Shutdown belastet? Stärker oder weniger?
Frage 3: Mal auf die allgemeine Entwicklung bezogen: Glaubst du, dass Homeoffice für manche ArbeitnehmerInnen eine starke psychische Belastung darstellt?
5 Konsum von Alkohol, Tabak und Medikamenten
5.1 Kategorie A: Alkoholkonsum
Frage 1: Trinkst du Alkohol? Antworte mit „Ja“ oder „Nein“.
Frage 2: Wie viel Alkohol trinkst du im Schnitt wöchentlich?
5.2 Kategorie T: Tabakkonsum
Frage 1: Rauchst du? Antworte mit „Ja“ oder „Nein“.
Frage 2: Wie viel rauchst du im Schnitt täglich?
5.3 Kategorie M: Medikamentenkonsum
Frage 1: Nimmst du regelmäßig Medikamente? Und wenn ja: Welche?
- Optionale Zusatzfrage:
- Nimmst du denn regelmäßig Medikamente z.B. um zu entspannen, besser zu schlafen oder gegen Kopfschmerzen?
5.4 Abschlussfragen
Frage 1: Glaubst du, dass der Konsum von Alkohol/Tabak/Medikamenten bei Beschäftigten im Homeoffice insgesamt gestiegen sein könnte, weil diese Homeoffice während der Corona-Krise als belastend empfinden?
Frage 2: Also glaubst du (nicht), dass Homeoffice-Beschäftigte aufgrund des Arbeitsstress derzeit vermehrt zu Alkohol, Tabak und/oder Medikamenten greifen?
- Optionale Zusatzfrage: Wie glaubst du war die Situation im ersten Shutdown im Frühjahr im Vergleich zu heute?
Frage 3: Konsumierst du seit der Coronakrise mehr Alkohol? (Falls die Person Alkohol trinkt)
- Optionale Zusatzfragen:
- Wie war das denn beim ersten Shutdown im Frühjahr?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
- Also trinkst du nicht mal ein Feierabendbierchen oder etwas ähnliches nach der Arbeit?
- Wie oft?
- Haben sie das vor dem Shutdown weniger oder häufiger gemacht?
Frage 4: Konsumierst du seit der Coronakrise mehr Tabak? (Falls die Person raucht)
- Optionale Zusatzfragen:
- Wie war das denn beim ersten Shutdown im Frühjahr?
- Also machen Sie beim Homeoffice nicht mehr Raucherpausen als im Betrieb?
- Haben sie das vor dem Shutdown weniger oder häufiger gemacht?
Frage 5: Konsumierst du seit der Coronakrise mehr Medikamente? (Falls die
Person Medikamente nimmt)
- Optionale Zusatzfrage:
- Wie war das denn beim ersten Shutdown im Frühjahr?
- Also nehmen Sie nicht z.B. Medikamente, um z.B. besser Schlafen zu können oder zur Beruhigung?
- Wie oft?
- Haben sie das vor dem Shutdown weniger oder häufiger gemacht?
Frage 6: Was nimmst du deiner Meinung nach zu viel: Alkohol, Tabak und/oder Medikamente? (Falls die Person eines dieser Suchtmittel konsumiert)
- Optionale Zusatzfragen:
- Warum Alkohol/Tabak/Medikamente?
- Trifft das auf die anderen Mittel also nicht zu?
Frage 7: Konsumierst du andere Mittel, z.B. zur Beruhigung, um besser zu schlafen und/oder gegen den Arbeitsstress? Wenn ja: Welche?
- Optionale Zusatzfrage:
- Wie viel konsumierst du davon?
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Inhaltsverzeichnisses?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst ein Abkürzungsverzeichnis, Abbildungsverzeichnis, Tabellenverzeichnis, Einleitung mit Relevanz der Thematik und Zielsetzung, Theoretische Fundierung mit Forschungsfragen, Grundannahmen, Forschungsrahmen, Begründung für die Auswahl der Variablen, Aktueller Forschungsstand (inkl. Mitarbeiterführung im Homeoffice während der Corona-Krise und Betriebliche Suchtprävention), Forschungslücke, Methodisches Vorgehen (Sekundär- und Primärforschung), Ergebnisse und Handlungsempfehlungen (Auswertung der Interviews und Handlungsempfehlungen), Diskussion (Eigene Beiträge, Grenzen der Arbeit, Anschlussmöglichkeiten), Schlussfolgerung (Einschätzung der Situation, Beantwortung der Forschungsfragen, Einordnung, Fazit), Literaturverzeichnis, Bibliografie, Internetseiten und Anhang.
Was ist das Ziel der Masterarbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Belastungs- sowie die Entlastungsfaktoren im Homeoffice und deren Auswirkungen auf den Suchtmittelkonsum von Mitarbeitenden zu untersuchen und Handlungsempfehlungen für zeitgemäße betriebliche Suchtprävention zu erarbeiten.
Welche Forschungsfragen werden untersucht?
Die Forschungsfragen sind: Inwiefern beeinflusst die wahrgenommene Reichhaltigkeit der Kommunikation im Homeoffice den Konsum von Suchtmitteln? Inwiefern beeinflusst die wahrgenommene Intensität von Beziehungen der Mitarbeitenden im Homeoffice zu KollegInnen und Führungskräften den Konsum von Suchtmitteln? Inwiefern beeinflusst die wahrgenommene Arbeitsfähigkeit im Homeoffice den Konsum von Suchtmitteln?
Welche Grundannahmen liegen der Arbeit zugrunde?
Die Grundannahmen sind: Je schlechter die wahrgenommene Arbeitsfähigkeit im Homeoffice ist, desto mehr neigen ArbeitnehmerInnen zum Konsum von Suchtmitteln. Je weniger reichhaltig die wahrgenommene Kommunikation im Homeoffice ist, desto mehr neigen ArbeitnehmerInnen zum Konsum von Suchtmitteln. Je weniger intensiv die Beziehungen zu KollegInnen und Führungskräften im Homeoffice ist, desto mehr neigen ArbeitnehmerInnen zum Konsum von Suchtmitteln.
Welche methodischen Ansätze werden verfolgt?
Die Arbeit verwendet eine Kombination aus Sekundärforschung (Theorie) und Primärforschung (Empirische Forschung durch qualitative Methodik). Die Primärforschung stützt sich auf semistrukturierte Interviews und eine qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring.
Welche Gütekriterien werden bei der qualitativen Forschung berücksichtigt?
Die Gütekriterien, die berücksichtigt werden, sind Intersubjektivität, Reichweite und Transparenz.
Welche Suchtmittel werden primär betrachtet?
Der Fokus liegt auf Alkohol, Tabak und Medikamenten, da diese in Betrieben am meisten verbreitet sind und eine breite gesellschaftliche Akzeptanz erfahren, aber dennoch ein hohes Suchtpotenzial besitzen.
Welche Arten der Suchtprävention werden unterschieden?
Es werden Kategorisierungen nach Zeitpunkt (Primär-, Sekundär-, Tertiärprävention) und Zielgröße (Verhaltens- und Verhältnisprävention) unterschieden.
Welche Handlungsempfehlungen werden gegeben?
Zu den Handlungsempfehlungen gehören: Aktives Betreiben von BGM und betrieblicher Suchtprävention, Sicherstellung von wahrgenommener Unterstützung und Fairness durch Arbeitgebende, effektives Teambuilding, Schulung von Führungskräften im Bereich BGM, Berücksichtigung von Umweltfaktoren der Makroumwelt, Bereitstellung von Onlinesportkursen und anderen Trainingsmethoden, Verfügbarmachen von Hilfsangeboten, Angebot von regelmäßigen psychologischen Sprechstunden und Information der Vorgesetzten über das Befinden der Mitarbeitenden sowie Inanspruchnahme von Dienstleistungen von Krankenkassen. Zusätzlich werden spezifische Maßnahmenempfehlungen für den Öffentlichen Dienst gegeben.
- Arbeit zitieren
- Marc Böhr (Autor:in), 2021, Einflussfaktoren der Corona-Krise auf den Konsum von Suchtmitteln durch Beschäftigte im Homeoffice, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1363735