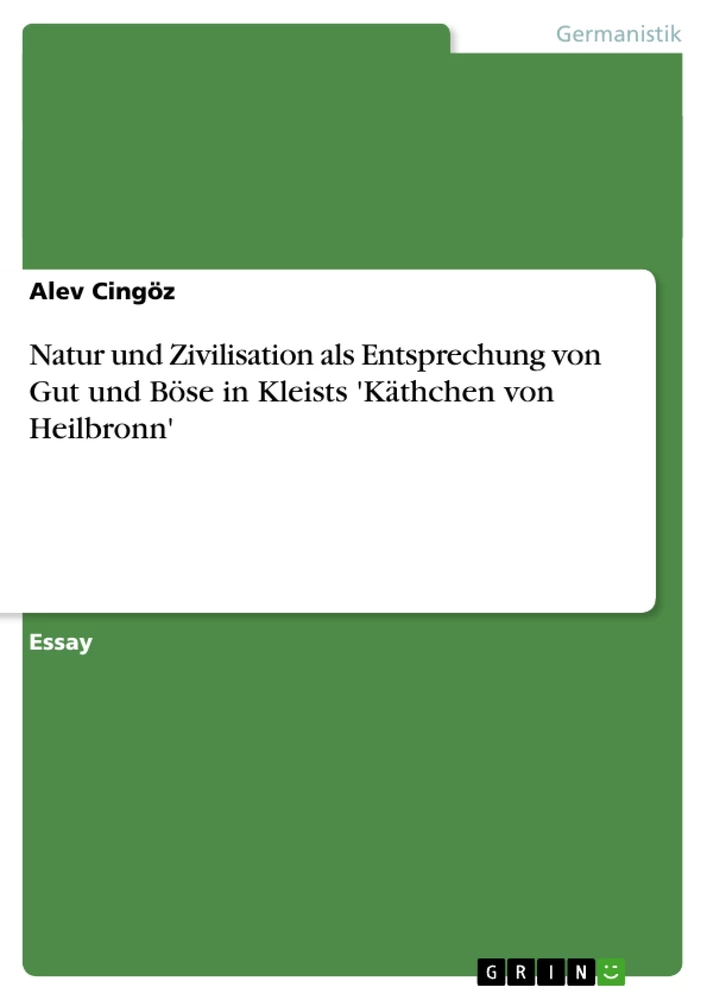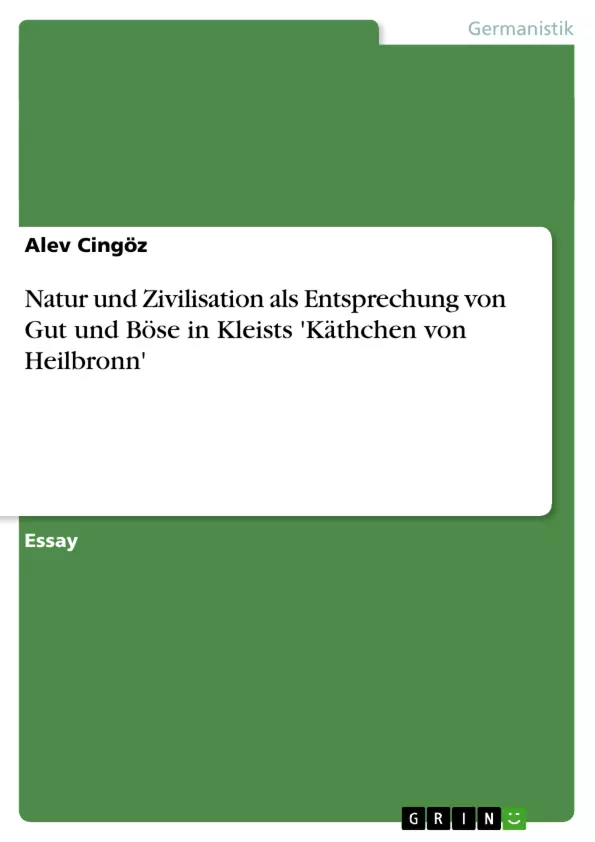In Heinrich von Keists Ausnahmedrama Das Käthchen von Heilbronn finden sich nicht nur romantische und märchenhafte Elemente – die der Märchenwelt entsprungenen Pole von ‚Gut’ und ‚Böse’ lassen sich auch dem Kontrast von Natur und Zivilisation zuordnen.
Natur und Zivilisation als Entsprechung für Gut und Böse in Kleists Käthchen von Heilbronn
In Heinrich von Keists Ausnahmedrama Das Käthchen von Heilbronn finden sich nicht nur romantische und märchenhafte Elemente – die der Märchenwelt entsprungenen Pole von ‚Gut’ und ‚Böse’ lassen sich auch dem Kontrast von Natur und Zivilisation zuordnen.
Käthchen, als natürliche Schönheit, ist mit der idyllischen, intakten Natur gleichzusetzen. Sie ist gewissermaßen die ‚gute Fee’, die selbstlos liebt. Kunigunde hingegen ist mit ihrem künstlichen, berechnenden Dasein dem zivilisatorischen Bereich zuzuordnen. Durch ihre Habsucht fällt sie eindeutig in den Bereich des ‚Bösen’. Bei genauerer Betrachtung der Szenerien und der jeweiligen Inhalte lässt sich dies belegen.
Nachdem Käthchen sich, um dem Grafen zu folgen, aus dem Fenster stürzt, muss sie sich erst von ihren Verletzungen erholen, und zwar im häuslichen Umfeld – sie kann ihm nicht folgen, ist in zivilisatorischen Räumlichkeiten gefangen. Sobald sie wieder laufen kann, lässt sie vollkommen selbstlos Heimat, Familie, Habseligkeiten und den Bräutigam zurück und macht sich auf den Weg durch die Natur, um dem Grafen nachzureisen (I,1). Als sie ihrem ‚Herrn’ begegnet, was als positives Ereignis für sie zu verzeichnen ist, da sie ihn endlich gefunden hat, findet dies im Freien statt – Graf vom Strahl lehnt an einer Felswand in der Mittagssonne und schläft. Als er aufwacht, behandelt er sich zunächst freundlich und höflich – ebenfalls positiv für sie. Theobald Friedeborn, Käthchens vermeintlicher Vater, will seine Tochter beim Grafen abholen und tritt durch eine Tür, als er Käthchen begegnet (I,1) – man befindet sich also drinnen, nicht etwa in der Natur. Dies ist ein schrecklicher Moment für Käthchen: Sie wirft sich dem Grafen zu Füßen, um nicht mit dem Vater zurückkehren zu müssen. Während der Höhlen- bzw. Gerichtsszene zu Anfang des Dramas befindet sich Käthchen in einer naturähnlichen, doch zivilisatorisch genutzten Räumlichkeit (I,2). Sie erweckt den Eindruck, als sei sie verzaubert. Sie verzögert den Fortgang der Verhandlung und auch die Situation ist beklemmend für sie: Sie rückt nicht mit der Sprache heraus und verschweigt, weshalb sie dem Grafen folge. Erst im 3.Akt begegnen sich Käthchen und der inzwischen vergrämte Graf wieder. Die Szenerie besteht nun aus einem Zimmer in der Burg zu Thurneck. Käthchen versucht, dem Grafen einen Brief, der einen kriegerischen Angriff auf die Burg ankündigt, auszuhändigen und somit den Grafen zu warnen (III,6). doch in seiner Wut gegen das Mädchen peitscht der Graf sie beinahe aus – für diesen eigentlich simplen Akt muss sie sich enorm anstrengen, um Hilfe zu leisten, was ebenfalls negativ zu bewerten ist. Als Schloss Thurneck tatsächlich angegriffen wird, ist der Schauplatz der Handlung vor dem Schloss, also draußen unter freiem Himmel. Es ist Nacht (III,7). Käthchen bringt dem Grafen Schwert, Schild und Lanze, anstatt sich von diesem gefährlichen Ort fernzuhalten (III,9). Doch zunächst wird sie wieder einmal nur ausgeschimpft. Man steht immer noch draußen, als das Schloss in Flammen aufgeht (III,12). Käthchen will Kunigunde ein Bild aus dem brennenden Gebäude retten – hier zeigt sich erneut die helfende Funktion bzw. Absicht Käthchens. Im Gebäude allerdings stirbt sie fast (III,13). Doch wie es auch ins Märchenwesen passt, wird sie gerettet: Ein Cherub begleitet sie schützend aus dem brennenden Gebäude heraus. Das Innere des Gebäudes, welches der Zivilisation zuzurechnen ist, stellt also Gefahr für sie dar, wenn nicht gar den Tod. Diese vermutung wird durch den Sturz aus dem Fenster im 1.Akt gestützt: Erst im Freien kann sie ungehindert ihrem ‚Herrn’ folgen; die Mauern des Gebäudes hingegen hindern sie beim ersten Versuch, ihm nachzulaufen. Folgt sie ihm jedoch über Wochen durch Wald und Wildnis, geschieht ihr nichts. Selbstlos wie sie ist, macht es ihr nicht einmal etwas aus, im Stall zu übernachten. So auch hier in der ‚Cherub-Szene’. Der Engel verschwindet erst, als Käthchen sich draußen, also nicht mehr im Gefahr bringenden Gebäude, befindet. Im Freien ist sie in Sicherheit, wohingegen ihr zivilistorische Räumlichkeiten Gefahr oder ein negatives Erlebnis bescheren. Die idyllische Holunderstrauchszene ist diejenige, in der der Graf und Käthchen endgültig zusammenfinden (IV,2). Sie schläft unter freiem Himmel und redet mit ihm im Schlaf. Diese ‚Holunderszene’ ist es auch, die eine Wendung des Grafens im Ungang mit Käthchen mit sich bringt: Er behandelt sie von nun an nur noch sehr höflich und fürsorglich (IV,3)]. In der ‚Grottenszene’ will Käthchen sich frohen Mutes baden (IV,6). doch auch diese zivilisatorisch gebrauchte Räumlichkeit ist ein schlechtes Erlebnis: Sie entdeckt das wahre Gesicht Kunigundes und erfährt, dass diese vorhabe, sie zu vergiften. Schließlich die Schlussszene: Auf dem Schlossplatz unter freiem Himmel kommt es bei der geplanten Hochzeit des Grafen mit Kunigunde dazu, dass der Graf plötzlich Käthchen heiratet, was die Krönung des Glücks für diese darstellt (V,12).
Für die Figur des Käthchens steht an dieser Stelle fest: Das ‚gute’ Käthchen ist unter freiem Himmel, in der Natur, freier und erfolgreicher in ihren selbstlosen Absichten.
Die zahlreichen erwähnten Szenen zeigen, dass sie in der Welt der Zivilisation, verkörpert durch von Menschenhand geschaffene Räume oder zu menschlichen Zwecken verwendete Naturgebilde (Höhle, Grotte) Gefahr und Unheil für sie bedeuten.
Kunigunde, als Vertreterin der Zivilisation, der Habgier und des ‚Bösen’ im Märchenhaften, wird im Gebirge, vor einer Hütte im Wald in das Geschehen eingeführt (III,4). Sie wird, bevor ihre Figur auch nur zu sprechen beginnt, als listig und intrigant dargestellt, da sie sich reglos gibt. Doch der geprellte Burggraf von Freiburg kennt sie und weiß somit, wie intrigant sie ist. Im Schloss des Grafen, als sie erzählt, sie sei nicht die Tochter des Kaisers, wird sie frisiert, was zu ihrer gespielten, künstlichen Charakterisierung der Falschheit gehört (II,9). Im 10.Auftritt, also nur kurze Zeit später, legt sie Papiere, die die Herrschaft Stauffens betreffen, für den Grafen zusammen (wie sich später herausstellt, ist auch dies eine List). Diese Szene, die sich ebenfalls im Schloss abspielt, zielt auf die Habgier Kunigundes. Innerhalb des Zivilisatorischen kann sie ihre ‚bösen’, ‚schlechten’ Machenschaften tätigen, ein falsches Spiel spielen; sie ist quasi durch die Räumlichkeiten ‚geschützt’. Im 3.Akt droht Kunigunde im brennenden Schloss zu sterben (III,11). Eine Interpretationsmöglichkeit wäre, dass sie bereits in der Mitte des Dramas droht, an ihrer zivilisatorischen Habgier und Boshaftigkeit zu sterben. Sie muss erst gerettet werden, kann sich aus eigener Kraft nicht befreien. Kunigunde besitzt nicht etwa die Opferbereitschaft Käthchens, die für sie noch einmal ins brennende Gebäude läuft, um ein Bild für sie zu retten. In der ‚Grottenszene’ offenbart sie einen Todesplan (IV,6), der ihre wahre Natur, die eine Unnatur ist, zum Vorschein bringt. Die persönliche Tragödie Kundigundes nimmt ihren Lauf: Später droht sie im Zimmer des Schlosses – in Bereich der Zivilisation wohlbemerkt - ungeschminkt und damit ihr wahres Aussehen zum Vorschein bringend, vom Grafen entdeckt zu werden (V,4). Nach der Wendung im 3.Akt wird ihr schließlich die eigene Art, welche ja ‚böse’ ist, zum Verhängnis. Sie ist nicht mehr ‚sicher’ in ihrer Handlungsweise. Schließlich folgt im letzten Auftritt die schrecklichste Szene für Kunigunde: Sie muss – draußen auf dem Schlossplatz – mitansehen, wie sie auf ihrer eigenen Hochzeit abgelehnt wird und scheitert mit all ihren Plänen, geht letzten Endes komplett leer aus. Ihr böser Charakter wurde enttarnt.
Somit steht die Natur im Käthchen von Heilbronn für das Gute und Reine (bezüglich der Liebe) im Drama Kleists. Die Zivilisation hingegen ist verbunden mit Habgier, Intrige, Selbstsucht, Falschheit, dem ‚Bösen’. Während Käthchen sich nur im Freien entfalten kann, entblößt Kunigunde in der Natur ihr böses Inneres; die Zivilisation kann sie nicht ewig beschützen, so kommt die Figur des Bösen zu Fall.
Alev Cingöz
[...]
Häufig gestellte Fragen
Wie symbolisiert Käthchen die Natur?
Käthchen wird als natürliche Schönheit dargestellt, die sich unter freiem Himmel am wohlsten fühlt und dort ihre selbstlose Liebe entfalten kann.
Warum steht Kunigunde für die Zivilisation?
Kunigunde verkörpert das Künstliche, Berechnende und Habgierige, was in der Arbeit dem Bereich der Zivilisation und des Bösen zugeordnet wird.
Welche Rolle spielen Gebäude im Drama?
Zivilisatorische Räume wie Schlösser oder Grotten stellen für Käthchen oft eine Gefahr dar, während sie in der freien Natur sicher ist.
Was bedeutet die Holunderstrauchszene?
Dies ist ein zentraler Moment der Naturverbundenheit, in dem der Graf und Käthchen unter freiem Himmel endgültig zueinander finden.
Wie endet der Konflikt zwischen Natur und Zivilisation?
Das Gute (die Natur) siegt in Gestalt von Käthchen, während die böse Intrige Kunigundes (die Zivilisation) am Ende entlarvt wird.
- Arbeit zitieren
- Alev Cingöz (Autor:in), 2008, Natur und Zivilisation als Entsprechung von Gut und Böse in Kleists 'Käthchen von Heilbronn', München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/136439