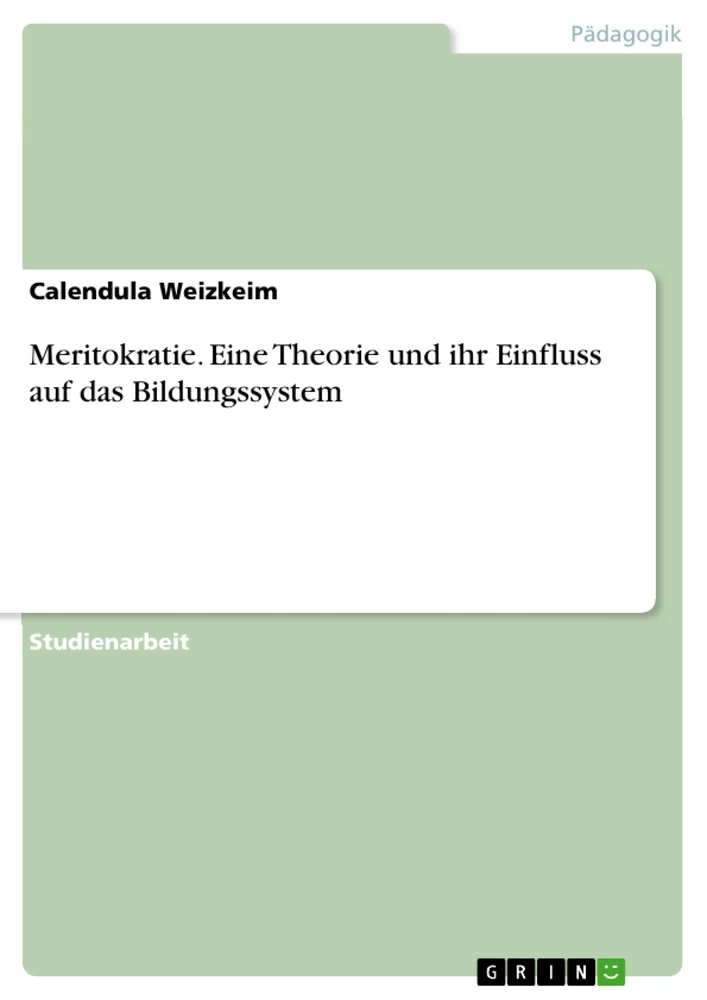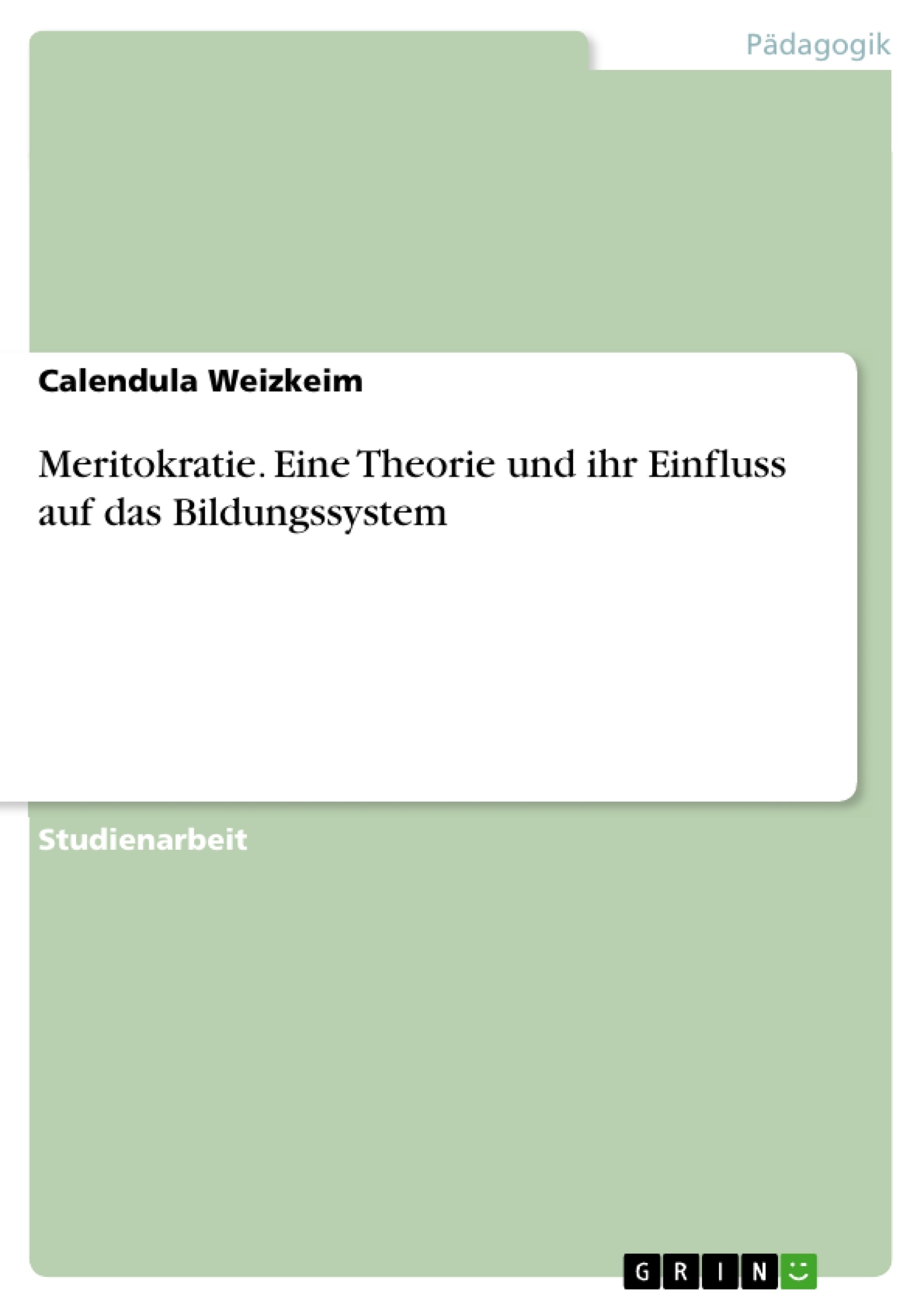Die vorliegende Hausarbeit behandelt die Vorherrschaft des Leistungsprinzips in unserem Bildungssystem und wie diese die Laufbahn von Schülern beeinflusst.
Zunächst gehe ich auf die Begriffsbestimmungen von Bildung, Meritokratie und sozialer Ungleichheit ein, bevor das meritokratische Theoriekonzept und dessen Umsetzung im Mittelpunkt steht. Anschließend folgen ausgewählte Kritikpunkte am Modell, sowie eine Erörterung der Frage, warum wir uns mit der Meritokratie in der Pädagogik beschäftigen müssen. Dass das Leugnen von sozialer Ungleichheit in unserem Schulsystem dafür sorgt, dass sich dieselben Ungleichheiten festigen, soll im vorletzten Kapitel erläutert werden. Am Ende meiner Hausarbeit ziehe ich ein Fazit zur Funktionalität der Meritokratie in unserer postmodernen Gesellschaft.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsbestimmungen
- 2.1 Bildung
- 2.2 Meritokratie
- 2.3 Soziale Ungleichheit
- 3. Die Meritokratie
- 4. Ausgewählte Kritikpunkte
- 4.1 Never forget where you're coming from
- 4.2 Begabungsunterschiede
- 4.3 Leistung messen, geht das überhaupt?
- 5. Warum beschäftigt sich die Pädagogik mit der Meritokratie?
- 6. Die Tabuisierung von Ungleichheit in der Primarstufe und daraus resultierende Reproduktion von sozialer Ungleichheit
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das meritokratische Prinzip und dessen Einfluss auf das Bildungssystem. Ziel ist es, die Funktionsweise der Meritokratie im Bildungssystem zu beleuchten, deren Legitimation zu hinterfragen und die Realisierbarkeit von Chancengleichheit in diesem Kontext zu analysieren.
- Begriffsbestimmung und Abgrenzung von Bildung, Meritokratie und sozialer Ungleichheit
- Das meritokratische Theoriekonzept und seine Umsetzung im Bildungssystem
- Kritikpunkte am meritokratischen Modell und dessen Auswirkungen
- Der Zusammenhang zwischen der Tabuisierung sozialer Ungleichheit im Bildungssystem und der Reproduktion dieser Ungleichheit
- Die Frage nach der Funktionalität der Meritokratie in der postmodernen Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Chancengleichheit und des meritokratischen Prinzips ein. Sie verweist auf das Grundgesetz und den Anspruch auf gleiche Chancen, betont jedoch gleichzeitig den Widerspruch zwischen diesem Anspruch und der Realität sozialer Ungleichheit. Die Arbeit kündigt die Auseinandersetzung mit der Frage an, wie das meritokratische Prinzip im Bildungssystem funktioniert und ob es tatsächlich Chancengleichheit ermöglicht.
2. Begriffsbestimmungen: Dieses Kapitel klärt die zentralen Begriffe der Arbeit: Bildung, Meritokratie und soziale Ungleichheit. Bildung wird im Kontext von Lebensführungskompetenzen und Teilhabechancen definiert, während Meritokratie als Prinzip der Startchancengleichheit und leistungsabhängiger Belohnung beschrieben wird. Soziale Ungleichheit wird als ungleicher Zugang zu sozialen Positionen mit unterschiedlichen Lebensbedingungen definiert. Die Kapitel legt die Grundlage für die weitere Analyse.
3. Die Meritokratie: Dieses Kapitel beschreibt das meritokratische Prinzip im Detail und bezieht sich auf Michael Youngs Werk „The Rise of Meritocracy“. Es wird erläutert, wie eine meritokratische Gesellschaft den gesellschaftlichen Status anhand von Intelligenz und Anstrengung festlegt und wie wichtig Chancengleichheit beim Erwerb von Bildungszertifikaten für die Realisierung dieses Prinzips ist. Das Kapitel legt den theoretischen Rahmen für die weitere Kritik fest.
4. Ausgewählte Kritikpunkte: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Kritikpunkte an der Meritokratie. Es beleuchtet die Ungleichheit der Startbedingungen und die Schwierigkeit, Leistung objektiv zu messen. Die Kapitel greift wichtige Einwände gegen das Ideal der Meritokratie auf und hinterfragt seine praktische Umsetzbarkeit.
5. Warum beschäftigt sich die Pädagogik mit der Meritokratie?: Dieses Kapitel untersucht, warum die Pädagogik sich mit dem Thema Meritokratie auseinandersetzen muss. Es wird dargelegt, wie eng das Bildungssystem mit der Frage nach sozialer Gerechtigkeit und Chancengleichheit verwoben ist. Die Bedeutung der Pädagogik bei der Gestaltung fairer Bildungssysteme wird hervorgehoben.
6. Die Tabuisierung von Ungleichheit in der Primarstufe und daraus resultierende Reproduktion von sozialer Ungleichheit: Dieses Kapitel analysiert, wie die Verleugnung sozialer Ungleichheit im Bildungssystem zur Reproduktion derselben Ungleichheiten führt. Es wird untersucht, wie bereits frühzeitig im Bildungssystem Ungleichheiten entstehen und sich verfestigen.
Schlüsselwörter
Meritokratie, Bildungssystem, soziale Ungleichheit, Chancengleichheit, Leistungsgerechtigkeit, Bildungszertifikate, soziale Mobilität, Reproduktion von Ungleichheit, Grundgesetz, Kritik der Meritokratie.
FAQ: Meritokratie und Bildungssystem
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das meritokratische Prinzip und seinen Einfluss auf das Bildungssystem. Sie untersucht die Funktionsweise der Meritokratie, hinterfragt deren Legitimation und analysiert die Realisierbarkeit von Chancengleichheit in diesem Kontext. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, Begriffsbestimmungen (Bildung, Meritokratie, soziale Ungleichheit), eine Beschreibung der Meritokratie, Kritikpunkte daran, die Relevanz des Themas für die Pädagogik, eine Analyse der Tabuisierung von Ungleichheit in der Primarstufe und ein Fazit.
Welche Begriffe werden in der Arbeit definiert?
Die Arbeit definiert zentrale Begriffe wie Bildung (im Kontext von Lebensführungskompetenzen und Teilhabechancen), Meritokratie (als Prinzip der Startchancengleichheit und leistungsabhängiger Belohnung) und soziale Ungleichheit (als ungleicher Zugang zu sozialen Positionen mit unterschiedlichen Lebensbedingungen).
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Funktionsweise der Meritokratie im Bildungssystem zu beleuchten, deren Legitimation zu hinterfragen und die Realisierbarkeit von Chancengleichheit in diesem Kontext zu analysieren. Ein weiterer Fokus liegt auf der Untersuchung des Zusammenhangs zwischen der Tabuisierung sozialer Ungleichheit und deren Reproduktion im Bildungssystem.
Welche Kritikpunkte an der Meritokratie werden genannt?
Die Arbeit nennt verschiedene Kritikpunkte an der Meritokratie, darunter die Ungleichheit der Startbedingungen und die Schwierigkeit, Leistung objektiv zu messen. Es wird die Frage aufgeworfen, ob das meritokratische Prinzip tatsächlich Chancengleichheit ermöglicht und ob es in der postmodernen Gesellschaft funktional ist.
Warum beschäftigt sich die Pädagogik mit der Meritokratie?
Die Arbeit erläutert, warum die Pädagogik sich mit der Meritokratie auseinandersetzen muss, da das Bildungssystem eng mit der Frage nach sozialer Gerechtigkeit und Chancengleichheit verbunden ist. Die Pädagogik spielt eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung fairer Bildungssysteme.
Wie wird die Reproduktion sozialer Ungleichheit im Bildungssystem erklärt?
Die Arbeit analysiert, wie die Verleugnung sozialer Ungleichheit im Bildungssystem, insbesondere in der Primarstufe, zur Reproduktion derselben Ungleichheiten führt. Es wird untersucht, wie Ungleichheiten frühzeitig entstehen und sich verfestigen.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit ist in sieben Kapitel gegliedert: Einleitung, Begriffsbestimmungen (mit Unterkapiteln zu Bildung, Meritokratie und sozialer Ungleichheit), Die Meritokratie, Ausgewählte Kritikpunkte, Die Relevanz der Meritokratie für die Pädagogik, Die Tabuisierung von Ungleichheit und deren Reproduktion, und Fazit.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Meritokratie, Bildungssystem, soziale Ungleichheit, Chancengleichheit, Leistungsgerechtigkeit, Bildungszertifikate, soziale Mobilität, Reproduktion von Ungleichheit, Grundgesetz, Kritik der Meritokratie.
- Citation du texte
- Calendula Weizkeim (Auteur), 2023, Meritokratie. Eine Theorie und ihr Einfluss auf das Bildungssystem, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1364978