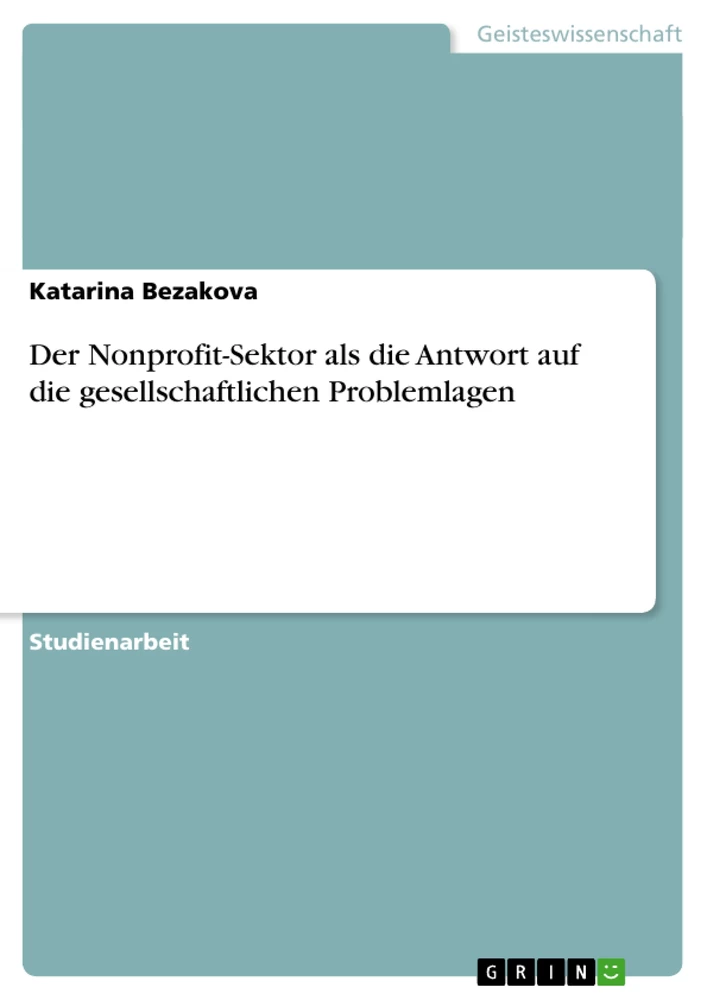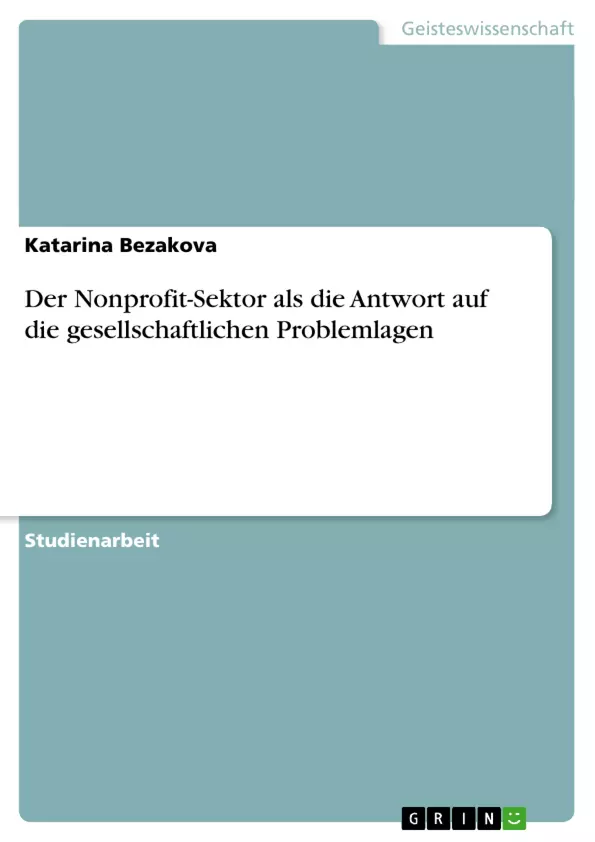Im Rahmen unseres Hauptseminars haben wir uns mit verschiedenen Aspekten des Jenseits von Markt und Staat in Deutschland beschäftigt. Zum ´Dritten Weg´ gehören unter anderem auch die Nonprofit-Organisationen und ihre Strukturen, die ich in einem Referat herausgearbeitet habe. Im Folgenden werde ich mich mit dem deutschen Nonprofit-Sektor im Verhältnis zum Staat auf der Makro-Ebene beschäftigen.
In Deutschland ist die Rede von einer Krise des Wohlfahrtsstaates. Jedoch handelt es sich nicht um das Ende des Wohlfahrtsstaates, sondern um seine Anpassung an neue Herausforderungen. In diesem Zusammenhang spricht man vom Rückzug des Staates aus der sozialen Sicherung und Wohlfahrt. Die Entstaatlichung der sozialen Sicherung scheint eine unvermeindliche Entwicklungsrichtung. Ob der Rückzug des Staates aus der Wohlfahrt zum Wachstum des Nonprofit-Sektors führt, wird der Gegenstand der weiteren Disskusion sein.
Das Ziel meiner Seminararbeit ist demnach festzustellen, was für eine Rolle der Nonprofit-Sektor im Verhältnis zum Staat spielt, um soziale Aufgaben der Gesellschaft bewältigen zu können.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Die Darstellung des Nonprofit-Sektors und des Wohlfahrtsstaates
2.1 Begriffsbestimmungen: NPOs, Dritter Sektor und Nonprofit-Sektor
2.2 Der Nonprofit-Sektor aus der historischen Perspektive
2.3 Paradoxien und Krise des Wohlfahrtsstaates
3 Der Nonprofit-Sektor im Verhältnis zum Staat: Eine gesellschaftspolitische Diskussion
3.1 Neokorporatistische Theorien und das Konzept des Funktionalen Dilletantismus
3.2 Intermediäre Organisationen und Welfare mix
3.3 Interdependenztheorie
3.4 Institutionelle Theorie
3.5 Wohlfahrtsstaattheorie
4 Der Nonprofit-Sektor als gesellschaftlicher Hoffnungsträger
4.1 Der Rückzug des Wohlfahrtstaates?
4.2 Zunehmende Bedeutung des Nonprofit-Sektors: John Hopkins Comparative Nonprofit Sector-Projekt
5 Fazit
Literaturliste.
1 Einleitung
Im Rahmen unseres Hauptseminars haben wir uns mit verschiedenen Aspekten des Jenseits von Markt und Staat in Deutschland beschäftigt. Zum ´Dritten Weg´ gehören unter anderem auch die Nonprofit-Organisationen und ihre Strukturen, die ich in einem Referat herausgearbeitet habe. Im Folgenden werde ich mich mit dem deutschen Nonprofit-Sektor im Verhältnis zum Staat auf der Makro-Ebene beschäftigen.
Der Zugang, der das Verhalten der Nonprofit-Organizationen zu erklären versucht und sich mit ihren Zielvorstellungen und Restriktionen beschäftigt, ist nicht Gegenstand dieser Seminararbeit. So werde ich im Weiteren weder auf die sozio-ökonomischen Ansätze zum Dritten Sektor näher eingehen, noch dem Dritten Sektor auf der internationalen Ebene viel Aufmerksamkeit schenken.
In Deutschland ist die Rede von einer Krise des Wohlfahrtsstaates. Jedoch handelt es sich nicht um das Ende des Wohlfahrtsstaates, sondern um seine Anpassung an neue Herausforderungen (vgl. Lessenich 2000: 65f). In diesem Zusammenhang spricht man vom Rückzug des Staates aus der sozialen Sicherung und Wohlfahrt. Die Entstaatlichung der sozialen Sicherung scheint eine unvermeindliche Entwicklungsrichtung. Ob der Rückzug des Staates aus der Wohlfahrt zum Wachstum des Nonprofit-Sektors führt, wird der Gegenstand der weiteren Disskusion sein.
Das Ziel meiner Seminararbeit ist demnach festzustellen, was für eine Rolle der Nonprofit-Sektor im Verhältnis zum Staat spielt, um soziale Aufgaben der Gesellschaft bewältigen zu können.
Um die Begrifflichkeiten des Dritten Sektors klarzumachen, werde ich diese sofort im ersten Kapitel behandeln. Von großer Wichtigkeit sind auch die geschichtlichen Hintergründe des Dritten Sektors, auf die ich in den weiteren Ausführungen näher eingehen werde. In dem dritten Punkt der ersten Kapitel werde ich mich mit dem Wohlfahrtsstaat beschäftigen. Seine Paradoxien und die sich davon ableitende Krise stehen im Mittelpunkt dieser Eröterung.
Im zweiten Kapitel werde ich das Verhältnis zwischen dem Nonprofit-Sektor und dem öffentlichen Sektor diskutieren. Anhand unterschiedlicher soziologisch-politologischer Ansätze werden allgemeine Trends erkennbar, die auf den Nonprofit-Sektor fördernd oder beeinträchtigend wirken.
Die Bezeichnung des letzten Kapitels ´Der Nonprofit-Sektor als gesellschaftliche Hoffnungsträger´ lässt schon erahnen, worum es hier geht. Trotzdem werde ich mich zunächst mit einigen Auffassungen zum Rückzug des Staates aus der sozialen Sicherung und dem Wohlfahrt auseinandersetzen. Im Anschluss werde ich die zunehmende Bedeutung des Nonprofit-Sektors für unsere Gesellschaft darlegen. Um ein empirisches Fundament zum Dritten Sektor vorzulegen, werde ich zugleich das Projekt vom Johns Hopkins Institute for Policy Studies in Baltimore, geführt von Salamon und Anheier, vorstellen.
Die Grundlage meiner Seminararbeit bilden zum einen die Bänder der Colloquien zur NPO-Forschung herausgegeben vom Blümle, Schauer, Witt und Anheier, zum anderen die Literatur zum Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Projekt von Salamon, Zimmer, Priller und anderen. Überdies habe ich noch mit den Beiträgen von Badelt, Simsa, Lessenich, Heitzmann, Nowotny und mit der neuesten Untersuchung vom Balke gearbeitet.
2 Die Darstellung des Nonprofit-Sektors und des Wohlfahrtsstaates
Die Dritter-Sektor-Forschung wurde in den 1980er Jahren etabliert. Ihr Ziel ist es, die strikt voneinander getrennten Wissenschaftsdisziplinen wieder zusammenzuführen, deren Thema die Untersuchug der Bedeutung, der Funktion und der Wirkung organisierter Interessen und kollektiver Akteure in Staat und Gesellschaft ist (vgl. Zimmer 1996: 84).
Der Gegenstand der Dritter-Sektor-Forschung bezieht sich auf die nicht-staatlichen und nicht-marktlichen Organisationen. Sie stellen eine eigenständige institutionelle Alternative gegenüber sowohl den Einrichtungen des Marktes, wie Firmen und Unternehmen, als auch denen des Staates, wie staatliche Bürokratie, dar (vgl. Zimmer 1996: 13). Dermaßen stellte auch der amerikanische Soziologe Amitai Etzioni bereits zu Anfang der 1970er Jahre die Existenz eines „third alternative, indeed sector (…) between the state and the market sector“ (Etzioni 1973: 314 zitiert nach Zimmer 1996: 85). Er hat somit schon frühzeitig auf die wirklichkeitsfremde Dichotomie von Markt und Staat hingewiesen.
Laut Zimmer kann der Dritte Sektor auch als ein Bereich abgesteckt werden, der zwischen den Polen Markt, Staat auf der einen Seite und der Familie auf der anderen Seite gespannt ist. Hierhin fallen alle diejenigen Organisationen, deren Handlungslogiken weder eindeutig dem Sektor Markt, noch dem Sektor Staat zuzuordnen sind, die aber über eine formalere Organisationsform verfügen als vergleichsweise ein Freundeskreis oder die Familie (vgl. Zimmer 1996: 84).
2.1 Begriffsbestimmungen: NPOs, Dritter Sektor und Nonprofit-Sektor
Der Begriff stammt aus den USA, wo immer noch mehr Klarheit besteht in Bezug auf den Begriff als in Europa. So wird der Begriff Dritter Sektor in Europa sowohl für den öffentlich-rechtlichen als auch für den privaten gemeinnützigen Bereich verwendet. Laut Simsa verleitet er jedoch zu einer falschen Annahme, da manche Organisationen dieses Sektors auf Märkten agieren (vgl. Simsa 2001: 77).
Mit Bezu g auf die Definition des Johns Hopkins Project sind NPOs Organisationen, die sich durch ein Mindestmaß an formaler Organisation, das Verbot der Gewinnausschüttung und die Voraussetzung privater Trägerschaft auszeichnen, sowie Selbstverwaltung im juristischen Sinn und Freiwilligkeit berücksichtigen (vgl. Salamon 1996: 13ff).
Ein ausgeprägtes Merkmal dieses Sektors ist seine Negativbezeichnung: Nonprofit-Sektor, not-for-profit, Nonprofitorganisationen, Nichtregierungsorganisationen, nichtgewinnorientierte Organisationen. Daraus kann man ableiten, was die betreffenden Organisationen nicht sind, lassen jedoch nicht darauf schliessen, was sie sind. „Wenn nicht für Profit, wofür denn dann?“ (Simsa 2001: 71).
Die Begriffe Freiwilligensektor, Dritter Sektor, autonomer Sektor, Nonprofit-Sektor und intermediärer Sektor werden synonym gebraucht. Obwohl die Begriffe NPOs und Dritter Sektor synonym gebraucht werden, bezieht sich der Begriff Dritter Sektor stärker auf die Makroebene, also auf die Gesamtheit aller organisationalen Aktivitäten zwischen den Bereichen Markt und Staat, während der Begriff NPO sich tendenziell stärker auf die Ebene der Organisation beruft (vgl. Simsa 2001: 78). In diesem Sinn werde ich auch diese Begriffe in meiner Seminararbeit benutzen.
Trotz der positiven Bezeichnung des Begriffes Dritter Sektor deutet ihn Simsa inhaltlich ebenfalls abgrenzend, als weder Markt noch Staat (vgl. Simsa 2001: 77). Dadurch kann es vorkommen, dass dem Dritten Sektor die Qualität abgesprochen wird und die diesem Sektor angehörenden Organisationen als mangelnde Organisationen bewertet werden. Der Grund dafür wäre, dass sie die eindeutige Zuordnung entweder dem Sektor Staat oder dem Sektor Markt noch nicht geschafft haben und sich erst ´auf halbem Wege´ in die eine oder andere Richtung befinden (vgl. Zimmer 1996: 85).
So sieht es auch Max Weber, der Vereine als Organisationen interpretierte, wobei er unter Organisationen ´Rationale Systeme´ verstand. Seines Erachtens befanden sich die Organisationen ´auf der Durchreise´ zu den anerkannten Organisationsformen der Unternehmung oder der staatlichen Verwaltung (vgl. Zimmer 1996: 89).
Zimmer zufolge teilen die neueren Untersuchungen diese Meinung nicht und sie selbst argumentiert dagegen. Die modernen Gesellschaften waren von Anfang an nicht auf Einseitigkeit von Markt und Staat reduziert, sondern der intermediäre Bereich zur Moderne gehört und für diese grundlegend ist. Die Segmente Staat, Markt und Dritter Sektor sind aufeinander angewiesen, um ´den Ball ins Rollen zu bringen´ , respektive das Funktionieren der Gesellschaft sicherzustellen, schliesst Zimmer ihre Idee (vgl. Zimmer 1996: 85).
2.2 Der Nonprofit-Sektor aus der historischen Perspektive
Ob Sozialdienstleistungen vom Markt, vom Dritten Sektor oder vom Staat angeboten werden, wird nicht von individuellen Nachfragern und Anbietern im Spiel der freien Kräfte auf dem Markt entschieden, wie die ökonomischen Theorien vermuten. Vielmehr sind solche Entscheidungen wesentlich von historischen Entwicklungsmustern bestimmt (vgl. Salamon 1998: 225).
Historische Perspektive ist aus zwei Gründen von großer Bedeutung. Nur in langfristiger Betrachtung sind institutionelle und strukturelle Veränderungen angemessen zu interpretieren, da sie sich in der Zeit entwickeln. Desgleichen kann die historische Betrachtung manche voreiligen Schlüsse über aktuellen Entwicklungen relativieren (vgl. Bahle 2007: 22).
Der historische Zugang kann mit den Ergebnissen von Salamon und Anheier bestätigt werden. NPOs haben tiefe historische Wurzeln in allen von ihnen untersuchten Gesellschaften. Beispielsweise die Beziehungen zwischen NPOs und der Kirche. Die NPOs waren schon seit der Reformation in den Machtkampf zwischen Kirche und weltlichen Institutionen einbezogen. In Deutschland Bismarkcs nahmen NPOs am staatlich finanzierten Sozialausbau teil, weil die Kirche einen Annäherungsversuch zum Staat einging. Wohingegen die Kirche im Machtkampf verlor, wie in Italien oder Frankreich, kann man unterstellen, dass das ehemalige kirchliche Angebot an Sozialleistungen hauptsächlich vom Staat übernommen wurde und der Dritte Sektor heute eine viel bescheidende Rolle spielt (vgl. Salamon 1998: 226).
Historische Kontingenz und nationaler Kontext sind daher wichtig, um die Entwicklungslinien der Wohlfahrtssproduktion zu erkennen. Der Beginn des Wohlfahrtsstaates in Deutschland ist auf die Herausbildung einer Vielfalt freier Träger sozialer Einrichtungen und auf städtische Sozialpolitik im 19. Jahrhunderts zurückzuführen. „Die historisch entwickelte Kooperation zwischen Städten und freien Trägerorganisationen lieferte die Grundlage für die schließlich in der Weimarer Republik erfolgte Institutionalisierung eines dualen Dienstleistungssystems unter dem Leitgedanken der Subsidiarität“ (Bahle 2007: 211). In Deutschland konnten die kommunalen und sozialen Einrichtungen eine große Eigenständigkeit entfalten, wodurch eine Vielfalt an sozialen Einrichtungen entstand.
Diese rasche Entwicklung wurde von einer langen Stagnationsphase abgelöst, die vom Ersten Weltkrieg bis zum Ende der 1960er Jahre anhielt (vgl. Bahle 2007: 287).
Seit dem Beginn der 1970er Jahre erlebte der Nonprofit-Sektor einen Aufschwung, der in 1980er Jahren gebremst wurde, aber immer noch anhielt (vgl. Bahle 2007: 287). Seit dieser Zeit war der Wohlfahrtsstaat mehreren Umbauten und Reformen ausgesetzt.
In diesem Zusammenhang nennt Bahle zwei historische Phasen des Wohlfahrtsstaates. Die erste Phase war der Beginn des Wohlfahrtsstaates und seine Expansion in andere gesellschaftliche Bereiche. Die unterschiedlichen Formen der sozialen Arbeitsteilung manifestierten sich zwischen den verschiedenen Akteuren der Wohlfahrtsproduktion. In der zweiten Phase, die seit den 1980er Jahren einsetzt, geht es um eine Veränderung in der sozialen Arbeitsteilung. Jedoch ist es diesmal nicht die Expansion, die die Richtung für diese Veränderung vorgibt, sondern der Rückzug des Wohlfahrtsstaates, nicht Standardisierung und Zentralisierung, sondern Flexibilisierung und Dezentralisierung, nicht die Ausdehnung der sozialen Rechte, sondern die Individualisierung von Risiken, und nicht Verstaatlichung, sondern Privatisierung (vgl. Bahle 2007: 21).
Gemäß Anheier ist der Nonprofit-Sektor in den vergangenen Jahrzehnten bedeutend gewachsen und wird auch in Zukunft noch weiter wachsen. Mit dem Aufschwung der deutschen Wirtschaft von einer industriellen zu einer post-industriellen Wirtschaft entwickelte sich auch der Nonprofit-Sektor. Der Sektor richtet sich jedoch immer noch nach Prinzipien, die aus der industriellen Ära stammen und auf das späte 19. Jahrhundert zurückgehen. Daraus folgt eine bestimmte Gegenseitigkeit des Nonprofit-Sektors. Er erlangte zwar eine immer größere wirtschaftliche Bedeutung, aber die politisch entscheidenden Kräfte des Dritten Sektors, also die Freien Wohlfahrtsverbände, halten am Status quo fest, der sich immer weniger mit den neuen sozialen und politischen Herausforderungen vereinbaren lässt (vgl. Anheier 1998a: 70).
2.3 Paradoxien und Krise des Wohlfahrtsstaates
Nicht nur die historischen Hintergründe, sondern auch der Wohlfahrtsstaat und seine Funktionen spielen eine entscheidende Rolle bei dem Nonprofit-Sektor und seiner Entwicklung.
Laut Lessenich ist der Wohlfahrtsstaat, „eine bestimmte Form gesellschaftlicher Organisation, die gekennzeichnet ist durch die Verbindung von demokratischer Staatsform und privatkapitalistischer Wirtschaftsform mit einem ausgebauten, zentralstaatlich regulierten Sozialsektor, auf dessen Leistungen ein staatlich verbürgter Anspruch nach rechtlich definierten Bedarfskriterien für jedermann besteht“ (Lessenich 2000: 40f). So gesehen steht der Begriff des Wohlfahrtstaates nicht nur für eine Ansammlung staatlicher Institutionen und Praktiken, sondern die marktwirtschaftlichen Zusammenhänge stehen gleichzeitig im Mittelpunkt. Man gewinnt den Eindruck, dass es hier hauptsächlich um die zwei gesellschaftlichen Sektoren Staat und Markt geht, wobei der Nonprofit-Sektor und der informeller Bereich der Familie ausgeschlossen werden. Es geht lediglich darum, die richtige Balance zwischen den beiden genannten Sektoren zu finden, die den Wohlfahrtsstaat selbst regulieren können.
Die Definition nach Girvetz, die Balke auch befürwortet, lautet, wie folgt: „The welfare state is the insitutional outcome of a society´s assumption of legal and therefore formal and explicit responsibility for the basic well-being of all ist members“ (Bahle 2007: 18).
Für Balke sind hier vier Elemente von Bedeutung: ´institutional outcome´ als institutionell ausgeformte Arrangements des Wohlfahrtsstaates, ´formal responsibilities´ als die sozialen Rechte, ´individual wellbeing´ als der individuelle Wohlfahrt und ´of all ist members´ als Inklusion aller Gesellschaftsmitglieder. Der Schwerpunkt liegt hier bei dem Individuum und seinem Wohlergehen in der Gesellschaft.
Diese zwei Definitionen des Wohlfahrtsstaates legen Wert auf unterschiedliche Bereiche. Es ist fast nicht zu erkennen, wenn man den Begriff des Wohlfahrtsstaates außen vor lässt, dass es sich um das gleiche Phänomen handelt. So umstritten, wie diese Definitionen sind, ist der Wohlfahrtsstaat auch selbst.
Wohlfahrtsstaaten sind multifunktionale Gebilde. Sowohl die Funktionen, wie auch die Wirkungen, die vom Wohlfahrtsstaat und seinen Interventionen ausgehen, sind sehr vielfältig. Politik, Ökonomie, Gesellschaft – sie alle werden durch wohlfahrtsstaatliches Handeln beeinflusst. Lessenich erwähnt drei zentrale Funktionskomplexe moderner Wohlfahrtsstaaten:
Sozialer Wirkungsbereich hat die Wohlfahrtsproduktion zur Funktion. Die intendierten Effekte des sozialen Wirkungsbereichs sind die Gleichheit und Inklusion, was bedeutet, die sozio-ökonomische Stellung sozial benachteiligter Individuen und Gruppen zu verbessern. Bei der Wohlfahrtsproduktion werden jedoch auch die nicht intendierten Effekte, wie neue Ungleichheiten und Exklusion, erzeugt. Ähnlich verhält es sich mit dem politischen Wirkungsbereich, dessen Hauptfunktion die Legitimation ist. Seine intendierten Effekte sind Loyalität und Berechtigung, wobei die nicht intendierten Effekte Entmündigung und Entpflichtung sind. Der ökonomische Wirkungsbereich verhält sich auch nicht anders. Marktregulierung ist seine Hauptfunktion. Zu den intendierten Effekten gehört Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit und zu den nicht intendierten Effekten Ineffizienz und Wettbewerbshemmnisse (vgl. Lessenich 2000: 60ff).
An dieser Beschreibung der Funktionen der Wohlfahrtsstaaten ist es zu erkennen, dass sie sich durch ein paradoxes Phänomen auszeichnen, und zwar, dass sie nicht nur die beabsichtigten Wirkungen, sondern zugleich immer auch entgegengesetzte Folgen auslösen - paradoxe Effekte wohlfahrtsstaatlicher Intervention. Die Widersprüchlichkeit ist in dem multifunktionalen Charakter des Wohlfahrtsstaates zu suchen (vgl. Lessenich 2000: 60ff).
Daraus wird ersichtlich, dass wohlfahrtsstaatliche Paradoxien zur Entstehung neuer sozialer Probleme führen können, wie zum Beispiel institutionell erzeugter Armut. Sieht man den Wohlfahrtsstaat daher als institutionalisierten Mechanismus gesellschaftlicher Inklusion an, so sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass dieser Mechanismus untrennbar mit Prozessen der sozialen Abgrenzung nach außen, gegenüber anderen Gesellschaften, und Ausgrenzung im Innern der Gesellschaft einhergeht (vgl. Lessenich 2000: 62).
Die wohlfahrtsstaatliche Intervention wird daher oft an den Pranger gestellt. Zum einen kann der Wohlfahrtsstaat auf Dauer wegen seiner Funktion des Marktregulierers zu einer untragbaren Belastung der kapitalistischen Ökonomie werden (vgl. Lessenich 2000: 63). Wohlfahrtsstaatliche Eingriffe, wie Sozialfürsorgeleistungen, gelten hier als Hemmnisse und werden als Standortrisiko bezeichnet. Sie werden als ´politics against markets´ empfunden. Dem Wohlfahrtsstaat wird die Aufgabe zugeschrieben, die entfesselten Marktkräfte politisch einzugehen und die selbstregulierende Ökonomie wieder gesellschaftlich einzubetten (vgl. Lessenich 2000: 65).
Zum anderen wird auch Überbeanspruchung des Wohlfahrtsstaatsbürgers und seine Solidaritätsfähigkeit festgestellt. „Der Wohlfahrtsstaat als allumfassender Versorgungsstaat trockne systematisch die individuellen und kollektiven Selbsthilfepotenziale aus, er verwehre seinen Bürgern die elementarsten Möglichkeiten sozialer Selbstbestimmung, sei bevormundend und entmündigend“ (Lessenich 2000: 64).
Wohlfahrtsstaatskeptiker verweisen daher auf die vielfältigen, mikro- wie makroökonomisch negativen Konsequenzen wohlfahrtsstaatlicher Intervention (vgl. Lessenich 2000: 63).
Die westeuropäischen Wohlfahrtsstaaten sehen sich also zunehmend mit den Paradoxien zwischen einer globalisierten, international offenen Ökonomie und den nationalstaatlich geschlossenen Institutionen der sozialen Sicherung konfrontiert. Der Wohlfahrtsstaat versucht markterzeugte Unsicherheiten zu kompensieren. Es ist aber schwierig, Sicherheit zu erzeugen und zugleich eine ökonomische Öffnung nationaler Wirtschaften und eine Globalisierung zu schaffen. Dies geht nur mit Unsicherheiten und Brüchen einher.
Denkt man an die widersprüchlichen Wirkungen wohlfahrtsstaatlicher Politik, ist es nicht verwunderlich, wenn Lessenich in seinen Ausführungen behauptet, dass sich der Wohlfahrtsstaat fast immer in einer Krise befindet. Der tradierte Wohlfahrtsstaat hat Schwierigkeiten, seine Strukturen an die veränderten politischen, ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen anzupassen (vgl. Lessenich 2000: 65).
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Nonprofit-Sektor (NPO)?
NPOs sind private Organisationen, die nicht gewinnorientiert arbeiten, sich selbst verwalten und oft im Bereich der sozialen Sicherung tätig sind.
Warum spricht man von einer Krise des Wohlfahrtsstaates?
Durch den Rückzug des Staates aus der sozialen Sicherung entstehen Lücken, die der Nonprofit-Sektor zunehmend füllen muss (Welfare Mix).
Welche Rolle spielt die Interdependenztheorie?
Diese Theorie besagt, dass Staat und NPOs aufeinander angewiesen sind, um gesellschaftliche Aufgaben effizient zu bewältigen.
Was ist das Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector-Projekt?
Es ist ein bedeutendes Forschungsprojekt, das die zunehmende wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung des Dritten Sektors empirisch belegt.
Ist der Dritte Sektor nur eine 'Notlösung'?
Nein, moderne Ansätze sehen den intermediären Sektor als grundlegenden Bestandteil der Gesellschaft, der zwischen Markt und Staat vermittelt.
- Arbeit zitieren
- Katarina Bezakova (Autor:in), 2008, Der Nonprofit-Sektor als die Antwort auf die gesellschaftlichen Problemlagen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/136514