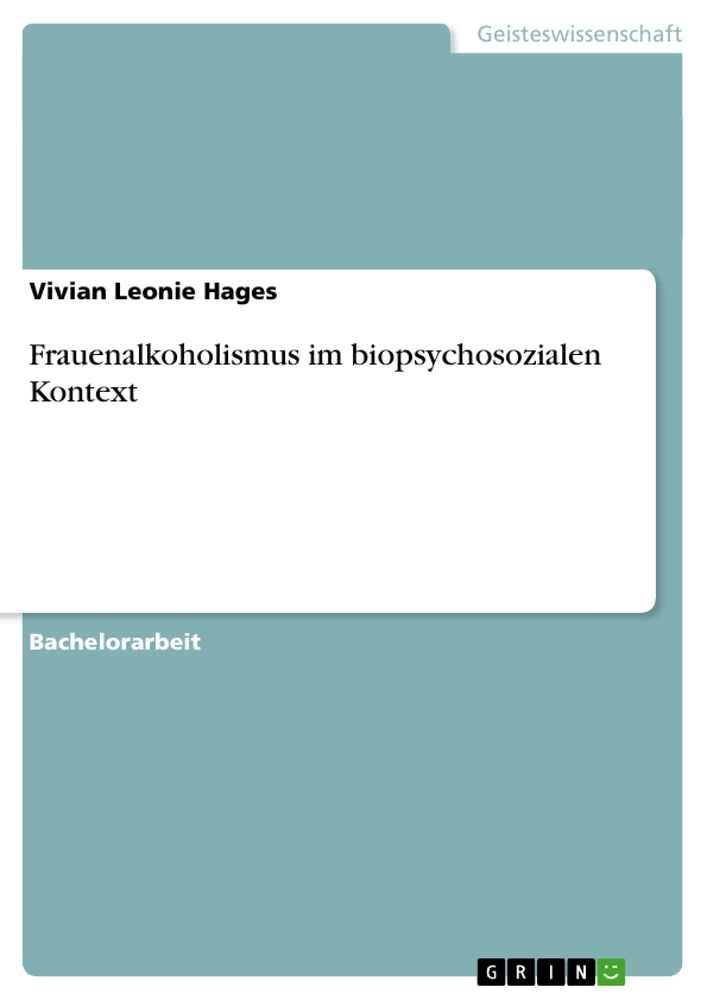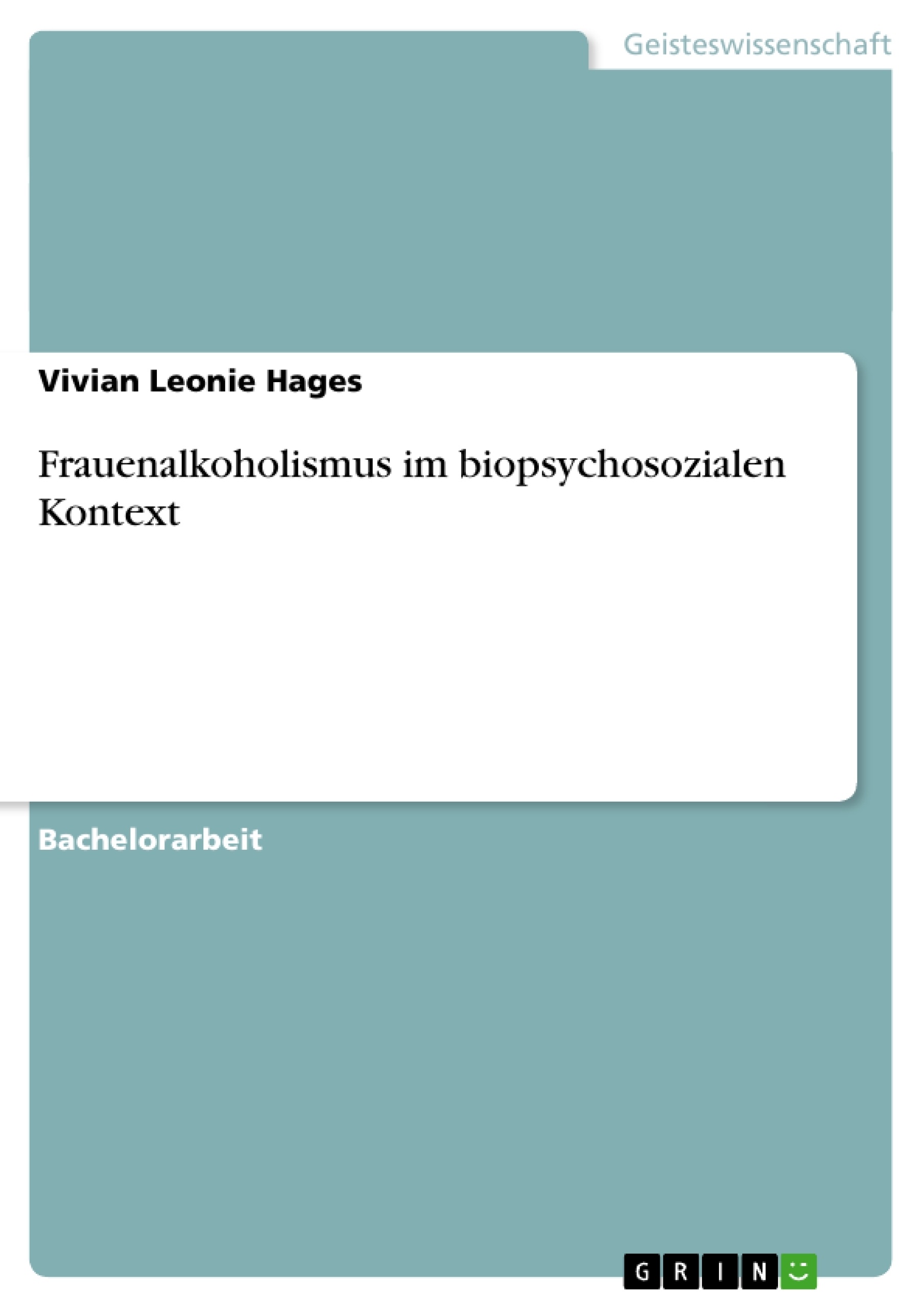In der Bundesrepublik Deutschland liegt der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch bei etwa zehn Litern reinen Alkohols, was im internationalen Vergleich einen Hochkonsum darstellt (vgl. Bätzing, 2009, S. 38; Kruse / Körkel / Schmalz, 2000, S. 92 f.). Der Anteil der alkoholabhängigen Menschen macht etwa drei bis fünf Prozent der Gesamtbevölkerung aus und stellt damit ein großes sozialmedizinisches Problem dar (vgl. Hell et al., 2007, S. 80). Männer sind wesentlich häufiger von dieser Krankheit betroffen, doch der Anteil der Frauen hat in den letzten Jahrzehnten drastisch zugenommen. Während der Anteil der Frauen 1960 noch auf ein Zehntel geschätzt wurde, geht man heute von etwa einem Drittel aus (vgl. Vogt, 2004, S. 33). In Anbetracht der zahlenmäßigen Überlegenheit der Männer und der Zunahme alkoholabhängiger Frauen stellen sich mehrere Fragen, auf die ich in dieser Arbeit unter anderem eingehen möchte:
Welche Einflussfaktoren bedingen die geringere Anzahl abhängiger Frauen? Wie kommt es zur Zunahme des Frauenalkoholismus? Warum und auf welche Weise trinken sie? Welche Frauen sind besonders betroffen? Welchen Platz nimmt die Frau im Zusammenhang mit Alkohol in unserer Gesellschaft ein? Was unterscheidet sie von den Männern? Was haben die Geschlechter gemeinsam? Welche Faktoren schützen vor einer Abhängigkeit, welche bergen Risiken? Welche Entwicklung ist derzeit beim Alkoholkonsum von Frauen zu beobachten? Welche Besonderheiten ergeben sich für die Behandlung alkoholabhängiger Frauen?
(...)
Ich werde zunächst in Kapitel zwei erläutern, was unter Alkoholismus zu verstehen ist. Zudem gehe ich auf die biologischen Grundlagen in Bezug auf die Krankheit ein, wobei der Schwerpunkt auf der Genetik und den Besonderheiten des weiblichen Organismus liegt.
In Kapitel drei geht es vor allem um den Einfluss des sozialen Umfeldes, wie gesellschaftliche Wert- und Normvorstellungen, Schichtzugehörigkeiten, Erziehungsstile etc., die das Konsumverhalten von Frauen beeinflussen können.
Kapitel vier beschäftigt sich mit dem Krankheitsbild sowie den psychischen, sozialen und physischen Folgen des Alkoholismus.
Das fünfte Kapitel widmet sich der Therapie des Alkoholismus sowie der Sozialen Arbeit mit suchtkranken Menschen und den möglichen Problematiken des Berufsfeldes, welche im Anhang anhand eines Beispiels verdeutlicht werden sollen.
Schließlich ziehe ich in Kapitel sechs ein Fazit, in dem ich noch einmal die wesentlichsten Aussagen meiner Arbeit benenne.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Alkoholismus unter Berücksichtigung frauenspezifischer Aspekte
- 2.1 Der Begriff des Alkoholismus
- 2.2 Biologische Grundlagen
- 2.2.1 Familienstudien
- 2.2.1.1 Zwillingsstudien
- 2.2.1.2 Adoptionsstudien
- 2.2.1.3 Studien zu Risikopopulationen
- 2.2.2 Genetisch und nicht genetisch determinierte Enzyme
- 2.2.3 Tierversuche
- 2.2.3.1 Die Suche nach dem Suchtgedächtnis
- 2.2.4 Genetische bedingte Besonderheiten der Frau
- 2.2.1 Familienstudien
- 3. Die Rolle des sozialen Umfeldes im Hinblick auf den Alkoholkonsum von Frauen
- 3.1 Die Stigmatisierung der trinkenden Frau
- 3.1.1 Folgen der Stigmatisierung
- 3.2 Schichtspezifische Auffälligkeiten der Geschlechter
- 3.3 Erziehungsstil der Eltern
- 3.4 Besonderheiten der Partnerschaftsbeziehungen trinkender Frauen
- 3.5 Der Konsum von Jugendlichen heute
- 3.5.1 Drogen- und Suchtbericht 2009
- 3.6 Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit von Frauen
- 3.6.1 Wechselwirkungen von Alkohol und Medikamenten
- 3.1 Die Stigmatisierung der trinkenden Frau
- 4. Das Krankheitsbild – Folgen des Alkoholismus
- 4.1 Trinkmuster
- 4.1.1 Typologie nach Jellinek
- 4.1.2 Trinkmuster der Frau
- 4.2 Folgen des Alkoholismus
- 4.2.1 Komorbidität mit psychischen Störungen
- 4.2.2 Soziale Folgen
- 4.2.2.1 Berufliche Beeinträchtigung
- 4.2.2.2 Familiäre Beeinträchtigung
- 4.2.3 Folge- und Begleiterkrankungen
- 4.2.3.1 Alkoholvergiftung
- 4.2.3.2 Alkoholentzugssyndrom
- 4.2.3.3 Alkoholdelir
- 4.2.3.4 Kognitive Beeinträchtigungen
- 4.2.3.5 Wernicke-Korsakow-Enzephalopathie
- 4.2.3.6 Organische Wesensveränderung
- 4.2.3.7 Alkoholhalluzinose
- 4.2.3.8 Alkoholparanoia
- 4.2.3.9 Sonstige körperliche Folgeerkrankungen
- 4.2.4 Mortalitätsrate
- 4.2.5 Alkohol in der Schwangerschaft
- 4.2.5.1 Alkoholembryopathie
- 4.1 Trinkmuster
- 5. Therapie und Hilfe
- 5.1 Salutogenese-Modell
- 5.2 Therapieansatz
- 5.2.1 Kontaktphase
- 5.2.2 Entgiftung
- 5.2.3 Entwöhnung
- 5.2.3.1 Rückfallprävention durch medikamentöse Behandlung
- 5.2.4 Nachsorge
- 5.2.5 Vor- und Nachteile einer frauenspezifischen Behandlung
- 5.3 Soziale Arbeit mit Suchtkranken
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht den Frauenalkoholismus im biopsychosozialen Kontext. Ziel ist es, die aktuelle Situation und die Entwicklung des Frauenalkoholismus zu beleuchten, die geringere Anzahl abhängiger Frauen im Vergleich zu Männern zu erklären und die Zunahme in den letzten Jahrzehnten zu analysieren. Die Arbeit betrachtet biologische, soziale und psychische Faktoren.
- Biologische Grundlagen des Alkoholismus bei Frauen
- Einfluss des sozialen Umfelds auf den Alkoholkonsum von Frauen
- Folgen des Alkoholismus bei Frauen (körperlich, psychisch, sozial)
- Therapieansätze und Behandlungsmöglichkeiten
- Spezifische Aspekte der sozialen Arbeit mit sucht kranken Frauen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt den hohen Alkoholkonsum in Deutschland dar und hebt die Zunahme des Frauenalkoholismus hervor. Sie benennt zentrale Forschungsfragen der Arbeit, die sich mit den Einflussfaktoren, der Entwicklung und den Besonderheiten des Frauenalkoholismus befassen. Das biopsychosoziale Modell wird als theoretischer Rahmen eingeführt, der die komplexen Wechselwirkungen zwischen individuellen, sozialen und biologischen Faktoren betont.
2. Alkoholismus unter Berücksichtigung frauenspezifischer Aspekte: Dieses Kapitel definiert den Begriff Alkoholismus und beleuchtet die biologischen Grundlagen der Erkrankung. Es werden genetische Faktoren, Unterschiede im weiblichen Organismus im Vergleich zu Männern und Ergebnisse von Familien-, Zwillings- und Adoptionsstudien diskutiert, um den genetischen Einfluss auf die Entwicklung des Alkoholismus zu verdeutlichen. Tierversuche im Zusammenhang mit dem Suchtgedächtnis werden ebenfalls thematisiert. Der Fokus liegt auf der Frage nach den biologischen Besonderheiten, die den Frauenalkoholismus beeinflussen können.
3. Die Rolle des sozialen Umfeldes im Hinblick auf den Alkoholkonsum von Frauen: Kapitel drei konzentriert sich auf die soziokulturellen Faktoren. Die Stigmatisierung der trinkenden Frau und deren Folgen werden analysiert, ebenso wie schichtspezifische Unterschiede und der Einfluss des Erziehungsstils. Partnerschaftsbeziehungen alkoholabhängiger Frauen und der Alkoholkonsum von Jugendlichen werden ebenfalls thematisiert, unter Einbezug des Drogen- und Suchtberichts 2009. Schließlich wird die Problematik der Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit bei Frauen sowie die Wechselwirkungen zwischen Alkohol und Medikamenten diskutiert. Der Schwerpunkt liegt auf der Darstellung des komplexen Zusammenspiels zwischen gesellschaftlichen Normen, sozialen Beziehungen und dem Alkoholkonsum von Frauen.
4. Das Krankheitsbild – Folgen des Alkoholismus: Dieses Kapitel beschreibt das Krankheitsbild des Alkoholismus und seine Folgen. Verschiedene Trinkmuster und die Typologie nach Jellinek werden erläutert, sowie die spezifischen Trinkmuster von Frauen. Es werden die psychischen, sozialen und körperlichen Folgen im Detail dargestellt, inklusive Komorbiditäten mit psychischen Störungen, beruflichen und familiären Beeinträchtigungen und diversen Folge- und Begleiterkrankungen (Alkoholvergiftung, Alkoholentzugssyndrom, Alkoholdelir, kognitive Beeinträchtigungen, Wernicke-Korsakow-Enzephalopathie, organische Wesensveränderung, Alkoholhalluzinose, Alkoholparanoia und sonstige körperliche Folgeerkrankungen). Die Mortalitätsrate und die Auswirkungen von Alkoholmissbrauch in der Schwangerschaft (Alkoholembryopathie) werden ebenfalls behandelt.
5. Therapie und Hilfe: Das letzte Kapitel befasst sich mit Therapie- und Hilfsangeboten. Das Salutogenese-Modell wird als Ansatz zur Förderung der Gesundheit erläutert. Es wird ein Therapieansatz vorgestellt, der die Phasen Kontaktphase, Entgiftung, Entwöhnung (inklusive Rückfallprävention), und Nachsorge umfasst. Vor- und Nachteile frauenspezifischer Behandlungen werden diskutiert und der Beitrag der Sozialen Arbeit in der Suchtkrankenhilfe beleuchtet. Das Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die Behandlung von Frauenalkoholismus.
Schlüsselwörter
Frauenalkoholismus, Biopsychosoziales Modell, Genetik, Soziales Umfeld, Stigmatisierung, Trinkmuster, Folgen des Alkoholismus, Therapie, Soziale Arbeit, Komorbidität, Rückfallprävention, frauenspezifische Behandlung.
Häufig gestellte Fragen (FAQs): Frauenalkoholismus - Biopsychosoziale Perspektiven
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Bachelorarbeit untersucht den Frauenalkoholismus aus einer biopsychosozialen Perspektive. Sie beleuchtet die aktuelle Situation und Entwicklung des Frauenalkoholismus, erklärt die geringere Anzahl abhängiger Frauen im Vergleich zu Männern und analysiert die Zunahme in den letzten Jahrzehnten. Die Arbeit betrachtet biologische, soziale und psychische Faktoren.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Alkoholismus unter Berücksichtigung frauenspezifischer Aspekte (inkl. biologischer Grundlagen), Die Rolle des sozialen Umfeldes, Das Krankheitsbild und Folgen des Alkoholismus, Therapie und Hilfe, sowie ein Fazit. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte des Frauenalkoholismus, beginnend mit der Definition des Begriffs und der Darstellung biologischer Einflussfaktoren, über die Analyse sozialer und kultureller Einflüsse bis hin zu den Folgen der Erkrankung und den verfügbaren Therapieansätzen.
Welche biologischen Faktoren werden betrachtet?
Das zweite Kapitel befasst sich eingehend mit den biologischen Grundlagen. Es werden genetische Faktoren (Familien-, Zwillings- und Adoptionsstudien), Unterschiede im weiblichen Organismus im Vergleich zu Männern und Ergebnisse von Tierversuchen diskutiert, um den genetischen Einfluss auf die Entwicklung des Alkoholismus zu verdeutlichen. Genetisch und nicht genetisch determinierte Enzyme sowie genetisch bedingte Besonderheiten der Frau werden thematisiert.
Welche Rolle spielt das soziale Umfeld?
Kapitel drei konzentriert sich auf soziokulturelle Faktoren. Die Stigmatisierung der trinkenden Frau und deren Folgen werden analysiert, ebenso wie schichtspezifische Unterschiede, der Einfluss des Erziehungsstils, Partnerschaftsbeziehungen alkoholabhängiger Frauen und der Alkoholkonsum von Jugendlichen (unter Einbezug des Drogen- und Suchtberichts 2009). Die Problematik der Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit bei Frauen und die Wechselwirkungen zwischen Alkohol und Medikamenten werden ebenfalls behandelt.
Welche Folgen hat Frauenalkoholismus?
Kapitel vier beschreibt das Krankheitsbild und dessen Folgen. Verschiedene Trinkmuster und die Typologie nach Jellinek werden erläutert, sowie die spezifischen Trinkmuster von Frauen. Es werden die psychischen, sozialen und körperlichen Folgen detailliert dargestellt, inklusive Komorbiditäten mit psychischen Störungen, beruflichen und familiären Beeinträchtigungen und diversen Folge- und Begleiterkrankungen (Alkoholvergiftung, Alkoholentzugssyndrom, Alkoholdelir, kognitive Beeinträchtigungen, Wernicke-Korsakow-Enzephalopathie, organische Wesensveränderung, Alkoholhalluzinose, Alkoholparanoia und sonstige körperliche Folgeerkrankungen). Die Mortalitätsrate und die Auswirkungen von Alkoholmissbrauch in der Schwangerschaft (Alkoholembryopathie) werden ebenfalls behandelt.
Welche Therapieansätze werden vorgestellt?
Kapitel fünf befasst sich mit Therapie- und Hilfsangeboten. Das Salutogenese-Modell wird als Ansatz zur Förderung der Gesundheit erläutert. Ein Therapieansatz wird vorgestellt, der die Phasen Kontaktphase, Entgiftung, Entwöhnung (inklusive Rückfallprävention) und Nachsorge umfasst. Vor- und Nachteile frauenspezifischer Behandlungen werden diskutiert und der Beitrag der Sozialen Arbeit in der Suchtkrankenhilfe beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Frauenalkoholismus, Biopsychosoziales Modell, Genetik, Soziales Umfeld, Stigmatisierung, Trinkmuster, Folgen des Alkoholismus, Therapie, Soziale Arbeit, Komorbidität, Rückfallprävention, frauenspezifische Behandlung.
Welches Modell dient als theoretischer Rahmen?
Das biopsychosoziale Modell dient als theoretischer Rahmen, um die komplexen Wechselwirkungen zwischen individuellen, sozialen und biologischen Faktoren zu betonen, die den Frauenalkoholismus beeinflussen.
- Quote paper
- Vivian Leonie Hages (Author), 2009, Frauenalkoholismus im biopsychosozialen Kontext, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/136662