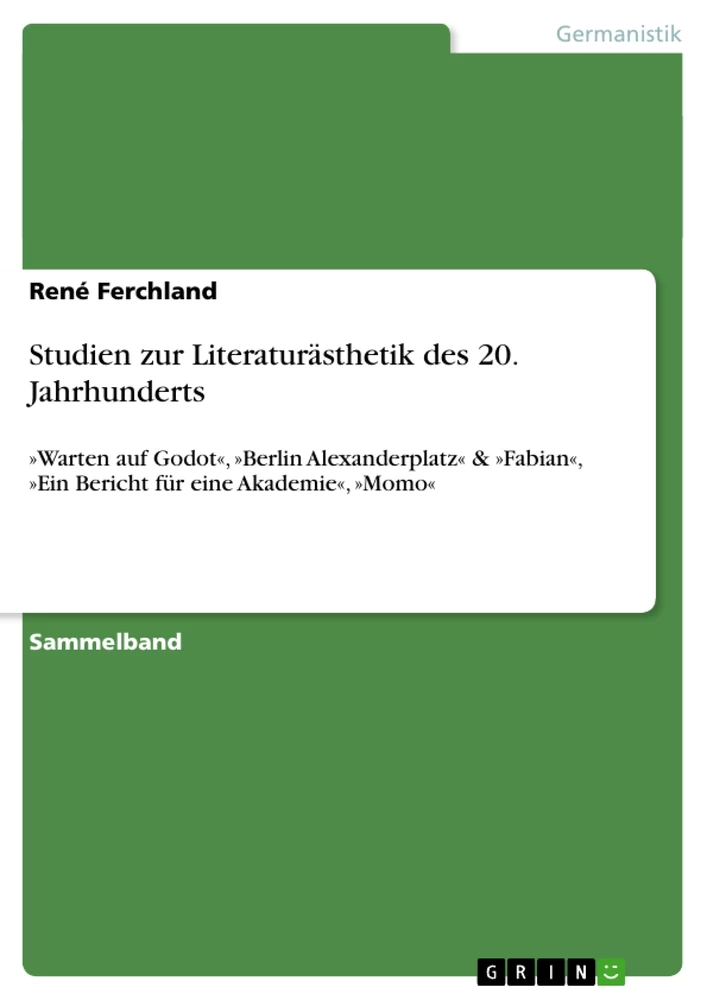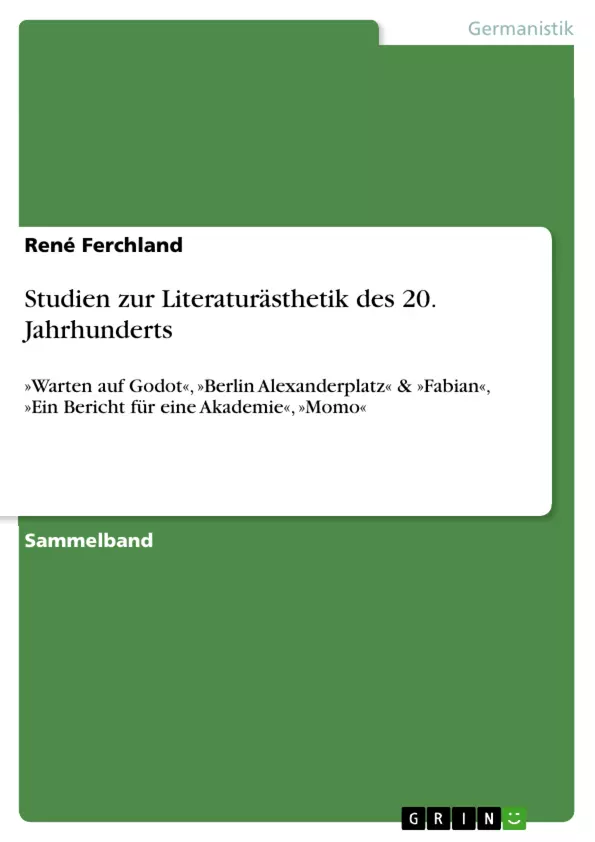I Absenz oder das Nichts – ontologische Ansätze zur Verortung des Unbestimmten in »Warten auf Godot«
Zuerst wird das Augenmerk auf das gerichtet, was denn im Text vorfindbar und dementsprechend bestimmbar ist, d.h. welche Konstanten, welche Elemente des »präsenten« »Etwas« vorhanden sind. An diesem Punkt werden noch die Erkenntnisse aus der klassischen Dramenanalyse ausreichen, doch wenn es in den Bereich des Unbestimmten hinübergeht, scheinen die Begriffe und Erklärungen zu den Kategorien von Figurenidentität, Raum und Zeit, sowie zum Geschehen nicht mehr zu tragen.
II Berlin in der Neuen Sachlichkeit - »Berlin Alexanderplatz« und »Fabian«
In dieser Studie wird das Hauptaugenmerk auf die Großstadtdarstellung in der Neuen Sachlichkeit gerichtet. War Berlin in den zwanziger Jahren so, wie man es in Döblins Buch lesen kann? Hatte er vielleicht nur eine spezielle, andere Wahrnehmung? Dazu wird das Licht auch auf den Menschen Döblin (1878-1957) und seine Verwobenheit mit der Hauptstadt geworfen.
Zudem war dieser Autor nicht der einzige, der sich mit dem Motiv beschäftigte – um ein objektiveres Bild zu erhalten, soll noch Erich Kästners (1899-1974) Fabian herangezogen werden.
III Assimilationstendenzen und Selbstdressur in Franz Kafkas »Ein Bericht für eine Akademie«
Es sind vielerlei Allegorien in die Entwicklung der Hauptfigur von der unterentwickelten Spezies zum gelehrigen Affen bis hin zum Akademischen Affen in den Bericht hineininterpretiert worden, die für sich und im Zuge der Kafka-Forschung von Bedeutung sind, in dieser hier vorliegenden Untersuchung allerdings kritisch betrachtet und auch nur gestreift werden sollen. Es sind die textimmanenten Tendenzen und Momente der Assimilation, die hier im Mittelpunkt stehen werden, um zu hinterfragen, was der Text Kafkas aus sich selbst heraus zur Assimilationsthematik offenbart.
IV »Momo« - ein Kunstmärchen?
In dieser Studie soll untersucht werden, ob es sich bei „Momo“ ganz und gar um ein „Kunstmärchen“ handeln könnte und ob es sich damit direkt neben etablierte Kunstmärchen wie beispielsweise die eines Tiecks oder Hofmannsthals in eine Reihe stellen kann. Die Idee, dieses Werk Michael Endes als Kunstmärchen zu betrachten, ist nicht abwegig – das wird die folgende Darstellung zeigen, die sich an der von Paul-Wolfgang Wührl entworfenen Poetologie des Kunstmärchens orientiert.
Inhaltsverzeichnis
- Absenz oder das Nichts – Ontologische Ansätze zur Verortung des Unbestimmten in Becketts »Warten auf Godot«
- Godot: Nichts als etwas auf der Bühne
- Blick auf den Forschungsstand
- Das Bestimmte – Konstanten im Text
- Konstanten in der Identität der Figuren
- Konstanten in der Figurenrede
- Konstanten in den Gegenständen, dem Raum und der Zeit
- Konstanten im Geschehen auf dem Schauplatz
- Die Konstante Godot
- Vom Bestimmten zum Unbestimmten
- Ontologische Annäherung an das »Nichts«
- Ontologische Annäherung an die »Absenz«
- Das Unbestimmte – Absenz oder Nichts im Text
- Absenz oder das Nichts in der Identität der Figuren
- Absenz oder das Nichts in der Figurenrede
- Absenz oder das Nichts in Gegenständen, Raum und Zeit
- Absenz oder das Nichts im Geschehen auf dem Schauplatz
- Absenz oder das Nichts in der Godot-Instanz
- Godot – Eine omnipräsente Absenz bis zum Schluss
- Berlin in der Neuen Sachlichkeit – »Berlin Alexanderplatz« und »Fabian«
- Einführung
- Die Neue Sachlichkeit und Berlin
- Die Wirkungskraft Berlins
- Döblin, der Döblinsche Stil und Berlin
- Kästner und Berlin
- Berlin in der Neuen Sachlichkeit
- Personifikation der Stadt versus Depersonation des Menschen
- Dokumentarismus und Reportagestil
- Neue Grenzen der Sachlichkeit
- Zur Sinn- und Zweckmäßigkeit der Großstadtmotivik
- Assimilationstendenzen und Selbstdressur in Franz Kafkas »Ein Bericht für eine Akademie«
- Einführung
- Erste Einschätzung über die Identität des Berichtenden
- Hintergründe: Quellentexte und Intention Kafkas
- Quellentexte für den Bericht
- Zur Intention Kafkas
- Assimilationsmomente und -tendenzen
- Chronologie der Assimilation
- Interferenz-Erscheinungen im Assimilationsbestreben
- Abschließende Einschätzung über die Identität des Berichtenden
- Michael Endes »Momo« – Ein Kunstmärchen?
- Einführung
- Das Wunderbare: Zur Poetologie »Momos«
- Zur Wirklichkeitsauffassung Michael Endes
- Das Arsenal des Wunderbaren
- Die Textur
- Raum und Zeit
- Personal und Konstellationen des Wunderbaren
- Schauplätze des Wunderbaren
- »Momo« als phantastische Erzählung
- Pro phantastische Erzählung
- Contra phantastische Erzählung
- Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert ausgewählte literarische Texte des 20. Jahrhunderts, um verschiedene literarische Techniken und deren Wirkung zu untersuchen. Der Fokus liegt auf der Darstellung von Unbestimmtheit, der Neuen Sachlichkeit in der Darstellung Berlins und der Thematik der Assimilation und Selbstfindung.
- Darstellung von Unbestimmtheit und Absenz in der Literatur
- Die Neue Sachlichkeit und ihre Darstellung der Großstadt Berlin
- Assimilationsprozesse und Selbstfindung
- Die Gattungszuordnung von Michael Endes "Momo"
- Literarische Techniken der Charakterisierung und Erzählperspektive
Zusammenfassung der Kapitel
Absenz oder das Nichts – Ontologische Ansätze zur Verortung des Unbestimmten in Becketts »Warten auf Godot«: Dieses Kapitel analysiert Samuel Becketts "Warten auf Godot" im Hinblick auf die omnipräsente Unbestimmtheit und Abwesenheit zentraler Elemente. Es untersucht die Figuren, ihre Dialoge und Handlungen, den Raum und die Zeit, sowie die rätselhafte Figur Godot selbst. Durch ontologische Ansätze (Präsenz/Absenz, Nichts/Etwas) wird versucht, die spezifische Wirkungsästhetik des Stücks zu erklären, die aus der bewussten Vermeidung von eindeutigen Bedeutungen entsteht.
Berlin in der Neuen Sachlichkeit – »Berlin Alexanderplatz« und »Fabian«: Dieses Kapitel vergleicht Alfred Döblins "Berlin Alexanderplatz" und Erich Kästners "Fabian" als Beispiele der Neuen Sachlichkeit. Es analysiert die Personifikation der Stadt Berlin als Gegenpol zur Depersonalisation der menschlichen Figuren. Der dokumentarische und reportageartige Stil wird untersucht, ebenso die Grenzen der Sachlichkeit in der Darstellung der psychologischen Zustände der Protagonisten. Die Arbeit fragt nach der Sinnhaftigkeit der Großstadtmotivik in der Neuen Sachlichkeit und der Beziehung zwischen Autor, Stadt und Protagonisten.
Assimilationstendenzen und Selbstdressur in Franz Kafkas »Ein Bericht für eine Akademie«: Dieses Kapitel untersucht Franz Kafkas "Ein Bericht für eine Akademie" auf Assimilationstendenzen und Selbstdressur. Es analysiert die Identität des berichterstattenden Affen, seine Entwicklung vom Tier zum scheinbar assimilierten "Menschen" und die Widersprüche dieser Transformation. Es befasst sich mit den Quellen Kafkas, seiner Intention und der Frage, ob der Text als Allegorie der jüdischen Assimilation oder als Kritik an der menschlichen Zivilisation verstanden werden kann. Die Arbeit konzentriert sich auf die Interferenz verschiedener Aspekte der Erzählung.
Michael Endes »Momo« – Ein Kunstmärchen?: Dieses Kapitel untersucht Michael Endes "Momo" auf seine Zuordnung zur Gattung Kunstmärchen. Es analysiert das "Wunderbare" im Werk, die Wirklichkeitsauffassung Endes, das Arsenal des Wunderbaren (Textur, Raum und Zeit, Personal und Konstellationen, Schauplätze), sowie den Vergleich mit der phantastischen Erzählung. Es wird diskutiert, ob "Momo" eine gelingende Initiation darstellt und somit den Kriterien des Kunstmärchens entspricht.
Schlüsselwörter
Warten auf Godot, Samuel Beckett, Absurdes Theater, Ontologie, Absenz, Unbestimmtheit; Neue Sachlichkeit, Berlin Alexanderplatz, Alfred Döblin, Fabian, Erich Kästner, Großstadt, Personifikation, Depersonation; Ein Bericht für eine Akademie, Franz Kafka, Assimilation, Selbstdressur, Identität; Momo, Michael Ende, Kunstmärchen, Phantastische Erzählung, Zeit, Wunderbar.
Häufig gestellte Fragen zu dieser Literaturanalyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert ausgewählte literarische Texte des 20. Jahrhunderts, darunter Samuel Becketts "Warten auf Godot", Alfred Döblins "Berlin Alexanderplatz", Erich Kästners "Fabian", Franz Kafkas "Ein Bericht für eine Akademie" und Michael Endes "Momo". Der Fokus liegt auf der Untersuchung verschiedener literarischer Techniken und deren Wirkung, insbesondere in Bezug auf die Darstellung von Unbestimmtheit, die Neue Sachlichkeit in der Darstellung Berlins und die Thematik der Assimilation und Selbstfindung.
Welche Themen werden in den einzelnen Kapiteln behandelt?
Das erste Kapitel analysiert die Unbestimmtheit und Abwesenheit in Becketts "Warten auf Godot" mittels ontologischer Ansätze. Das zweite Kapitel vergleicht Döblins "Berlin Alexanderplatz" und Kästners "Fabian" im Kontext der Neuen Sachlichkeit und ihrer Darstellung Berlins. Das dritte Kapitel untersucht Assimilation und Selbstdressur in Kafkas "Ein Bericht für eine Akademie". Das vierte Kapitel schließlich befasst sich mit der Gattungszuordnung von Endes "Momo" als Kunstmärchen.
Welche literarischen Techniken werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene literarische Techniken wie die Darstellung von Unbestimmtheit und Absenz, den dokumentarischen und reportageartigen Stil der Neuen Sachlichkeit, die Charakterisierung von Figuren und Erzählperspektiven. Die Analyse umfasst auch die Untersuchung der Wirkungsästhetik, der Großstadtmotivik und der gattungsspezifischen Merkmale von Kunstmärchen und phantastischen Erzählungen.
Wie werden die zentralen Themen der einzelnen Texte dargestellt?
Die Darstellung der Unbestimmtheit in "Warten auf Godot" erfolgt durch eine ontologische Analyse der Präsenz und Absenz von Figuren, Handlungen und Bedeutungen. In Bezug auf die Neue Sachlichkeit wird die Personifikation Berlins als Gegenpol zur Depersonalisation der Menschen analysiert. Die Assimilation in Kafkas Text wird anhand der Transformation des Affen vom Tier zum scheinbar assimilierten "Menschen" untersucht. Schließlich wird in Bezug auf "Momo" die Frage nach der Gelungenschaft einer Initiation als Kriterium für die Zuordnung zum Kunstmärchen geprüft.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: "Warten auf Godot", Samuel Beckett, Absurdes Theater, Ontologie, Absenz, Unbestimmtheit; Neue Sachlichkeit, Berlin Alexanderplatz, Alfred Döblin, Fabian, Erich Kästner, Großstadt, Personifikation, Depersonation; Ein Bericht für eine Akademie, Franz Kafka, Assimilation, Selbstdressur, Identität; Momo, Michael Ende, Kunstmärchen, Phantastische Erzählung, Zeit, Wunderbar.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, ausgewählte literarische Texte des 20. Jahrhunderts zu analysieren und verschiedene literarische Techniken und deren Wirkung zu untersuchen. Der Fokus liegt auf der Darstellung von Unbestimmtheit, der Neuen Sachlichkeit in der Darstellung Berlins und der Thematik der Assimilation und Selbstfindung.
Welche Zusammenfassung der Kapitel bietet die Arbeit?
Die Arbeit bietet Kapitelzusammenfassungen, die die zentralen Argumente und Ergebnisse jedes Kapitels kurz und prägnant zusammenfassen. Diese Zusammenfassungen geben einen Überblick über die analysierten Texte und die daraus gewonnenen Erkenntnisse.
- Quote paper
- René Ferchland (Author), 2009, Studien zur Literaturästhetik des 20. Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/136675