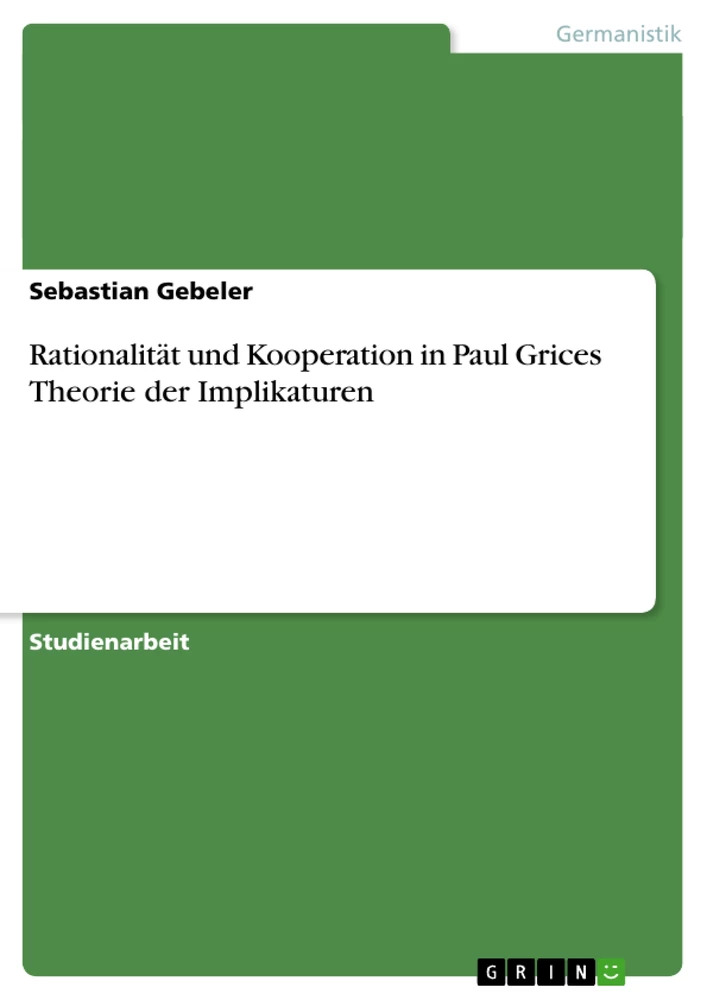Die Arbeit gliedert sich in drei Teile. Zunächst sollen der Begriff der Implikatur und das Konzept des Kooperationsprinzips erläutert und ihre Verbindung untereinander erörtert werden.
Auf der Basis der Untersuchungsergebnisse wird sodann zu klären versucht, in welchem Verhältnis Rationaliät und Kooperation zueinander stehen. In diesem Zusammenhang wird der Frage nachgegangen, weshalb Kooperation als rationale Strategie der Konversation verstanden werden kann und inwiefern der Begriff der Kooperation notwendige Bedingung für die Gricesche Kommunikationstheorie ist. Im Verlaufe der Darstellung wird sich ergeben, dass eine starke Lesart von Kooperativität, auf dem die Gricesche Implikaturen-Theorie basiert, keine notwendige Annahme ist, um den Mechanismus des Implikatierens zu beschreiben. Abschließend wird deshalb der Erstatz des Kooperationsprinzips durch ein Rationalitätsprinzip, wie es erstmals von Asa Kasher vorgeschlagen wurde, erörtert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und Zielsetzung
- 2. Hauptteil
- 2.1 Kooperation und das Kooperationsprinzip
- 1. Kategorie der Quantität
- 2. Kategorie der Qualität
- 3. Kategorie der Relation
- 4. Maxime der Modalität
- 2.2 Konversationale Implikaturen
- 2.3 Kooperationsprinzip, Konversationsmaximen und der Zusammenhang zur Rationalität
- 2.4 Substitution des Kooperationsprinzips
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Paul Grices Kommunikationstheorie, insbesondere das Kooperationsprinzip und dessen Rolle im Zustandekommen konversationeller Implikaturen. Sie beleuchtet den Zusammenhang zwischen Kooperation und Rationalität in der Kommunikation und hinterfragt die Notwendigkeit des Kooperationsprinzips für Grices Erklärungsmodell.
- Grices Kooperationsprinzip und Konversationsmaximen
- Konversationale Implikaturen und deren Entstehung
- Der Zusammenhang zwischen Kooperation und Rationalität in der Kommunikation
- Die Rolle des Kooperationsprinzips in Grices Theorie
- Mögliche Substitution des Kooperationsprinzips durch ein Rationalitätsprinzip
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung und Zielsetzung: Die Einleitung beschreibt Grices Ziel, die Bedingungen zu untersuchen, die unsere Konversation regeln, und die Entstehung der Differenz zwischen Gesagtem und Gemeintem zu erklären. Die Arbeit fokussiert auf Grices Kooperationsprinzip als Grundlage seiner Theorie konversationeller Implikaturen und untersucht dessen Konzept und zentrale Rolle. Sie gliedert sich in drei Teile: Erläuterung von Implikatur und Kooperationsprinzip, Untersuchung des Verhältnisses von Rationalität und Kooperation, und die Erörterung einer möglichen Substitution des Kooperationsprinzips durch ein Rationalitätsprinzip.
2. Hauptteil: Dieser Abschnitt analysiert Grices Argumentation, die die allgemeinen Bedingungen der Konversation und die Analyse von Fällen untersucht, in denen der Sprecher etwas implizit mitteilt. Grice führt den Begriff der Implikatur ein, um die Differenz zwischen dem Gesagten (konventionelle Bedeutung) und dem Implizierten zu beschreiben. Das Kapitel erläutert anhand eines Beispieldialogs, wie der Adressat Schlussfolgerungen ziehen muss, um die vom Sprecher gemeinte Bedeutung zu verstehen. Es wird dargelegt, dass der Hörer auf Hintergrundannahmen und Schlussverfahren zurückgreift, um indirekte Äußerungen zu interpretieren. Schließlich werden Grices vier Konversationsmaximen eingeführt, die aus dem Kooperationsprinzip abgeleitet werden, sowie die Untersuchung des Kooperationsprinzips und des Mechanismus des Implikatierens.
2.1 Kooperation und das Kooperationsprinzip: Dieser Abschnitt erklärt Grices Auffassung von Kommunikation als kooperative Bemühung. Konversationen sind durch Zwecke und Richtungen bestimmt, deren wechselseitige Akzeptanz kooperatives Verhalten darstellt. Der Text legt den Grundstein für die spätere Analyse der Konversationsmaximen, indem er das grundlegende Konzept der Kooperation in Grices Theorie erläutert. Er legt die Basis für das Verständnis, wie die Maximen aus dem Prinzip der Kooperation abgeleitet werden und wie sie das Zusammenspiel der Kommunikationspartner regulieren.
Schlüsselwörter
Paul Grice, Kommunikationstheorie, Kooperationsprinzip, Konversationsmaximen, konversationale Implikaturen, Rationalität, indirekte Kommunikation, Implikatieren, Gesagtes und Gemeintes.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der Kommunikationstheorie Paul Grices
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Paul Grices Kommunikationstheorie, insbesondere das Kooperationsprinzip und seine Rolle bei der Entstehung konversationeller Implikaturen. Der Fokus liegt auf dem Zusammenhang zwischen Kooperation und Rationalität in der Kommunikation und der Frage nach der Notwendigkeit des Kooperationsprinzips für Grices Modell.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Grices Kooperationsprinzip und Konversationsmaximen, die Entstehung konversationeller Implikaturen, den Zusammenhang zwischen Kooperation und Rationalität, die Rolle des Kooperationsprinzips in Grices Theorie und die mögliche Substitution des Kooperationsprinzips durch ein Rationalitätsprinzip.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung mit Zielsetzung, einem Hauptteil mit detaillierter Analyse von Grices Theorie und einer Zusammenfassung der Kapitel. Der Hauptteil unterteilt sich in Abschnitte zu Kooperation und dem Kooperationsprinzip, konversationellen Implikaturen, dem Zusammenhang zwischen Kooperationsprinzip und Rationalität sowie der möglichen Substitution des Kooperationsprinzips.
Was ist Grices Kooperationsprinzip?
Grices Kooperationsprinzip beschreibt Kommunikation als kooperative Bemühung. Konversationen werden durch gemeinsame Zwecke und Richtungen bestimmt, deren wechselseitige Akzeptanz kooperatives Verhalten darstellt. Es bildet die Grundlage für die vier Konversationsmaximen.
Was sind konversationale Implikaturen?
Konversationale Implikaturen beschreiben die Differenz zwischen dem wörtlich Gesagten (konventionelle Bedeutung) und dem Gemeinten. Der Hörer muss Schlussfolgerungen ziehen und auf Hintergrundwissen zurückgreifen, um die vom Sprecher gemeinte Bedeutung zu verstehen.
Welche Rolle spielt die Rationalität?
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Kooperation und Rationalität in der Kommunikation. Es wird hinterfragt, ob das Kooperationsprinzip notwendig ist oder ob ein Rationalitätsprinzip als Ersatz dienen könnte.
Welche Konversationsmaximen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Grices vier Konversationsmaximen (Quantität, Qualität, Relation, Modalität), die aus dem Kooperationsprinzip abgeleitet werden und das Zusammenspiel der Kommunikationspartner regulieren.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind Paul Grice, Kommunikationstheorie, Kooperationsprinzip, Konversationsmaximen, konversationale Implikaturen, Rationalität, indirekte Kommunikation, Implikatieren, Gesagtes und Gemeintes.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit kommt zu Schlussfolgerungen bezüglich der Bedeutung des Kooperationsprinzips für Grices Theorie und untersucht die Möglichkeit einer alternativen Erklärung durch ein Rationalitätsprinzip. Die genauen Schlussfolgerungen sind im Detail im Hauptteil der Arbeit ausgeführt.
Wo finde ich weitere Informationen?
(Hier könnten Links zu weiterführender Literatur oder zu der vollständigen Arbeit eingefügt werden)
- Arbeit zitieren
- Sebastian Gebeler (Autor:in), 2008, Rationalität und Kooperation in Paul Grices Theorie der Implikaturen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/136713