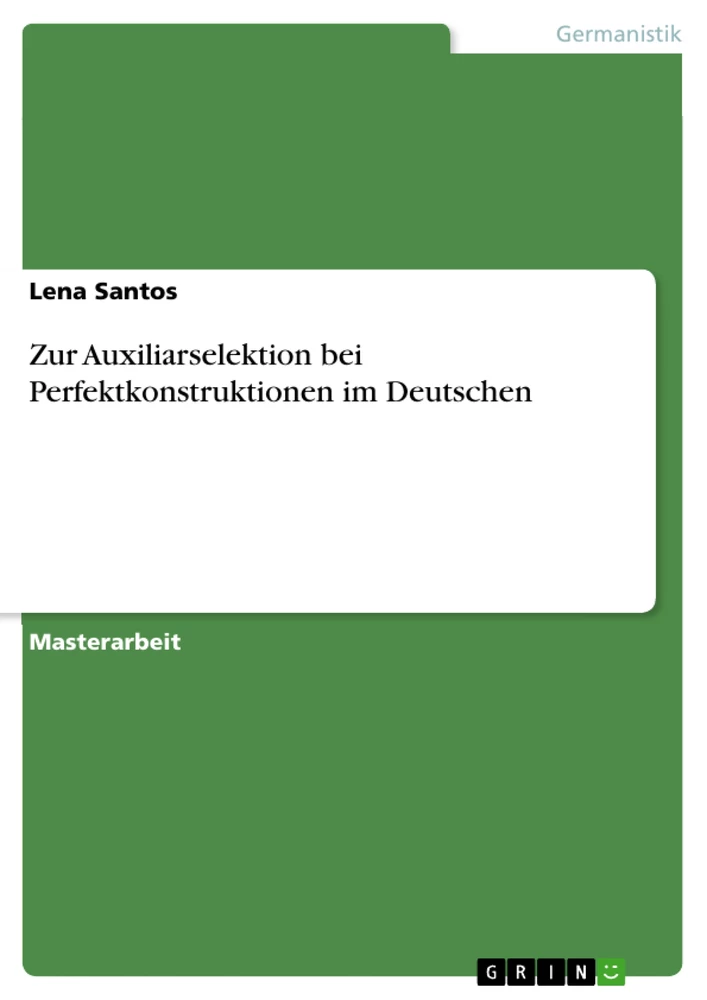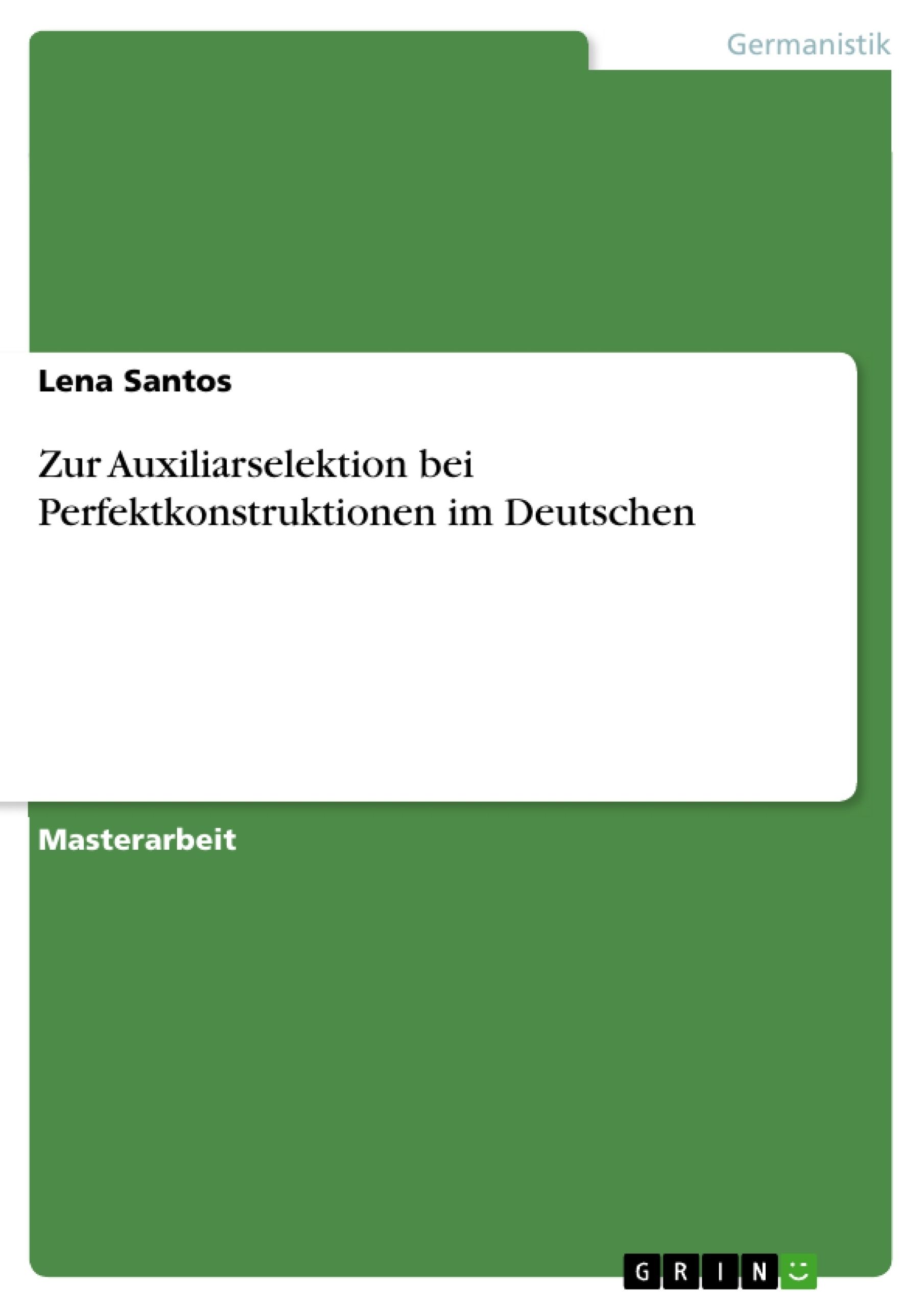Die Auxiliarselektion bei Perfektkonstruktionen im Deutschen stellt den Gegenstand der vorliegenden Arbeit dar. Das Ziel ist dabei eine Annäherung an die Erklärung des Auxiliarverhaltens bei Perfektkonstruktionen deutscher Verben. Zu Beginn wird eine theoretische Grundlage geschaffen, indem zunächst auf die Klasse der Auxiliare, auf die Theta-Rolle sowie auf die unterschiedlichen Zeitstrukturen des Deutschen eingegangen wird. Im Anschluss daran werden verschiedene Erklärungsansätze zur Auxiliarselektion bei Perfektkonstruktionen skizziert. Dabei wird auf Haider (1984) und sein Prinzip der Blockierung und Deblockierung eingegangen. Anschließend folgen die Ansätze der Linguisten von Stechow und Sternfeld (1988) sowie von Keller und Sorace (2003) und anschließend von Strobel (2008). Innerhalb des Ansatzes nach von Stechow und Sternfeld (1988) wird insbesondere das Thetakriterium als Erklärung der Alternanz hinsichtlich der Perfektauxiliarselektion herangezogen. Der Ansatz von Keller und Sorace (2003) begründet das binäre Auxiliarverhalten mithilfe der Schnittstelle zwischen der Syntax und der Semantik. Strobel (2008) unterscheidet zwischen lexembedingter, regelbedingter sowie idiosynkratischer Auxiliarselektion, die jeweils unterschiedliche Determinanten besitzen, und belegt seinen Ansatz damit, dass die von ihm aufgestellte Regel weniger Ausnahmen aufweist, als diejenigen Ansätze, die in Abschnitt 3.4.2 dargestellt werden. Abschließend folgt eine Diskussion der Ansätze, indem sie miteinander verglichen und die darin enthaltenen Annahmen kritisch bewertet werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung.
- 2. Theoretische Grundlage
- 2.1 Die Klasse der Auxiliare…........
- 2.1.1 Die Finitheit als Auxiliarfunktion .....
- 2.2 Theta-Rollen ........
- 2.3 Zeitstrukturen.....
- 3. Erklärungsansätze.………………………..\n
- 3.1 Das Prinzip von Argumentblockierung und Deblockierung nach Haider (1984)
- 3.1.1 Grundlagen......
- 3.1.2 Blockierung und Deblockierung bei Partizipien und dem Element zu .........
- 3.1.3 Deblockierung im satzwertigen Infinitiv.
- 3.1.4 Das System von Blockierung und Deblockierung ..
- 3.1.5 Konsequenzen des Zusammenhangs von zu und dem Merkmalbündel INFL
- 3.1.6 Infinite Verben im Deutschen und deren Bildung......
- 3.2 Die Bedeutung von Theta-Rollen nach von Stechow und Sternfeld (1988).....
- 3.2.1 Theta-Rollen und Kasuszuweisung an Ketten.
- 3.2.2 Theta-Kriterium .......
- 3.2.3 Theta-Kriterium und Kasustheorie
- 3.3 Die Zustandsveränderung, die syntaktische Transitivität sowie die Idiosynkrasie als Determinanten der Perfektauxiliarselektion nach Strobel (2008)..\n
- 3.3.1 Alternative Perfektauxiliarselektion ..
- 3.3.2 Weitere Ansätze ....
- 3.3.3 Kritik an der Unakkusativitätshypothese....
- 3.4 Der semantisch-syntaktische Ansatz nach Keller und Sorace (2003) .……………………………..
- 3.4.1 Unakkusativitätshypothese und gespaltene Intransitivität......
- 3.4.2 Auxiliarselektion
- 3.4.3 Unpersönliches Passiv
- 4. Diskussion der Ansätze und Ausblick………………………..\n
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Auxiliarselektion bei Perfektkonstruktionen im Deutschen, wobei das Ziel eine Annäherung an die Erklärung des Auxiliarverhaltens bei Perfektkonstruktionen deutscher Verben ist.
- Die theoretischen Grundlagen zur Klasse der Auxiliare, Theta-Rollen und Zeitstrukturen werden dargelegt.
- Verschiedene Erklärungsansätze zur Auxiliarselektion werden vorgestellt, wobei der Fokus auf den Prinzipien der Blockierung und Deblockierung (Haider 1984), dem Thetakriterium (von Stechow und Sternfeld 1988), dem semantisch-syntaktischen Ansatz (Keller und Sorace 2003) und der lexembedingten, regelbedingten sowie idiosynkratischen Auxiliarselektion (Strobel 2008) liegt.
- Die Interaktion von Semantik und Syntax bei der Auxiliarselektion wird beleuchtet.
- Die Unterschiede zwischen systematischer und idiosynkratischer Auxiliarselektion werden betrachtet.
- Die Arbeit untersucht die unterschiedlichen Determinanten, die die Wahl des Auxiliars beeinflussen.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel widmet sich der Einleitung und stellt das Thema der Arbeit vor, nämlich die Auxiliarselektion bei Perfektkonstruktionen im Deutschen. Es werden die grundlegenden Beobachtungen und die Relevanz des Themas erläutert.
Im zweiten Kapitel werden die theoretischen Grundlagen für die Analyse der Auxiliarselektion gelegt. Es werden die Klasse der Auxiliare, die Theta-Rollen und die unterschiedlichen Zeitstrukturen im Deutschen behandelt.
Das dritte Kapitel befasst sich mit verschiedenen Erklärungsansätzen zur Auxiliarselektion bei Perfektkonstruktionen. Es werden die Ansätze von Haider (1984), von Stechow und Sternfeld (1988), Keller und Sorace (2003) sowie Strobel (2008) vorgestellt und diskutiert.
Schlüsselwörter
Auxiliarselektion, Perfektkonstruktionen, Deutsches Verbensystem, Theta-Rollen, Zeitstrukturen, Blockierung und Deblockierung, Thetakriterium, semantisch-syntaktischer Ansatz, lexembedingte, regelbedingte und idiosynkratische Auxiliarselektion, Unakkusativitätshypothese.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Auxiliarselektion im Deutschen?
Es beschreibt die Wahl des Hilfsverbs (haben oder sein) bei der Bildung von Perfektkonstruktionen.
Was besagt das Prinzip der Blockierung nach Haider?
Haider (1984) erklärt das Verhalten von Verben durch das Prinzip der Argumentblockierung und Deblockierung bei Partizipien und Infinitiven.
Welche Rolle spielen Theta-Rollen bei der Wahl des Hilfsverbs?
Nach von Stechow und Sternfeld (1988) ist das Thetakriterium entscheidend für die Alternanz bei der Perfektauxiliarselektion.
Was ist der Unterschied zwischen systematischer und idiosynkratischer Selektion?
Strobel (2008) unterscheidet zwischen regelbasierten Entscheidungen (systematisch) und sprachhistorisch bedingten Ausnahmen (idiosynkratisch).
Was ist die Unakkusativitätshypothese?
Diese Hypothese, diskutiert von Keller und Sorace (2003), begründet das Auxiliarverhalten durch die Schnittstelle zwischen Syntax und Semantik bei intransitiven Verben.
- Quote paper
- Lena Santos (Author), 2022, Zur Auxiliarselektion bei Perfektkonstruktionen im Deutschen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1367741